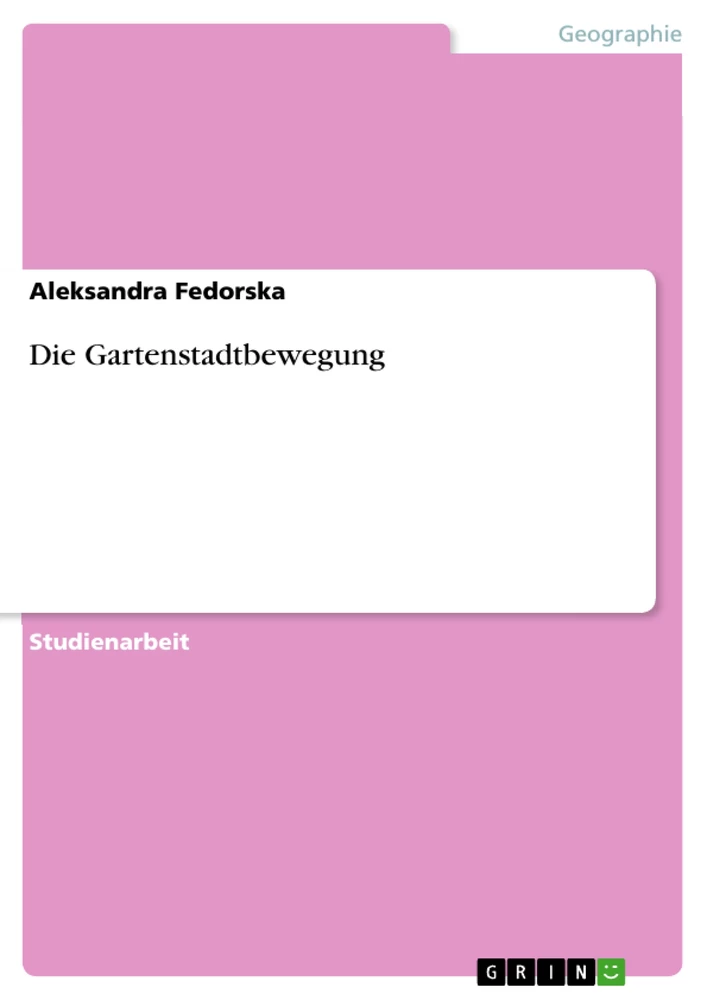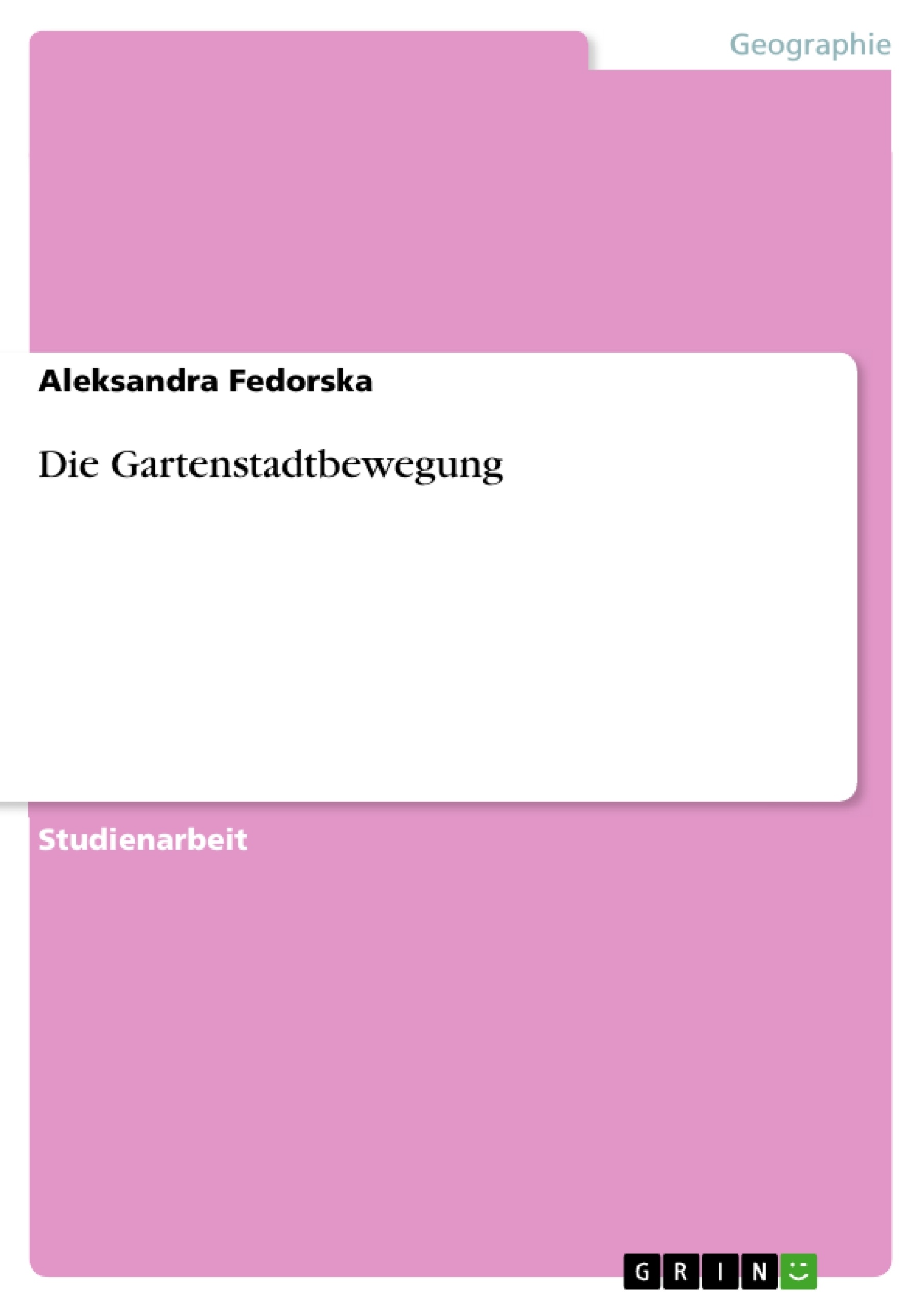Die Idee der Gartenstadt wurde am Ende des 19. Jahrhunderts geboren. Der Brite Ebenzer Howard war mit den Zuständen der Städte unzufrieden. Im Zuge der Industrialisierung wuchsen die englischen Städte im rasantem Tempo. Sowohl der Zuwachs an Bevölkerung, als auch die Ausdehnung in der Fläche führte zu starker Unzufriedenheit mit den Lebensumständen in den Städten. Der verstärkte Bedarf an Boden zog eine unkontrollierbare Bodenspekulationswelle nach sich. Wohnraum als Kapitalanlage war ein gutes Geschäft für Vermögende. Arbeiter dagegen waren gezwungen in kleinen Wohnungen der dichtgebauten Städte zu leben. Die industrielle Expansion zog immer mehr Arbeitskräfte in die städtischen Ballungsräume. Die wirtschaftliche Not und der starke Zuwachs an Bevölkerung förderte die Entstehung von Slums. (vgl. Mumford 1963. S. 602ff.)
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Historischer Rückblick ins 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts
- 2. Definition und Ziel der Gartenstadtidee von E. Howard
- 3. Merkmale der Gartenstadt
- 4. Beispiel in Kiel: Gartenstadt Elmschenhagen
- 4.1 Bau der Gartenstadt
- 4.1.1 Elmschenhagen Nord
- 4.1.2 Elmschenhagen Süd
- 4.1.3 Ausgestaltung der Wohnungen
- 4.1.4 Ausgestaltung der gesamten Anlage
- 4.1 Bau der Gartenstadt
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Gartenstadtbewegung, insbesondere ihre Entstehung im Kontext der Industrialisierung und die Umsetzung des Konzepts in der Gartenstadt Elmschenhagen in Kiel. Sie beleuchtet die Ziele und Merkmale der Gartenstadtidee nach Ebenezer Howard und analysiert deren praktische Anwendung im Vergleich zur Theorie.
- Die Entstehung der Gartenstadtbewegung als Reaktion auf die sozialen und räumlichen Missstände der Industrialisierung.
- Die Definition und Ziele der Gartenstadtidee nach Ebenezer Howard.
- Die charakteristischen Merkmale einer Gartenstadt hinsichtlich ihrer Planung, Architektur und sozialen Struktur.
- Die Umsetzung der Gartenstadtidee in Elmschenhagen, Kiel, unter Berücksichtigung der spezifischen Bedingungen.
- Der Vergleich zwischen Theorie und Praxis der Gartenstadtentwicklung.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Historischer Rückblick ins 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts: Die Entstehung der Gartenstadtbewegung wird im Kontext der Industrialisierung und deren Folgen auf die Städte des 19. Jahrhunderts dargestellt. Die rasante Urbanisierung, verbunden mit Überbevölkerung, Wohnungsnot und dem Entstehen von Slums, führte zu einer starken Unzufriedenheit mit den Lebensumständen in den Städten. Die zunehmende Bodenspekulation verschärfte die Situation für die arbeitende Bevölkerung, die in kleinen, überfüllten Wohnungen leben musste. Dieser soziale und räumliche Missstand bildete den Nährboden für die Ideen der Gartenstadtbewegung.
2. Definition und Ziel der Gartenstadtidee von E. Howard: Dieses Kapitel beschreibt Ebenezer Howards Vision einer neuen Siedlungsform, die die Vorteile des städtischen und ländlichen Lebens vereinen sollte. Howard's Buch „Garden Cities of Tomorrow“ skizziert eine Gartenstadt als eine idealtypische Siedlung mit kontrollierter Größe, einer Mischung aus Wohn- und Arbeitsbereichen, Grünflächen und gemeinschaftlichen Einrichtungen. Das zentrale Ziel war die Schaffung eines gesunden und sozial ausgeglichenen Lebensumfelds, frei von den negativen Auswirkungen der unkontrollierten Urbanisierung. Ein entscheidender Aspekt war auch Howards Konzept des Gemeineigentums am Boden, um Wucher zu verhindern und den Zusammenhalt der Bewohner zu fördern.
3. Merkmale einer Gartenstadt: Hier werden die charakteristischen Merkmale einer Gartenstadt detailliert beschrieben. Die beschränkte Einwohnerzahl (max. 32.000), die Lage abseits großer Städte mit Anbindung über Landstraßen oder Eisenbahn, die kreisförmige Anordnung mit Grünflächen und Parks, die geringe Wohndichte und die zentrale Lage von Versorgungseinrichtungen und Verwaltung bilden die zentralen Elemente. Die Anordnung von Industrie- und Gewerbegebieten am äußeren Ring der Siedlung, um kurze Wege zwischen Wohn- und Arbeitsbereichen zu gewährleisten, vervollständigt das Konzept.
4. Beispiel in Kiel: Gartenstadt Elmschenhagen: Dieses Kapitel präsentiert die Gartenstadt Elmschenhagen als Fallbeispiel. Es werden die Baugeschichte, die beteiligten Firmen und Architekten sowie die Architektur und die Ausgestaltung der Wohnungen und der gesamten Anlage beschrieben. Es werden unterschiedliche Wohnungstypen und ihre Ausstattung detailliert erläutert und die Herausforderungen des Baus unter den Bedingungen des Zweiten Weltkriegs beleuchtet. Die Unterschiede zwischen Elmschenhagen Nord und Süd und die Integration des bestehenden Ortskerns werden diskutiert. Die Ausgestaltung der Anlage wird im Detail besprochen, inklusive der Integration von Grünflächen, Parks und öffentlichen Einrichtungen. Die Rolle der nationalsozialistischen Auftraggeber und deren Einfluss auf die Bauweise und -geschwindigkeit wird ebenfalls angesprochen.
Schlüsselwörter
Gartenstadtbewegung, Ebenezer Howard, Industrialisierung, Urbanisierung, Stadtplanung, Wohnungsbau, soziale Gerechtigkeit, Elmschenhagen, Kiel, Architektur, Gemeineigentum, Wohnungsnot, Slums.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Gartenstadt Elmschenhagen in Kiel
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Gartenstadtbewegung, insbesondere anhand der Gartenstadt Elmschenhagen in Kiel. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Stichwortverzeichnis. Der Fokus liegt auf der Entstehung der Gartenstadtbewegung im Kontext der Industrialisierung, der Umsetzung des Konzepts nach Ebenezer Howard und einem Vergleich von Theorie und Praxis in Elmschenhagen.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Die zentralen Themen sind die Entstehung der Gartenstadtbewegung als Reaktion auf die sozialen und räumlichen Probleme der Industrialisierung, die Definition und Ziele der Gartenstadtidee nach Ebenezer Howard, die charakteristischen Merkmale einer Gartenstadt (Planung, Architektur, soziale Struktur), die konkrete Umsetzung in Elmschenhagen (Baugeschichte, Architektur, soziale Aspekte), und ein Vergleich zwischen Theorie und Praxis der Gartenstadtentwicklung. Der Einfluss des Nationalsozialismus auf den Bau wird ebenfalls thematisiert.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in vier Kapitel: 1. Historischer Rückblick ins 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts (Kontext der Industrialisierung und Entstehung der Gartenstadtbewegung); 2. Definition und Ziel der Gartenstadtidee von E. Howard (Howards Vision und Ziele); 3. Merkmale einer Gartenstadt (charakteristische Merkmale der Planung und Gestaltung); 4. Beispiel in Kiel: Gartenstadt Elmschenhagen (detaillierte Beschreibung der Gartenstadt Elmschenhagen, einschließlich Baugeschichte, Architektur und soziale Aspekte).
Was ist die Gartenstadtidee nach Ebenezer Howard?
Ebenezer Howards Gartenstadtidee zielte darauf ab, die Vorteile des städtischen und ländlichen Lebens zu vereinen. Er plante eine idealtypische Siedlung mit kontrollierter Größe, einer Mischung aus Wohn- und Arbeitsbereichen, Grünflächen und gemeinschaftlichen Einrichtungen. Das zentrale Ziel war die Schaffung eines gesunden und sozial ausgeglichenen Lebensumfelds, frei von den negativen Auswirkungen der unkontrollierten Urbanisierung. Ein wichtiger Aspekt war auch Howards Konzept des Gemeineigentums am Boden.
Wie wurde die Gartenstadtidee in Elmschenhagen umgesetzt?
Das Kapitel über Elmschenhagen beschreibt detailliert die Baugeschichte, die beteiligten Firmen und Architekten, die Architektur der Wohnungen, die Ausgestaltung der gesamten Anlage (Grünflächen, Parks, öffentliche Einrichtungen), die Unterschiede zwischen Elmschenhagen Nord und Süd und die Integration des bestehenden Ortskerns. Es werden auch die Herausforderungen des Baus unter den Bedingungen des Zweiten Weltkriegs und der Einfluss der nationalsozialistischen Auftraggeber beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Gartenstadtbewegung, Ebenezer Howard, Industrialisierung, Urbanisierung, Stadtplanung, Wohnungsbau, soziale Gerechtigkeit, Elmschenhagen, Kiel, Architektur, Gemeineigentum, Wohnungsnot, Slums.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument ist relevant für Wissenschaftler, Studenten, Stadtplaner, Architekten und alle, die sich für die Geschichte der Stadtplanung, die Gartenstadtbewegung und die soziale Geschichte der Industrialisierung interessieren. Es bietet einen fundierten Einblick in die Theorie und Praxis der Gartenstadtentwicklung anhand des Beispiels Elmschenhagen.
- Quote paper
- Aleksandra Fedorska (Author), 2002, Die Gartenstadtbewegung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3368