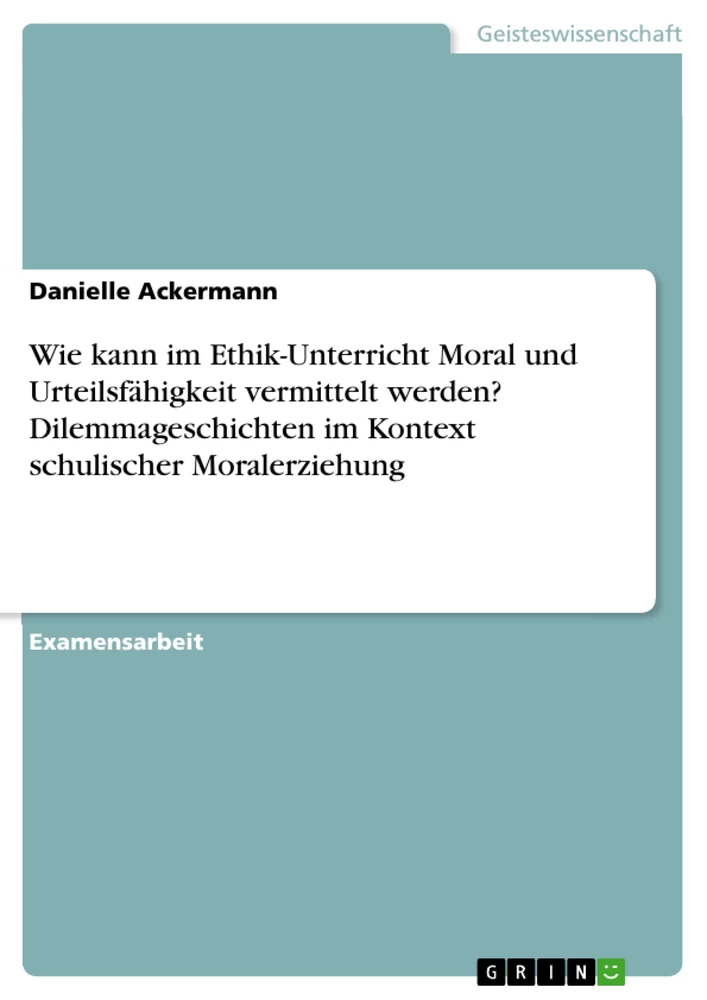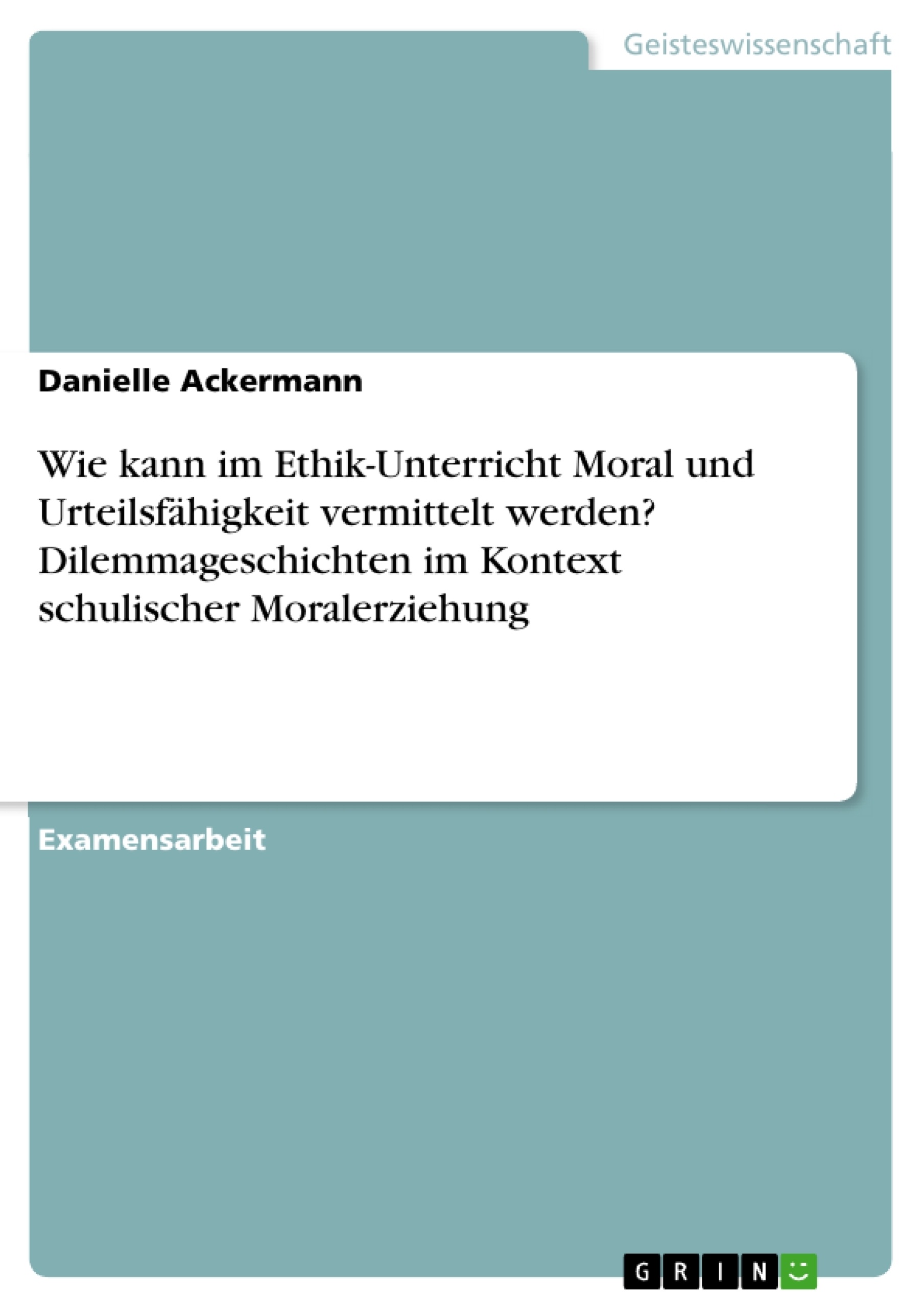In der vorliegenden Examensarbeit geht es um die Frage, wie die Schule und insbesondere der Ethikunterricht nicht nur Moral, sondern auch Urteilsfähigkeit zu vermitteln vermögen, um der momentanen gesellschaftlichen Situation eventuell sogar durch einen Beitrag entgegenzuwirken.
Während der erste Teil noch definitorischen Überlegungen gewidmet ist und die Moralerziehung im schulischen Kontext thematisiert, soll im zweiten Kapitel ein Einstieg in das Konzept von Lawrence Kohlberg erfolgen. Hierbei wird neben seinen Grundannahmen und dem entwickelten Stufenmodell vor allem der kognitiv-moralische Konflikt hinsichtlich seines Nutzens für die Moralerziehung von Schülern untersucht. Daraus ergibt sich sodann die Arbeit mit Dilemmageschichten, welche im Fokus dieser Arbeit stehen und deshalb im darauf folgenden dritten Kapitel näher beleuchtet werden. Da dieser methodische Ansatz allerdings nicht rein theoretisch bleiben soll, wird abschließend (Kapitel 4) ein Umsetzungsbeispiel für die Praxis vorgestellt. In einer für die gymnasiale Oberstufe konzipierten Unterrichtsreihe soll hier exemplarisch aufgezeigt werden, wie die Dilemma-Thematik in der Schule unterrichtet werden kann.
„Geringe Wahlbeteiligung, vermutetes oder tatsächliches politisches Desinteresse junger Menschen, Erscheinungsformen von Extremismus und Gewaltbereitschaft – so oder so ähnlich sieht immer wieder die Kulisse aus, vor der in der Öffentlichkeit die Notwendigkeit von politischer Bildung in Schulen diskutiert wird“, wobei politische Bildung an dieser Stelle als „Werteerziehung und Persönlichkeitsbildung“ verstanden werden soll. Es scheint nicht allzu gut bestellt zu sein um die gesellschaftliche Moral, und deshalb wird der Ruf nach Moralerziehung und einer Wiederbelebung der Werte stets lauter. So stellt sich an dieser Stelle immer wieder die Frage, inwiefern die Schulen dieser Situation durch einen Beitrag entgegenwirken können.
Festzuhalten ist, dass die heutige gesellschaftliche Situation durch zahlreiche Probleme und ansteigende Herausforderungen gekennzeichnet ist, die zweifellos auf Prozesse wie Globalisierung, Pluralisierung und Individualisierung, mit denen unterschiedliche, veränderte und vermehrte Werte- und Moralvorstellungen einhergehen, zurückzuführen sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Übersicht der Arbeit
- 1.2 Was ist Moral?
- 1.3 Moralerziehung im schulischen Kontext
- 2 Lawrence Kohlberg
- 2.1 John Dewey und Jean Piaget
- 2.2 Die Grundannahmen Kohlbergs
- 2.2.1 Wertrelativismus und Indoktrination
- 2.2.2 Kohlbergs Definition von Moral und Gerechtigkeit
- 2.3 Moralische Stufenmodelle
- 2.4 Kohlbergs Stufenmodell moralischer Entwicklung
- 2.4.1 Die Stufe 0
- 2.4.2 Die Stufen der präkonventionellen Ebene
- 2.4.3 Die Stufen der konventionellen Ebene
- 2.4.4 Die Stufen der postkonventionellen Ebene
- 2.5 Kritische Auseinandersetzung mit der Theorie Kohlbergs
- 3 Dilemmata als Aspekt der Moralerziehung
- 3.1 „Plus-Eins-Konvention“
- 3.2 Typen und Strukturen von Dilemmata
- 3.2.1 Das hypothetische Dilemma
- 3.2.2 Das Realdilemma
- 3.2.3 Das politische Dilemma
- 3.3 Ansprüche an Dilemmata
- 3.4 Ansprüche an den Lehrer
- 3.5 Vorteile und Ziele von Dilemmadiskussionen
- 4 Praktische Umsetzung
- 4.1 Typischer Ablauf einer Dilemmadiskussion
- 4.1.1 Darbietung des Dilemmas
- 4.1.2 Erste spontane Stellungnahme
- 4.1.3 Überprüfung und Begründung der Entscheidungen
- 4.1.4 Plenumsdiskussion
- 4.1.5 Reflexion
- 4.2 Dilemmadiskussionen im Ethikunterricht
- 4.2.1 Unterrichtskonzept
- 4.2.2 Zeitliche und didaktische Einordnung
- 4.2.3 Fazit
- 5 Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Vermittlung von Moral und Urteilsfähigkeit im Ethikunterricht. Sie analysiert, wie die Schule auf gesellschaftliche Herausforderungen wie Wertepluralismus und den vermeintlichen Werteverfall reagieren kann. Im Mittelpunkt steht die Methode der Dilemmadiskussion als Werkzeug zur Förderung moralischer Urteilsfähigkeit.
- Definition und Bedeutung von Moral im schulischen Kontext
- Kohlbergs Stufenmodell der moralischen Entwicklung und dessen Kritik
- Dilemmata als didaktisches Mittel zur Moralerziehung
- Praktische Umsetzung von Dilemmadiskussionen im Unterricht
- Förderung von Urteils- und Diskursfähigkeit bei Schülerinnen und Schülern
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt den gesellschaftlichen Hintergrund der Arbeit, geprägt von Fragen zur Moralerziehung angesichts von Wertepluralismus und vermeintlichem Werteverfall. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Vermittlung von Moral und Urteilsfähigkeit in der Schule, insbesondere im Ethikunterricht, und skizziert den Aufbau der Arbeit. Die Einleitung betont die Notwendigkeit, nicht nur moralische Ideale zu vermitteln, sondern vor allem die Fähigkeit, mit moralischen Dilemmata umzugehen.
2 Lawrence Kohlberg: Dieses Kapitel widmet sich der Theorie von Lawrence Kohlberg. Es werden seine Grundannahmen, insbesondere die Definition von Moral und Gerechtigkeit, sowie sein Stufenmodell der moralischen Entwicklung detailliert dargestellt. Die verschiedenen Stufen (präkonventionell, konventionell, postkonventionell) werden erläutert, und es wird eine kritische Auseinandersetzung mit der Theorie Kohlbergs geführt, einschließlich der Diskussion um Wertrelativismus und Indoktrination. Der Bezug zu den Vorläufern Dewey und Piaget wird hergestellt.
3 Dilemmata als Aspekt der Moralerziehung: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Einsatz von Dilemmata in der Moralerziehung. Es werden verschiedene Dilemma-Typen (hypothetisch, real, politisch) unterschieden und die Anforderungen an gut gestaltete Dilemmata sowie die Rolle des Lehrers in der Dilemmadiskussion erörtert. Die Kapitel diskutiert die Vorteile und Ziele von Dilemmadiskussionen für die Förderung moralischer Urteilsfähigkeit. Der Begriff der „Plus-Eins-Konvention“ wird eingeführt und erläutert.
4 Praktische Umsetzung: Dieses Kapitel präsentiert ein konkretes Beispiel für die Umsetzung von Dilemmadiskussionen im Ethikunterricht der gymnasialen Oberstufe. Es beschreibt den typischen Ablauf einer solchen Diskussion, von der Darbietung des Dilemmas über die Diskussion bis hin zur Reflexion. Der Fokus liegt auf dem didaktischen Konzept und der zeitlichen Einordnung des Unterrichts. Das Kapitel liefert praktische Hinweise zur Durchführung und reflektiert die Erfahrungen mit diesem methodischen Ansatz.
Schlüsselwörter
Moralerziehung, Ethikunterricht, Lawrence Kohlberg, Stufenmodell der moralischen Entwicklung, Dilemmadiskussion, Urteilsfähigkeit, Wertepluralismus, moralische Dilemmata, gesellschaftlicher Werteverfall, didaktische Methoden.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Moralerziehung durch Dilemmadiskussionen
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Vermittlung von Moral und Urteilsfähigkeit im Ethikunterricht, insbesondere die Methode der Dilemmadiskussion als Werkzeug zur Förderung moralischer Urteilsfähigkeit im Kontext von Wertepluralismus und vermeintlichem Werteverfall.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Bedeutung von Moral im schulischen Kontext, Kohlbergs Stufenmodell der moralischen Entwicklung (inklusive Kritik), den Einsatz von Dilemmata in der Moralerziehung (verschiedene Typen: hypothetisch, real, politisch), die praktische Umsetzung von Dilemmadiskussionen im Unterricht (inkl. Ablauf und didaktisches Konzept) und die Förderung von Urteils- und Diskursfähigkeit bei Schülern.
Wer ist Lawrence Kohlberg und welche Rolle spielt er?
Lawrence Kohlberg ist ein wichtiger Bezugspunkt der Arbeit. Seine Theorie der moralischen Entwicklung, inklusive seines Stufenmodells (präkonventionell, konventionell, postkonventionell), wird detailliert dargestellt und kritisch beleuchtet. Der Zusammenhang zu den Vorläufern Dewey und Piaget wird hergestellt. Die Diskussion umfasst auch Aspekte wie Wertrelativismus und Indoktrination.
Was sind Dilemmata im Kontext dieser Arbeit?
Dilemmata werden als didaktisches Mittel zur Moralerziehung eingesetzt. Die Arbeit unterscheidet verschiedene Typen (hypothetische, reale und politische Dilemmata) und beschreibt die Anforderungen an gut gestaltete Dilemmata sowie die Rolle des Lehrers in der Dilemmadiskussion. Die "Plus-Eins-Konvention" wird ebenfalls erläutert.
Wie werden Dilemmadiskussionen im Unterricht umgesetzt?
Die Arbeit beschreibt den typischen Ablauf einer Dilemmadiskussion: Darbietung des Dilemmas, spontane Stellungnahmen, Überprüfung und Begründung der Entscheidungen, Plenumsdiskussion und Reflexion. Es wird ein didaktisches Konzept für den Einsatz im Ethikunterricht vorgestellt, einschließlich zeitlicher und didaktischer Einordnung.
Welche Vorteile bieten Dilemmadiskussionen?
Dilemmadiskussionen fördern die moralische Urteilsfähigkeit, die Fähigkeit, mit moralischen Konflikten umzugehen, und die Entwicklung von Argumentations- und Diskursfähigkeiten bei den Schülern. Sie ermöglichen eine Auseinandersetzung mit unterschiedlichen moralischen Perspektiven und Werten.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Moralerziehung, Ethikunterricht, Lawrence Kohlberg, Stufenmodell der moralischen Entwicklung, Dilemmadiskussion, Urteilsfähigkeit, Wertepluralismus, moralische Dilemmata, gesellschaftlicher Werteverfall und didaktische Methoden.
Welche gesellschaftlichen Herausforderungen werden angesprochen?
Die Arbeit thematisiert den Wertepluralismus und den vermeintlichen Werteverfall als gesellschaftliche Herausforderungen und untersucht, wie die Schule darauf reagieren kann, indem sie moralische Urteilsfähigkeit und den Umgang mit moralischen Dilemmata fördert.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält eine Kapitelzusammenfassung, die jeden Abschnitt detailliert beschreibt und seine Kernaussagen hervorhebt.
- Arbeit zitieren
- Danielle Ackermann (Autor:in), 2012, Wie kann im Ethik-Unterricht Moral und Urteilsfähigkeit vermittelt werden? Dilemmageschichten im Kontext schulischer Moralerziehung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/336628