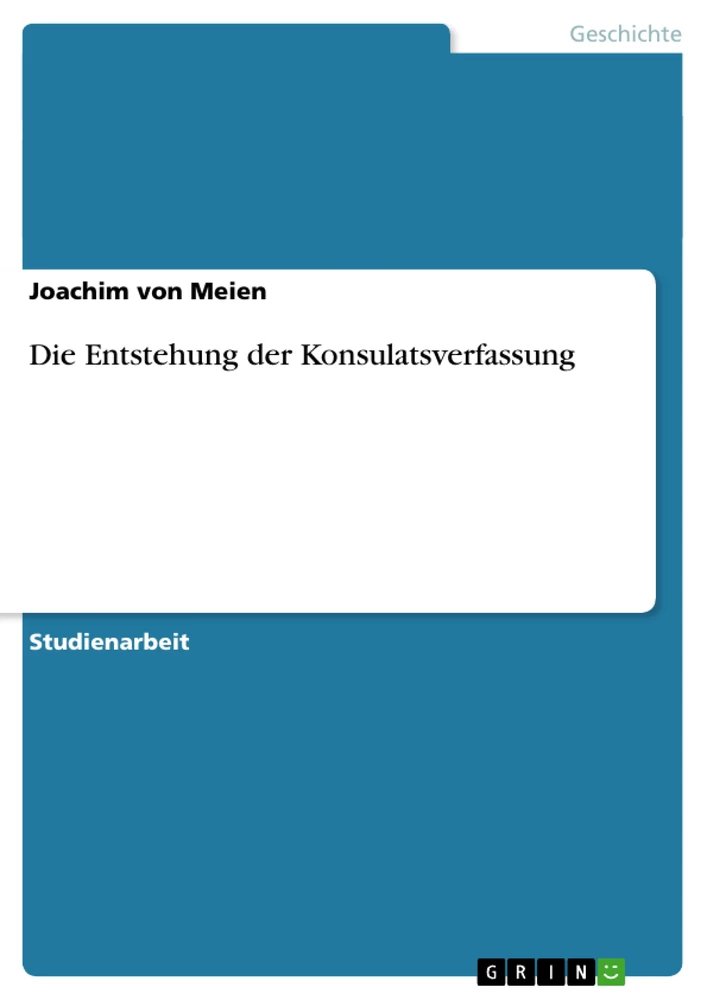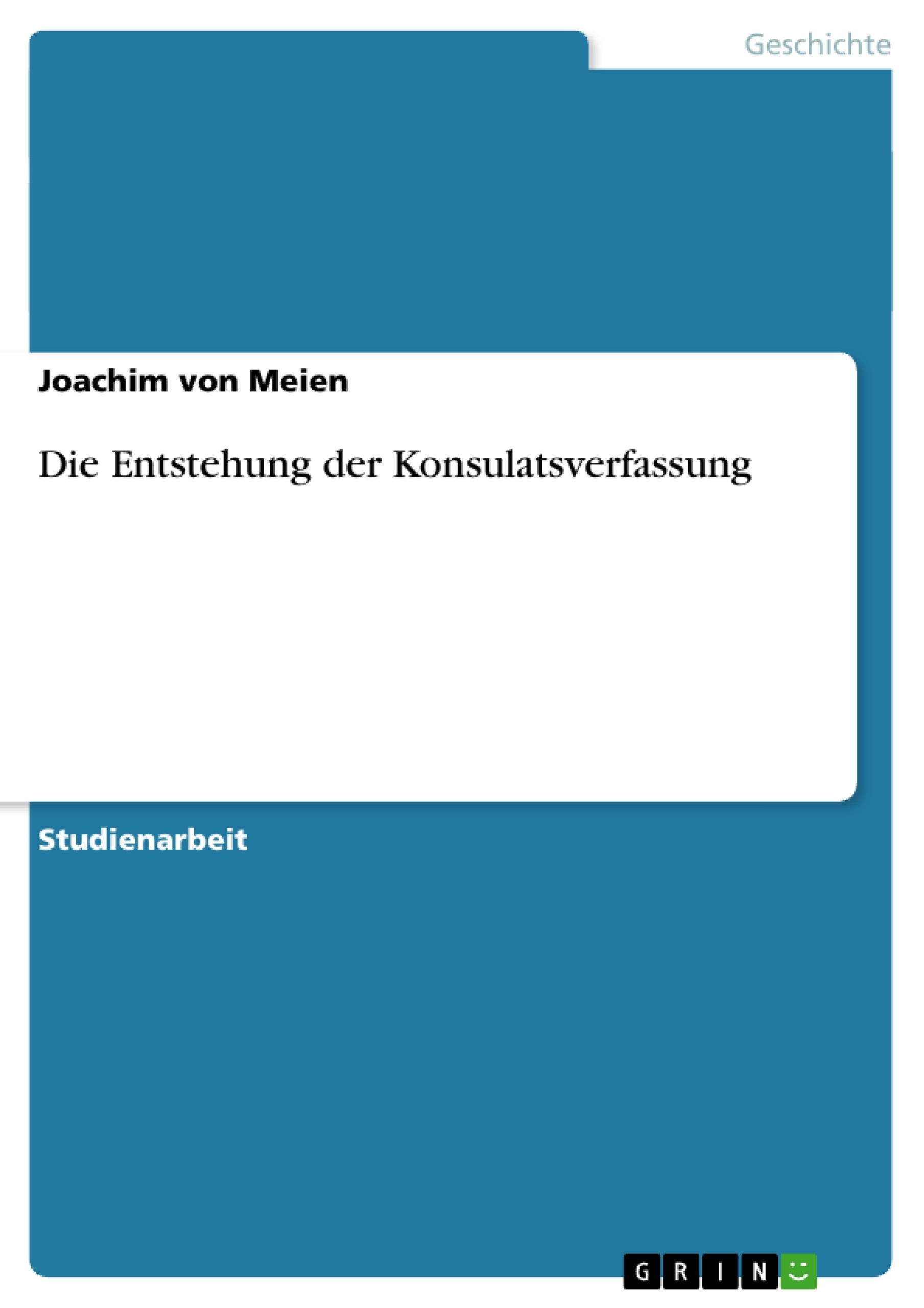Die Entstehung der Konsulatsverfassung bewegt die Forschung schon seit längerer Zeit und hat zu verschiedenen Standpunkten bezüglich der Thematik geführt. Zunächst bedarf es einer kurzen Begriffseinordnung. Unter der Konsulatsverfassung ist die Art der Verfassung gemeint, bei der das römische Oberamt von zwei Konsuln besetzt war, für die die Grundsätze der Kollegialität, Annuität und der Interzession galten.1
Da in der Königszeit eklatanterweise ein König an der Spitze des römischen Volkes stand, sind für die Behandlung des Themas die Jahre seit der Vertreibung dieses letzten etruskischen Königs, Tarquinius Superbus (Ende des 6. Jahrhunderts), bis zu den leges Liciniae Sextiae (367 v. Chr.) von Bedeutung. Die beiden Hauptquellen, die in dieser Arbeit Verwendung finden, sind die „Römische Geschichte“ des Titus Livius und das Werk des Dionys von Halikarnaß. An anderer Stelle werden zusätzlich das Zwölftafelgesetz, Diodorus Siculus von Agyrion sowie Gellius zitiert, um das antike Bild der Entstehung der Konsulatsverfassung zu präzisieren.
Kapitel 2 beschäftigt sich zunächst mit der Situation des römischen Oberamtes am Beginn der Republik. Es stellt sich die Frage, welche Regierungsform die Republik nach der Abschaffung der Monarchie hatte. Wurde die Konsulatsverfassung etwa schon unmittelbar zum Beginn der Republik eingeführt? Zunächst sollen die antiken Autoren mit ihrer Sicht der Dinge zu Wort kommen. Anschließend findet eine Auflistung verschiedener Forschungsmeinungen zu dieser durch die Quellen nicht sehr umfangreich wiedergegebenen Zeit statt.
Das folgende Kapitel untersucht, inwieweit die Zwölftafelgesetze des Jahres 451 v. Chr. Informationen zur Entstehung der Konsulatsverfassung geben, bevor Kapitel 4 auf das in der Forschung viel diskutierte Problem der Konsulartribunen eingeht. Wann und aus welchen Gründen erschienen sie und was hatten sie für Kompetenzen? Waren sie ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Konsulatsverfassung oder setzten sie eine schon bestehende durch ihr Aufkommen eher außer Kraft? Zuletzt werden die leges Liciniae Sextiae behandelt. Geklärt werden soll, welche Bedeutung sie sowohl für die Konsulatsverfassung als auch für die Stellung der Plebejer gegenüber den Patriziern hatten. Zusätzlich zu der verwandten Literatur hätte noch mehr ausgewählt werden können. Jedoch gehen meiner Meinung nach hauptsächlich die hier verarbeiteten Veröffentlichungen auf das Kernthema dieser Hausarbeit ein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das oberste Amt am Beginn der Republik
- Die Quellen
- Titus Livius und Dionys von Halikarnaß als Geschichtsschreiber
- Forschungsmeinungen zum obersten Amt am Beginn der Republik
- Die Zwölftafelgesetze und der praetor
- Die Konsulartribune
- Das Erscheinen der Konsulartribune
- Ansichten der Forschung über die Konsulartribune
- Die leges Liciniae Sextiae des Jahres 367 v. Chr.
- Die antike Überlieferung
- Die leges Liciniae Sextiae in der Forschung
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Entstehung der Konsulatsverfassung in der römischen Republik. Sie untersucht die Regierungsform nach der Vertreibung des letzten etruskischen Königs, Tarquinius Superbus, bis zur Verabschiedung der leges Liciniae Sextiae im Jahr 367 v. Chr. Die Arbeit analysiert die antiken Quellen, insbesondere Titus Livius und Dionys von Halikarnaß, und setzt sie in den Kontext der Forschungsmeinungen zum obersten Amt am Beginn der Republik.
- Das oberste Amt am Beginn der Republik
- Die Zwölftafelgesetze und ihre Bedeutung für die Entwicklung der Verfassung
- Die Rolle der Konsulartribune und ihre Auswirkungen auf die Machtverhältnisse
- Die leges Liciniae Sextiae und ihre Folgen für die Stellung der Plebejer
- Die Entwicklung der Konsulatsverfassung im Kontext der römischen Frühgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Das Kapitel stellt die Thematik der Hausarbeit vor und definiert die Konsulatsverfassung. Es benennt die wichtigsten Quellen und die Zeitspanne, die in der Arbeit behandelt wird.
- Das oberste Amt am Beginn der Republik: Dieses Kapitel analysiert die antiken Quellen, insbesondere Titus Livius und Dionys von Halikarnaß, um die Situation des römischen Oberamtes nach der Abschaffung der Monarchie zu beleuchten. Es werden verschiedene Forschungsmeinungen zu dieser Zeitspanne vorgestellt.
- Die Zwölftafelgesetze und der praetor: Dieses Kapitel untersucht, inwieweit die Zwölftafelgesetze des Jahres 451 v. Chr. Informationen zur Entstehung der Konsulatsverfassung liefern. Es wird die Rolle des praetors im Kontext dieser Gesetze betrachtet.
- Die Konsulartribune: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung und die Rolle der Konsulartribune. Es werden die verschiedenen Forschungsmeinungen zu den Kompetenzen und der Bedeutung der Konsulartribune für die Konsulatsverfassung diskutiert.
- Die leges Liciniae Sextiae des Jahres 367 v. Chr.: Dieses Kapitel analysiert die Bedeutung der leges Liciniae Sextiae sowohl für die Konsulatsverfassung als auch für die Stellung der Plebejer gegenüber den Patriziern.
Schlüsselwörter
Römische Republik, Konsulatsverfassung, Oberstes Amt, Titus Livius, Dionys von Halikarnaß, Zwölftafelgesetze, Konsulartribune, leges Liciniae Sextiae, Plebejer, Patrizier, Kollegialität, Annuität, Interzession, Frühgeschichte.
- Citar trabajo
- Joachim von Meien (Autor), 2004, Die Entstehung der Konsulatsverfassung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33641