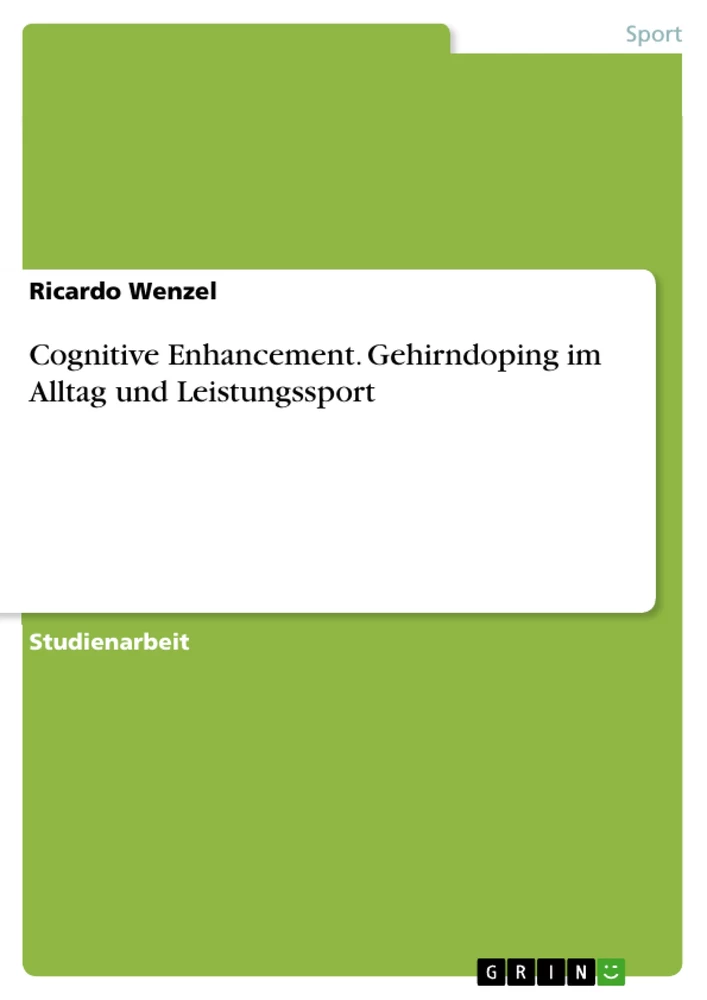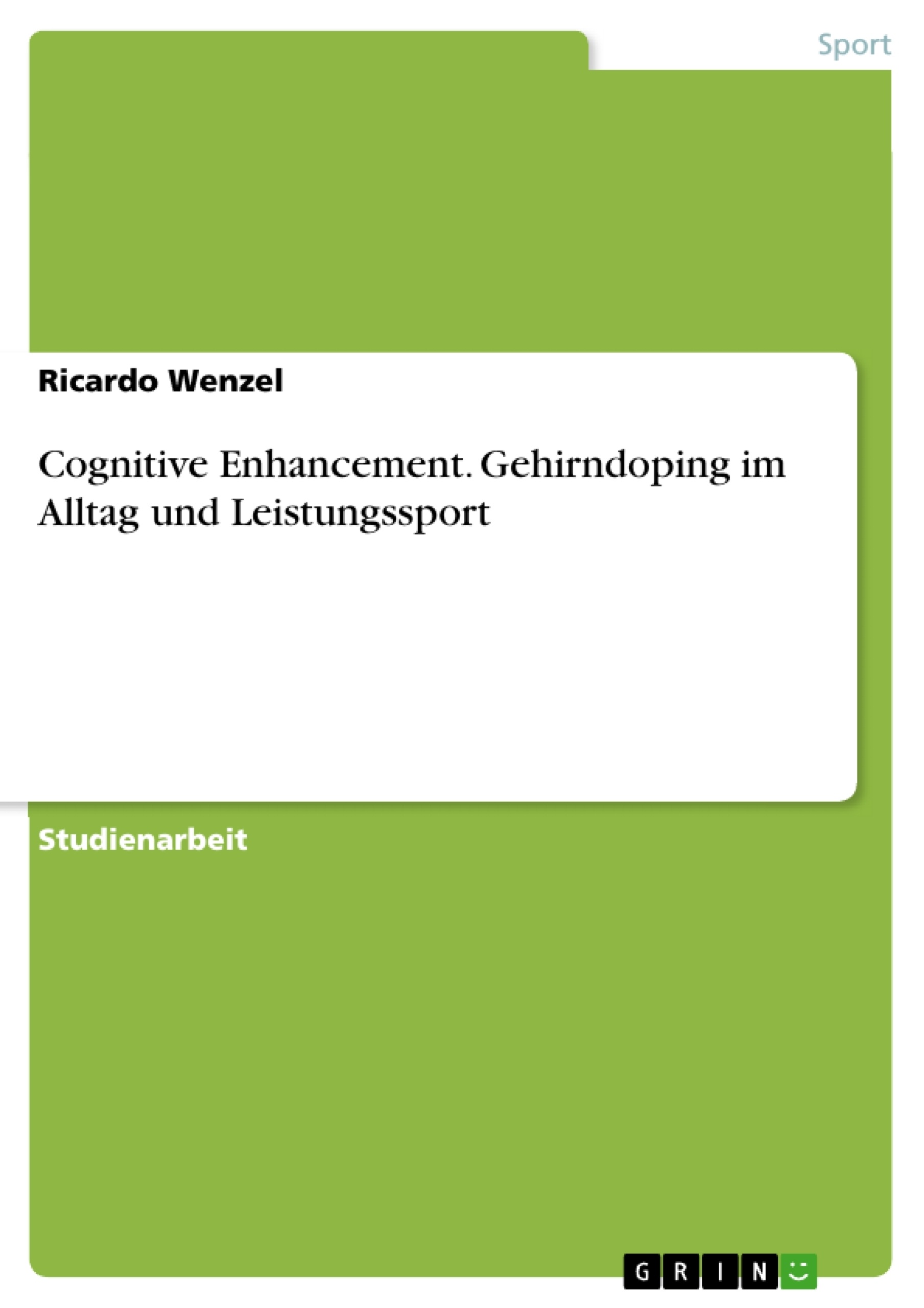Ein Bericht der Deutschen Angestellten-Krankenkasse (DAK) aus 2015 mit dem Schwerpunktthema „Doping am Arbeitsplatz“ schätzte, dass rund jeder Achte (12,1%) der etwa 5.000 befragten Erwerbstätigen, Mittel zur Erhöhung ihrer kognitiven Kapazitäten oder zur Verbesserung des psychischen Wohlbefindens, ohne medizinische Notwendigkeit eingenommen hat. Doch ist so ein Vorgehen überhaupt notwendig, um sein neurologisches Potenzial zu verbessern oder gibt es alternative Wege die gewünschten Effekte sowohl im Sport, als auch in anderen relevanten Lebensbereichen zu erzielen? In meiner Arbeit werde ich der Frage auf den Grund gehen und die Chancen, sowie Risiken untersuchen, um schlussendlich ein Fazit zu ziehen.
Citius, altius, fortius oder zu Deutsch: Schneller, höher, stärker. Das ist das Motto der Olympischen Spiele. Der Trend geht dazu, immer mehr zu leisten, alles schneller zu erledigen, ständig erreichbar zu sein und höhere Gewinne zu erzielen, um immer besser zu sein, als die Konkurrenz. Schon lang ist das nicht mehr nur allein im Sport der Fall, sondern vor allem in der Wirtschaft, sowie dem Arbeits- bzw. akademischem Umfeld. Unsere moderne Leistungsgesellschaft hat das einst bei den Olympischen Spielen gebildete Credo für sich übernommen, um daraus einen erbitterten Wettkampf weit über den eigentlich dafür vorgesehenen Rahmen hinaus zu machen. Wenig überraschend ist die daraus resultierende Überforderung vieler Menschen. Sie ist es schlussendlich, die den Weg für den Wunsch nach Möglichkeiten zur Leistungssteigerung ebnet, wie man es eben bisher nur aus dem Sport kannte.
Konsterniert, frustriert und sprachlos. Das sind auf der anderen Seite für gewöhnlich die Reaktionen auf desillusionierende Nachrichten über Doping in immer mehr Gebieten des Leistungssports. Langsam aber sicher zeichnet sich dabei ein Gewöhnungseffekt ab. Die Gesellschaft beginnt Vorkommnisse wie diese resignierend hinzunehmen. Man wird sich darüber im Klaren, dass der körperlichen Trainierbarkeit Grenzen gesetzt sind, die man nur noch durch Doping in seinen zahlreichen Facetten, zu überschreiten in der Lage ist. Gerade jene sich breitmachende Akzeptanz ist allerdings zugleich der sprichwörtliche „Fuß in der Tür“, für die Rechtfertigung derlei Maßnahmen in Bereichen fernab sportlicher Rivalität.
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG
- 2 BEGRIFFSBESTIMMUNG COGNITIVE ENHANCEMENT
- 2.1 Wer nutzt Cognitive Enhancement im Alltag und was sind ihre Motive?
- 2.2 Was sind die Motive für den Wunsch nach Leistungssteigerung im Sport?
- 2.3 Das Wirkungsprofil der gängigsten Substanzen
- 2.4 Ihre Nebenwirkungen
- 3 DER MISSBRAUCH VON METHYLPHENIDAT UND MODAFINIL
- 3.1 Ist der zweckwidrige Gebrauch im Alltag erfolgversprechend?
- 3.2 Methylphenidat und Modafinil als Dopingmittel im Sport
- 4 ALTERNATIVEN ZUM PHARMAZEUTISCHEN ENHANCEMENT
- 4.1 Körperliche Aktivität zur Förderung der kognitiven Fähigkeiten
- 4.2 Sports Vision Training im Leistungssport
- 5 NUTZEN UND RISIKEN VON COGNITIVE ENHANCEMENT - EIN FAZIT
- 6 LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Einsatz von Cognitive Enhancement (CE), insbesondere im Hinblick auf den pharmakologischen Ansatz und seine Alternativen. Die Arbeit beleuchtet die Motive für den Wunsch nach Leistungssteigerung im Alltag und im Sport, analysiert den Missbrauch bestimmter Substanzen und diskutiert die potenziellen Nutzen und Risiken von CE.
- Motive für den Gebrauch von Cognitive Enhancern im Alltag und im Sport
- Wirkungsprofil und Nebenwirkungen von gängigen Substanzen
- Missbrauch von Methylphenidat und Modafinil
- Alternativen zum pharmakologischen Enhancement
- Bewertung der Chancen und Risiken von CE
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontext des Themas Cognitive Enhancement dar. Sie beschreibt den gesellschaftlichen Druck nach immer höherer Leistung, der sowohl im Sport als auch im beruflichen und akademischen Umfeld spürbar ist. Die zunehmende Akzeptanz von Doping im Sport wird als ein Indikator für die Ausweitung solcher Praktiken in andere Lebensbereiche gewertet. Die Arbeit fokussiert auf die Untersuchung der Möglichkeiten und Risiken von CE, sowohl im Hinblick auf pharmakologische als auch auf nicht-pharmakologische Ansätze.
2 Begriffsbestimmung Cognitive Enhancement: Dieses Kapitel definiert den Begriff Cognitive Enhancement (CE) und seine verschiedenen Bezeichnungen, wie Neuro-Enhancement oder Gehirn-Doping. Es differenziert zwischen dem ursprünglichen medizinischen Einsatz von Substanzen zur Behandlung neurokognitiver Störungen und deren zweckentfremdetem Gebrauch zur Leistungssteigerung bei Gesunden. Der Fokus der Arbeit auf den pharmakologischen Ansatz wird begründet.
2.1 Wer nutzt Cognitive Enhancement im Alltag und was sind ihre Motive?: Dieses Kapitel untersucht die Motive hinter dem Konsum von Cognitive Enhancern. Es beleuchtet historische Beispiele wie den Gebrauch von Amphetamin im Zweiten Weltkrieg und den aktuellen Konsum von Koffein. Der zunehmende Gebrauch von nicht-indizierten Medikamenten seit den 1980er Jahren wird thematisiert, sowie der Einfluss elterlicher Erwartungen auf den Gebrauch von CE bei Kindern, im Kontext von Leistungsdruck in Schule und Gesellschaft.
3 Der Missbrauch von Methylphenidat und Modafinil: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Missbrauch von Methylphenidat und Modafinil, zwei Substanzen, die oft im Kontext von CE verwendet werden. Es wird der zweckwidrige Gebrauch im Alltag und deren Verwendung als Dopingmittel im Sport analysiert. Die Auswirkungen dieses Missbrauchs werden diskutiert, unter Berücksichtigung von ethischen und gesellschaftlichen Aspekten.
4 Alternativen zum pharmazeutischen Enhancement: Dieses Kapitel präsentiert Alternativen zum pharmakologischen CE. Es werden körperliche Aktivität und Sports Vision Training als Methoden zur Förderung kognitiver Fähigkeiten vorgestellt und im Detail erläutert. Die Wirksamkeit und die Vorteile dieser nicht-pharmakologischen Ansätze werden im Vergleich zum pharmakologischen Ansatz diskutiert.
Schlüsselwörter
Cognitive Enhancement, Gehirn-Doping, Methylphenidat, Modafinil, Leistungssteigerung, Neuro-Enhancement, Sport, Alltag, Alternativen, Risiken, Nutzen, kognitive Fähigkeiten, Leistungsdruck, pharmakologisches Enhancement, nicht-pharmakologisches Enhancement.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Cognitive Enhancement: Pharmakologischer und nicht-pharmakologischer Ansatz"
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den Einsatz von Cognitive Enhancement (CE), insbesondere den pharmakologischen Ansatz und seine Alternativen. Sie beleuchtet die Motive für den Wunsch nach Leistungssteigerung im Alltag und im Sport, analysiert den Missbrauch bestimmter Substanzen und diskutiert die potenziellen Nutzen und Risiken von CE.
Welche Substanzen werden im Zusammenhang mit Cognitive Enhancement genauer betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich insbesondere auf den Missbrauch von Methylphenidat und Modafinil, zwei Substanzen, die oft zweckentfremdet zur Leistungssteigerung eingesetzt werden. Es wird deren Gebrauch im Alltag und als Dopingmittel im Sport analysiert.
Welche Motive für den Gebrauch von Cognitive Enhancern werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die Motive für den Konsum von Cognitive Enhancern sowohl im Alltag als auch im Sport. Sie beleuchtet historische Beispiele und den Einfluss von Leistungsdruck in Schule, Beruf und Gesellschaft, sowie den Einfluss elterlicher Erwartungen.
Welche Alternativen zum pharmakologischen Cognitive Enhancement werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert körperliche Aktivität und Sports Vision Training als nicht-pharmakologische Alternativen zur Steigerung kognitiver Fähigkeiten. Die Wirksamkeit und Vorteile dieser Ansätze werden im Vergleich zum pharmakologischen Ansatz diskutiert.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Begriffsbestimmung Cognitive Enhancement (inkl. Motive im Alltag und Sport, Wirkungsprofil und Nebenwirkungen gängiger Substanzen), Der Missbrauch von Methylphenidat und Modafinil, Alternativen zum pharmazeutischen Enhancement, Nutzen und Risiken von Cognitive Enhancement - Ein Fazit, Literaturverzeichnis.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Cognitive Enhancement, Gehirn-Doping, Methylphenidat, Modafinil, Leistungssteigerung, Neuro-Enhancement, Sport, Alltag, Alternativen, Risiken, Nutzen, kognitive Fähigkeiten, Leistungsdruck, pharmakologisches Enhancement, nicht-pharmakologisches Enhancement.
Wie wird der Begriff "Cognitive Enhancement" definiert?
Die Arbeit definiert Cognitive Enhancement (CE) und seine verschiedenen Bezeichnungen. Sie differenziert zwischen dem medizinischen Einsatz zur Behandlung neurokognitiver Störungen und dem zweckentfremdeten Gebrauch zur Leistungssteigerung bei Gesunden. Der Fokus liegt auf dem pharmakologischen Ansatz.
Welche gesellschaftlichen Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit thematisiert den gesellschaftlichen Druck nach immer höherer Leistung, die zunehmende Akzeptanz von Doping und die ethischen und gesellschaftlichen Aspekte des Missbrauchs von Cognitive Enhancern.
- Quote paper
- Ricardo Wenzel (Author), 2016, Cognitive Enhancement. Gehirndoping im Alltag und Leistungssport, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/336349