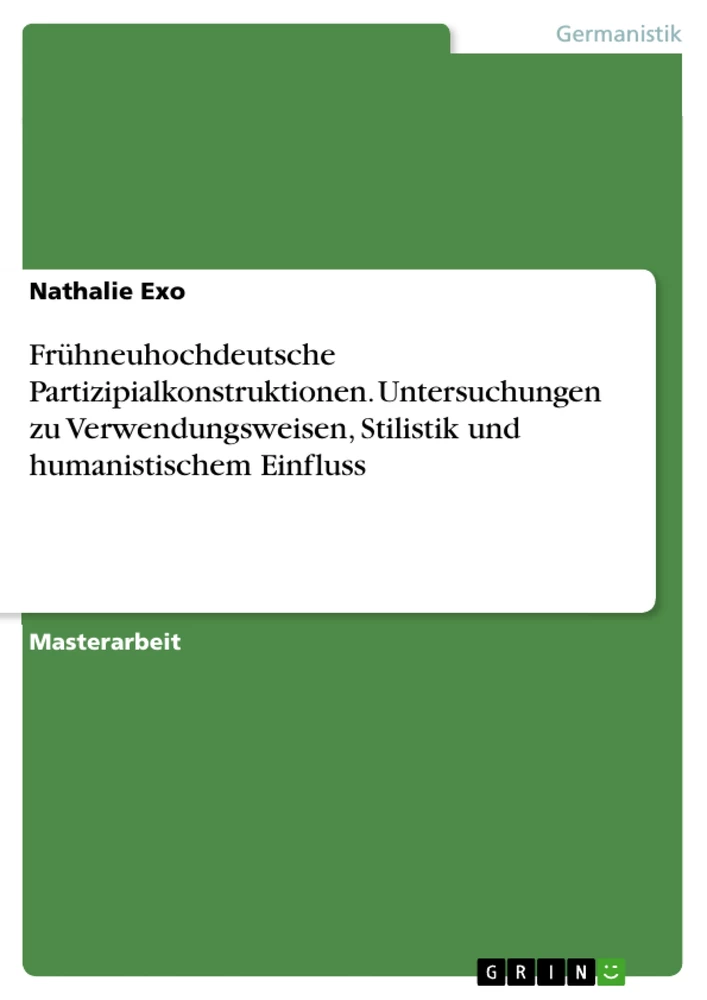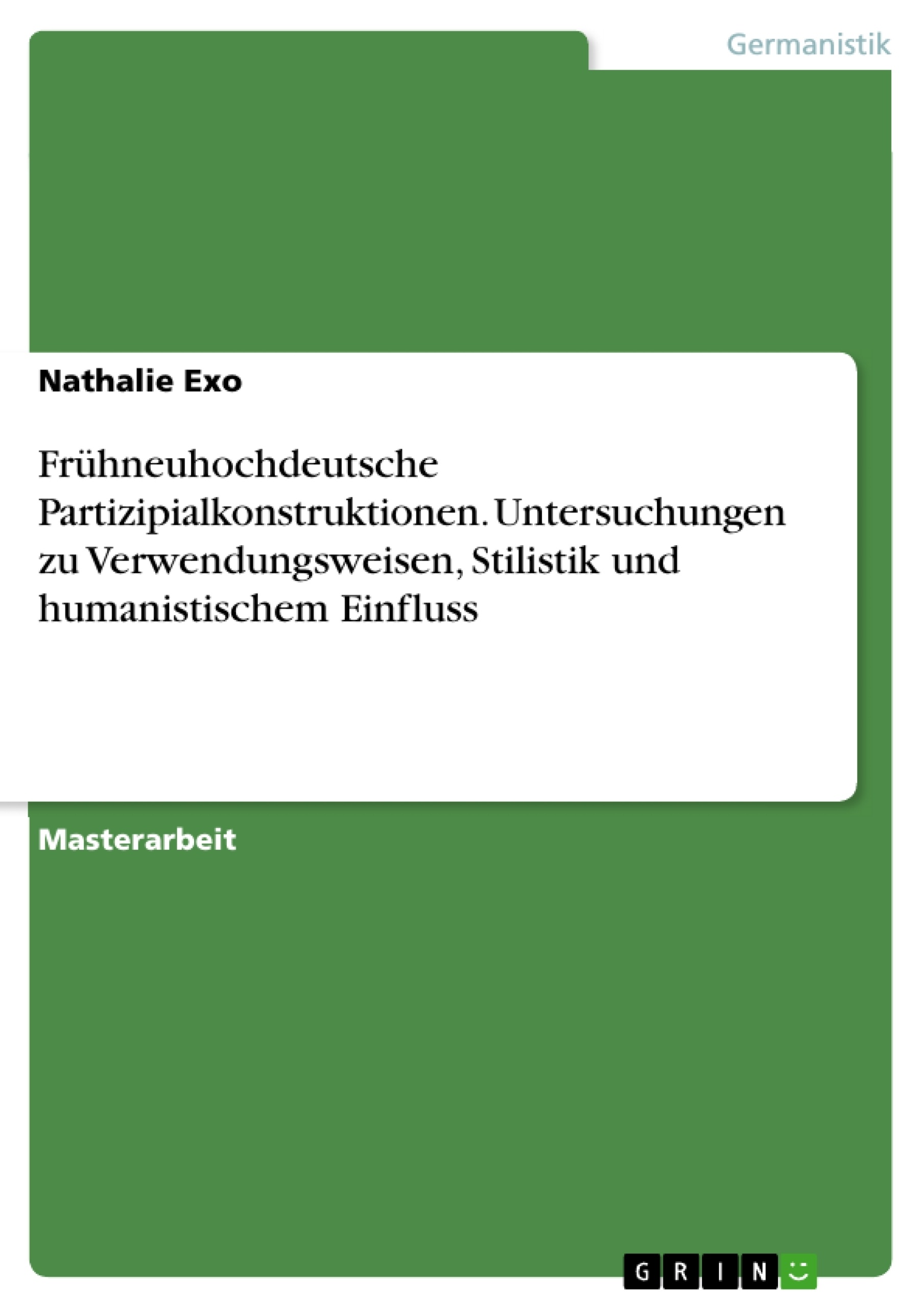Die Arbeit beschäftigt sich mit einem kleinen Ausschnitt des Einflusses, den das Lateinische auf die Syntax des Frühneuhochdeutschen gehabt hat. Bislang wurde kaum untersucht, wie es sich mit den Partizipialkonstruktionen der Zeit verhält – Konstruktionen, deren lateinische Entsprechungen teilweise im Deutschen eben nicht ohne Weiteres nachzuahmen sind.
Untersuchungen gab es bereits zum Einfluss auf erweiterte Partizipialattribute, doch wurde bislang wenig zu prädikativen oder adverbialen Partizipien im Frühneuhochdeutschen gesagt. Da der Einfluss des Lateinischen andererseits lange Zeit überschätzt wurde, soll eine Korpusuntersuchung zeigen, ob dieser sich bei den Partizipien konkret an Textbeispielen (qualitativ wie quantitativ) festmachen lässt.
Falls es einen Einfluss gibt, so ist auch zu überlegen, ob dieser nachhaltig ist oder sich zunehmend wieder abbaut, denn Syntax ist ein Teilsystem der Sprache, das gegen äußere Einflüsse in der Regel außerordentlich stabil ist.
Die zentralen Fragen dieser Arbeit sind demnach: Hat das Lateinische die Partizipialkonstruktionen des Humanismus beeinflusst? Wenn ja, nur die Konstruktionen an sich, oder aber eher auch Stilistik und Verwendungsweisen? Hat sich der Einfluss langfristig durchgesetzt? Mit Hilfe dieser Fragen wird die zentrale These („Die lateinische Sprache hat, über humanistisch gebildete Autoren, einen Einfluss auf Verwendungsweisen und Stilistik frühneuhochdeutscher Partizipialkonstruktionen gehabt“) auf ihre Anwendbarkeit überprüft.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen
- 2.1 Sprachgeschichte
- 2.1.1 Frühneuhochdeutsch
- 2.1.2 Der Humanismus
- 2.2 Grammatik
- 2.2.1 Das Partizip im Lateinischen
- 2.2.2 Das Partizip im Frühneuhochdeutschen
- 2.3 Korpus
- 2.1 Sprachgeschichte
- 3. Korpusuntersuchung
- 3.1 Attributive Verwendung
- 3.1.1 Bestand
- 3.1.2 Diskussion
- 3.1.3 Exkurs I: Nachfeldbesetzung
- 3.2 Prädikative Verwendung
- 3.2.1 Periphrastische Verwendung
- 3.2.1.1 Bestand
- 3.2.1.2 Diskussion
- 3.2.1.3 Exkurs II: Der frühneuhochdeutsche Auxiliary Drop
- 3.2.2 Prädikative Verwendung im engeren Sinn
- 3.2.2.1 Bestand
- 3.2.2.2 Diskussion
- 3.2.1 Periphrastische Verwendung
- 3.3 Adverbiale Verwendung
- 3.3.1 Bestand
- 3.3.2 Diskussion
- 3.4 Absolute Verwendung
- 3.4.1 Bestand
- 3.4.2 Diskussion
- 3.1 Attributive Verwendung
- 4. Vergleichende Überlegungen
- 5. Fazit
- 5.1 Schlussfolgerungen
- 5.2 Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss des Lateinischen auf die Verwendung und Stilistik frühneuhochdeutscher Partizipialkonstruktionen. Sie konzentriert sich auf die Frage, ob und inwieweit humanistisch gebildete Autoren lateinische grammatische Strukturen und Stilmittel in ihren deutschen Texten adaptiert haben. Die Untersuchung analysiert, ob dieser Einfluss sich auf verschiedene Verwendungsweisen der Partizipien (attributiv, prädikativ, adverbial, absolut) erstreckt und ob er sich nachhaltig durchgesetzt hat.
- Der Einfluss des Humanismus auf die deutsche Sprachentwicklung
- Vergleichende Analyse lateinischer und frühneuhochdeutscher Partizipialkonstruktionen
- Quantitative und qualitative Untersuchung der Partizipverwendung in einem Korpus frühneuhochdeutscher Texte
- Analyse des Stilistischen Einflusses des Lateinischen
- Bewertung der Langzeitwirkung des lateinischen Einflusses auf die Syntax
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss des Lateinischen auf frühneuhochdeutsche Partizipialkonstruktionen vor und skizziert den Forschungsstand und die Methodik der Arbeit. Sie begründet die Relevanz der Untersuchung durch die bisherige Forschungslücke in Bezug auf prädikative und adverbiale Partizipien und stellt die zentrale These auf, dass die lateinische Sprache über humanistisch gebildete Autoren einen Einfluss auf die Verwendungsweisen und Stilistik frühneuhochdeutscher Partizipialkonstruktionen hatte. Die Arbeit setzt sich zum Ziel, diese These mithilfe einer Korpusuntersuchung zu überprüfen.
2. Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es beschreibt die Sprachperiode des Frühneuhochdeutschen, die Charakteristika des Humanismus und die grammatischen Besonderheiten von Partizipien im Lateinischen und Frühneuhochdeutschen. Der Fokus liegt auf den Unterschieden zwischen beiden Sprachen und wie diese Unterschiede die Übernahme von Strukturen beeinflussen könnten. Die Auswahl des Korpus und die Methode der Analyse werden ebenfalls erläutert.
3. Korpusuntersuchung: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Korpusuntersuchung. Die Analyse der Partizipien im Korpus wird nach verschiedenen Verwendungsweisen (attributiv, prädikativ, adverbial, absolut) unterteilt und sowohl quantitativ als auch qualitativ ausgewertet. Einzelne Belege und Beleggruppen werden diskutiert, um den Einfluss des Lateinischen auf die jeweilige Verwendungsweise zu belegen oder auszuschließen. Zwei Exkurse befassen sich mit zusätzlichen grammatischen Besonderheiten der Zeit.
4. Vergleichende Überlegungen: Dieses Kapitel vergleicht die Ergebnisse der Korpusuntersuchung von Texten humanistisch gebildeter Autoren mit denen von Autoren ohne humanistischen Hintergrund. Es wird untersucht, ob sich signifikante Unterschiede in der Verwendung und Stilistik von Partizipialkonstruktionen zeigen lassen, um den Einfluss des Humanismus zu belegen oder zu widerlegen.
Schlüsselwörter
Frühneuhochdeutsch, Partizipialkonstruktionen, Humanismus, Lateinischer Einfluss, Syntax, Stilistik, Korpuslinguistik, Grammatik, Attributiv, Prädikativ, Adverbial, Absolut, Korpusuntersuchung, Bonner Frühneuhochdeutschkorpus (BFK).
Häufig gestellte Fragen zum Einfluss des Lateinischen auf frühneuhochdeutsche Partizipialkonstruktionen
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss des Lateinischen auf die Verwendung und Stilistik frühneuhochdeutscher Partizipialkonstruktionen. Der Fokus liegt auf der Frage, ob und inwieweit humanistisch gebildete Autoren lateinische grammatische Strukturen und Stilmittel in ihren deutschen Texten adaptiert haben.
Welche Aspekte der Partizipien werden untersucht?
Die Untersuchung analysiert verschiedene Verwendungsweisen der Partizipien: attributiv, prädikativ, adverbial und absolut. Es wird sowohl die quantitative als auch die qualitative Verwendung untersucht, um den lateinischen Einfluss zu belegen oder auszuschließen.
Welche Methode wird verwendet?
Die Arbeit verwendet eine Korpusuntersuchung, um die Verwendung von Partizipien in frühneuhochdeutschen Texten zu analysieren. Der Korpus umfasst Texte von Autoren mit und ohne humanistischem Hintergrund, um einen Vergleich zu ermöglichen. Die Analyse umfasst quantitative und qualitative Auswertungen.
Welche Rolle spielt der Humanismus in dieser Arbeit?
Der Humanismus spielt eine zentrale Rolle, da er als potenzielle Quelle des lateinischen Einflusses auf die deutsche Sprache betrachtet wird. Die Arbeit untersucht, ob humanistisch gebildete Autoren anders mit Partizipien umgehen als Autoren ohne humanistischen Hintergrund.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Grundlagen (Sprachgeschichte, Grammatik, Korpusbeschreibung), Korpusuntersuchung (mit Unterkapiteln zu den verschiedenen Verwendungsweisen der Partizipien), Vergleichende Überlegungen und Fazit (Schlussfolgerungen und Reflexion).
Was sind die zentralen Forschungsfragen?
Die zentrale Forschungsfrage ist, ob und inwieweit der Humanismus und die lateinische Sprache die Verwendung und Stilistik frühneuhochdeutscher Partizipialkonstruktionen beeinflusst haben. Zusätzliche Fragen untersuchen den Umfang dieses Einflusses auf verschiedene Verwendungsweisen der Partizipien und dessen nachhaltige Wirkung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Frühneuhochdeutsch, Partizipialkonstruktionen, Humanismus, Lateinischer Einfluss, Syntax, Stilistik, Korpuslinguistik, Grammatik, Attributiv, Prädikativ, Adverbial, Absolut, Korpusuntersuchung, Bonner Frühneuhochdeutschkorpus (BFK).
Welche konkreten Beispiele werden analysiert?
Die Arbeit analysiert konkrete Belege und Beleggruppen aus dem Korpus, um den lateinischen Einfluss auf die jeweilige Verwendungsweise der Partizipien zu belegen oder auszuschließen. Einzelheiten werden im Kapitel "Korpusuntersuchung" dargestellt.
Wie werden die Ergebnisse präsentiert?
Die Ergebnisse der Korpusuntersuchung werden sowohl quantitativ als auch qualitativ präsentiert. Quantitative Daten zeigen die Häufigkeit verschiedener Verwendungsweisen, während qualitative Analysen die stilistischen Aspekte und den Einfluss des Lateinischen beleuchten.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit werden im letzten Kapitel präsentiert und fassen die Ergebnisse der Korpusuntersuchung und der vergleichenden Analyse zusammen. Sie bewerten den Umfang und die Langzeitwirkung des lateinischen Einflusses auf die Syntax frühneuhochdeutscher Partizipialkonstruktionen.
- Quote paper
- Nathalie Exo (Author), 2012, Frühneuhochdeutsche Partizipialkonstruktionen. Untersuchungen zu Verwendungsweisen, Stilistik und humanistischem Einfluss, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/335993