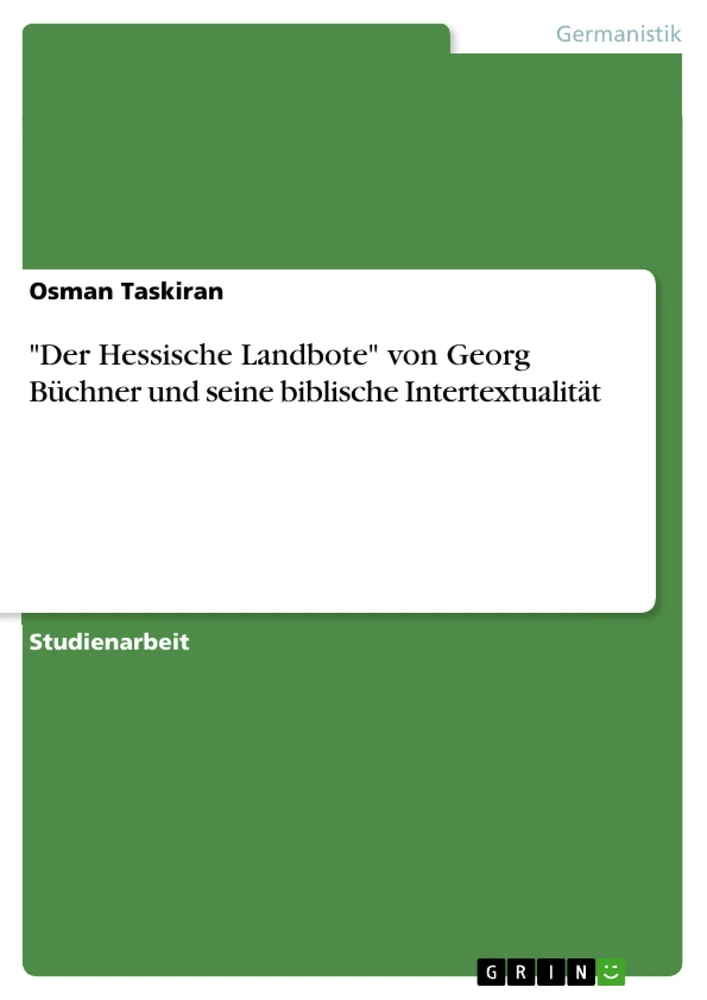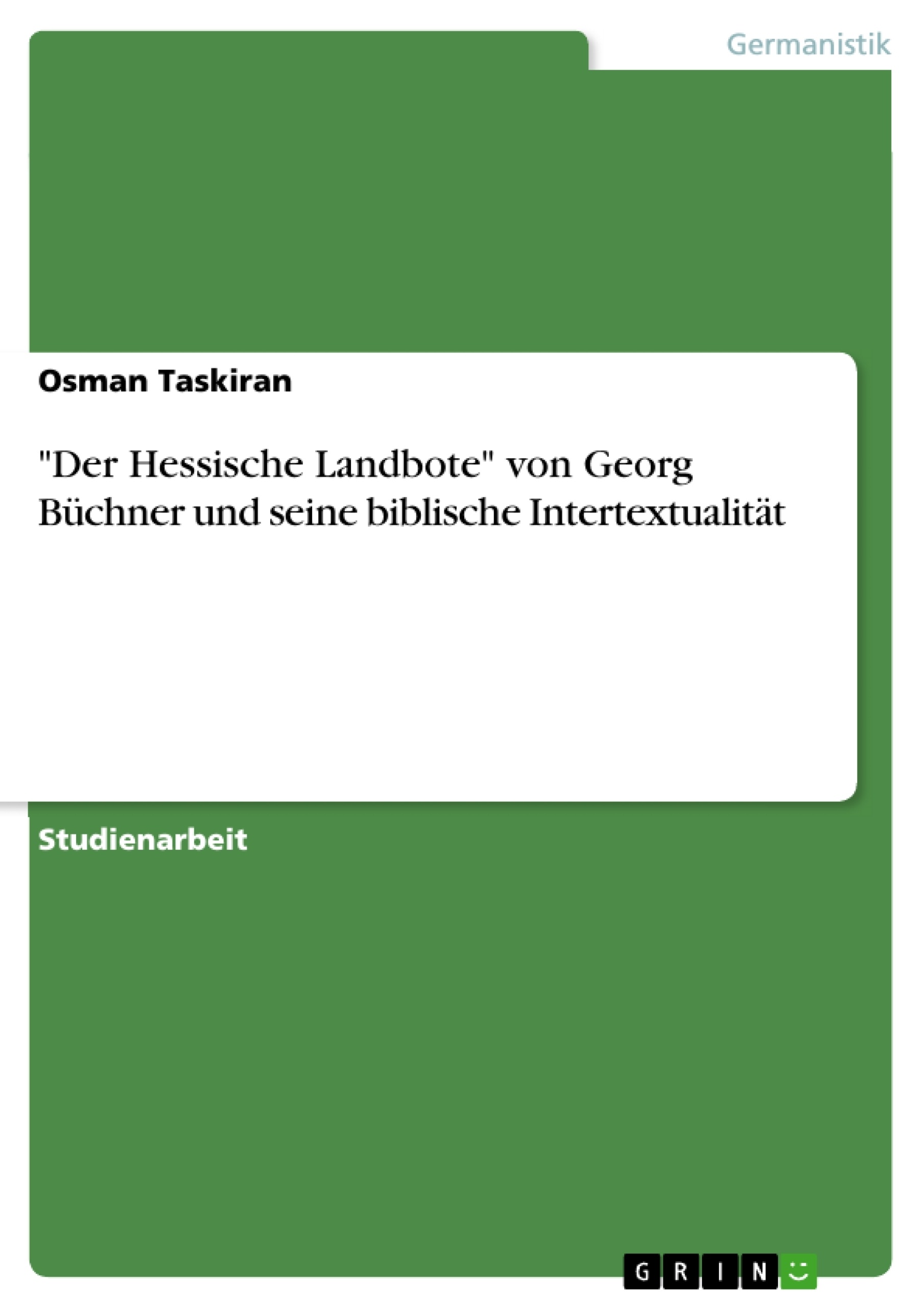Die folgende Arbeit soll versuchen darzustellen, inwieweit und in welcher Form es biblische Intertextualität in der Flugschrift „Der Hessische Landbote“ gibt. Dabei wird auch kurz auf die Entstehung eingegangen, der Bezug Georg Büchners zur Religion mithilfe seiner Werke erörtert und anschließend „Der Hessische Landbote“ (HL) im Speziellen betrachtet. Dabei werden die Arten der Bibelzitate beziehungsweise -vergleiche untersucht und die Gründe hierfür analysiert.
Georg Büchner ist bekanntlich in seinem dreiundzwanzigsten Lebensjahr verstorben und war nicht nur Schriftsteller; sondern gleichermaßen sowohl Naturwissenschaftler als auch Revolutionär, wie es am HL auch zu sehen ist. Es wäre vielleicht sogar nicht zu vermessen von einer „Dreifaltigkeit“ zu sprechen, würde man bei der biblischen Sprache bleiben wollen. Es ist nämlich kein Geheimnis, dass das literarische Werk von nur drei Jahren - und das in wirklich jungem Alter - die Arbeit viele seiner Kollegen überragt.
Der Grund hierfür liegt sicherlich zum Teil eben an der Tatsache, dass Büchner jene Elemente in seine Arbeiten mit einwebt. Vergleichte man ihn zum Beispiel mit Goethe, stieße man auf die Tatsache, dass jener im Alter von dreiundzwanzig Jahren „lediglich einige Gedichte, den kleinen Aufsatz 'Von deutscher Baukunst' und das Drama 'Götz von Berlichingen' gedruckt hinterlassen“88 hat. Nicht umsonst trägt der bedeutendste Literaturpreis in Deutschland seinen Namen. Er ist international bekannt, seine Stücke werden auf der ganzen Welt gespielt und auch viele ausländische Dissertationen behandeln oft ihn und sein Werk.
Nun stellt sich die Frage, womit gerade Büchner es schafft so viele zu begeistern. Auf den HL beschränkt gibt es hierbei einige Punkte, die diesem Ziel dienen. Zum einen ist es die Tatsache, dass er neben der Finanzstatistik, die Bibel als Hauptquelle für seine Metaphern und seine Wortwahl benutzt. Die ganze Flugschrift hat von Anfang bis Ende den Beigeschmack einer Predigt. Wiederholungen werden sehr oft benutzt, biblische Geschehnisse gemäß Büchners Zeit ausgelegt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. „Der Hessische Landbote“ und seine biblische Intertextualität
- 2.1 Die Zusammenarbeit Büchners mit Friedrich Ludwig Weidig
- 2.2 Büchners Bezug zum Christentum
- 2.3 Gründe für die biblischen Einflüsse in „Der hessische Landbote“
- 2.4 Biblische Intertextualität und ein Versuch einer Analyse
- 2.5 Direkte Zitate aus der Bibel
- 3. Schluss
- 4. Literaturverzeichnis
- 4.1 Primärliteratur
- 4.2 Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die biblische Intertextualität in Georg Büchners Flugschrift „Der Hessische Landbote“. Die Zielsetzung besteht darin, das Ausmaß und die Form dieser Intertextualität aufzuzeigen und die Gründe dafür zu analysieren. Dabei wird die Entstehung der Flugschrift beleuchtet, Büchners Verhältnis zum Christentum erörtert und die Verwendung biblischer Zitate und Vergleiche im „Hessischen Landboten“ untersucht.
- Zusammenarbeit Büchner/Weidig an „Der Hessische Landbote“
- Büchners religiöse Einstellung und ihr Einfluss auf das Werk
- Die Funktion biblischer Intertextualität in der Flugschrift
- Analyse der Arten und Gründe für die Verwendung biblischer Zitate
- Der „Hessische Landbote“ im Kontext des frühen 19. Jahrhunderts
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext des frühen 19. Jahrhunderts in Hessen, geprägt von Analphabetismus und Religiosität der Bevölkerung. Sie führt in die Thematik der Hausarbeit ein, die die biblische Intertextualität in Büchners „Hessischen Landboten“ untersucht. Die Arbeit wird die Entstehung des „Landboten“, Büchners Bezug zum Christentum und die Analyse der biblischen Intertextualität behandeln. Die Einleitung betont die Bedeutung des Werkes und die Relevanz der Forschung zu Büchner.
2. „Der Hessische Landbote“ und seine biblische Intertextualität: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entstehung und Autorschaft des „Hessischen Landboten“, der in seiner Schlussfassung aus der Zusammenarbeit von Georg Büchner und Friedrich Ludwig Weidig hervorgegangen ist. Es werden die Schwierigkeiten der Zuschreibung einzelner Textteile an die jeweiligen Autoren diskutiert, wobei Zeugenaussagen und philologische Analysen herangezogen werden. Das Kapitel geht der Frage nach, warum der Text stark von biblischer Intertextualität geprägt ist. Die Debatte um die jeweiligen Anteile von Büchner und Weidig an der biblischen Intertextualität wird ausführlich dargestellt. Die verschiedenen Interpretationen und Meinungen von Forschern wie Ariane Martin und Gerhard Schaub werden berücksichtigt. Die Rolle der Religion als Mittel zur Mobilisierung der niederen Volksklassen wird thematisiert. Das Kapitel untersucht die Verflechtung zwischen dem politischen Anliegen und der religiösen Sprache.
Schlüsselwörter
Georg Büchner, Der Hessische Landbote, biblische Intertextualität, Friedrich Ludwig Weidig, Christentum, Flugschrift, Revolution, 19. Jahrhundert, religiöse Sprache, politische Lyrik, Philologie, Textanalyse.
Häufig gestellte Fragen zu „Der Hessische Landbote“ und seiner biblischen Intertextualität
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die biblische Intertextualität in Georg Büchners politischer Flugschrift „Der Hessische Landbote“. Sie analysiert das Ausmaß und die Form der biblischen Einflüsse und erforscht die Gründe für deren Verwendung.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Entstehung des „Hessischen Landboten“, untersucht Büchners Verhältnis zum Christentum und analysiert die Verwendung biblischer Zitate und Vergleiche. Sie betrachtet die Zusammenarbeit Büchners mit Friedrich Ludwig Weidig, diskutiert die Schwierigkeiten der Textzuschreibung und berücksichtigt verschiedene Interpretationen der biblischen Intertextualität durch Wissenschaftler.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel über „Der Hessische Landbote“ und seine biblische Intertextualität (mit Unterkapiteln zur Zusammenarbeit Büchner/Weidig, Büchners christlichem Bezug, den Gründen für biblische Einflüsse, einer Analyse der Intertextualität und direkten Bibelzitaten), einen Schlussteil und ein Literaturverzeichnis (mit Primär- und Sekundärliteratur).
Welche konkreten Themen werden im Hauptkapitel behandelt?
Das Hauptkapitel untersucht die Entstehung und Autorschaft des „Hessischen Landboten“, die Schwierigkeiten der Zuschreibung einzelner Textteile an Büchner und Weidig, die Gründe für die starke Prägung des Textes durch biblische Intertextualität, die Debatte um die jeweiligen Anteile der Autoren an dieser Intertextualität und die Rolle der Religion als Mittel zur Mobilisierung der Bevölkerung.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Primärliteratur (u.a. „Der Hessische Landbote“) und Sekundärliteratur, wobei die Meinungen und Interpretationen verschiedener Forscher wie Ariane Martin und Gerhard Schaub berücksichtigt werden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Georg Büchner, Der Hessische Landbote, biblische Intertextualität, Friedrich Ludwig Weidig, Christentum, Flugschrift, Revolution, 19. Jahrhundert, religiöse Sprache, politische Lyrik, Philologie, Textanalyse.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das Ausmaß und die Form der biblischen Intertextualität im „Hessischen Landboten“ aufzuzeigen und die Gründe dafür zu analysieren. Sie soll einen Beitrag zum Verständnis des Werkes und seiner Entstehung im Kontext des frühen 19. Jahrhunderts leisten.
Welche Bedeutung hat der historische Kontext?
Die Einleitung betont den historischen Kontext des frühen 19. Jahrhunderts in Hessen, geprägt von Analphabetismus und Religiosität der Bevölkerung. Dieser Kontext ist entscheidend für das Verständnis der Verwendung religiöser Sprache und biblischer Motive im „Hessischen Landboten“.
- Quote paper
- Osman Taskiran (Author), 2013, "Der Hessische Landbote" von Georg Büchner und seine biblische Intertextualität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/335755