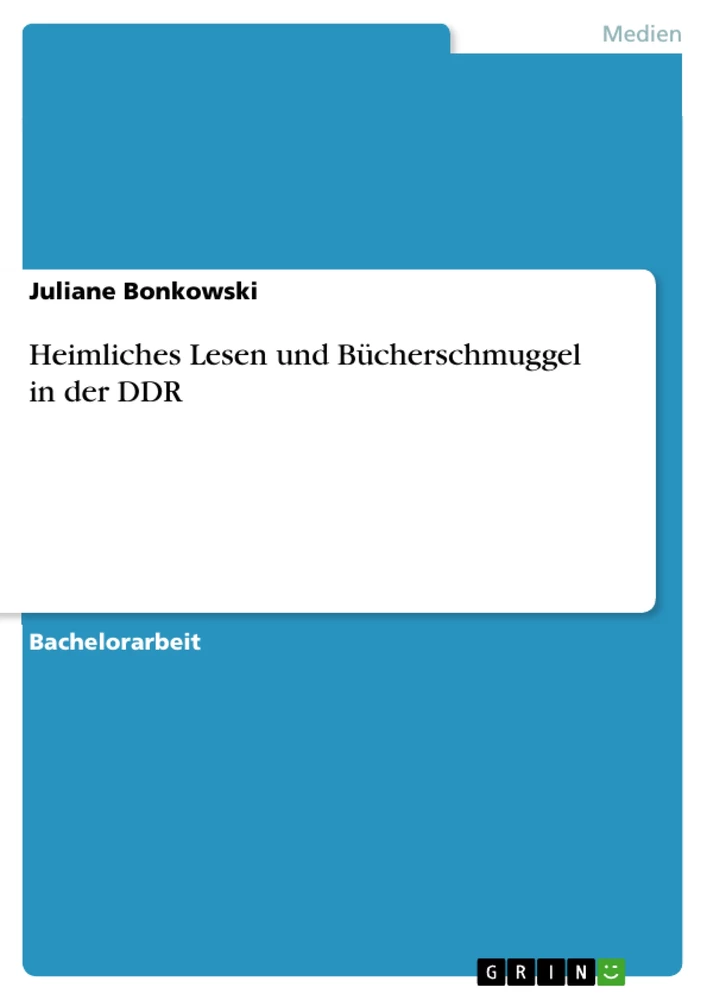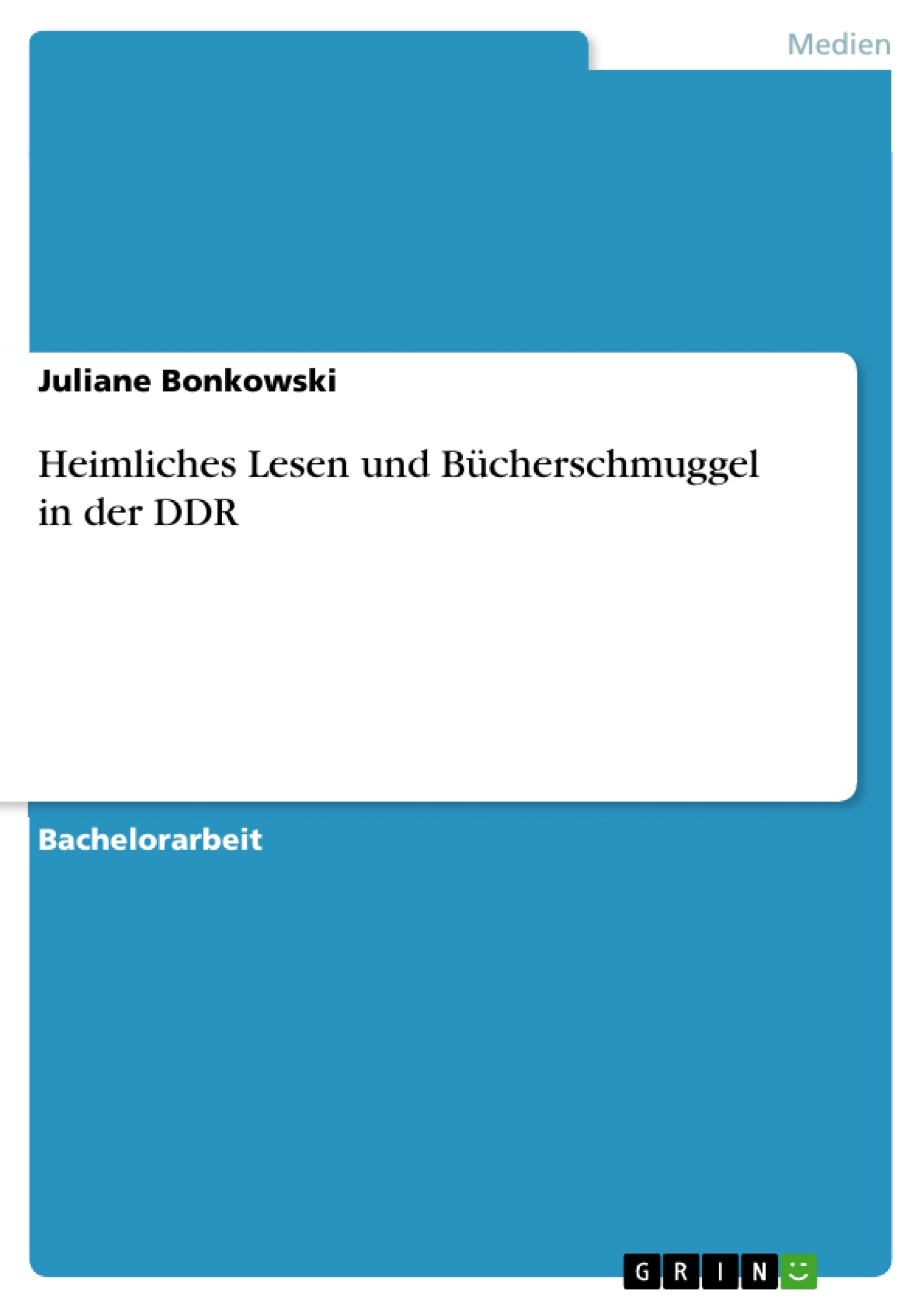In der heutigen Zeit und für unsere Generation ist es kaum mehr vorstellbar, dass es eine Zeit gab, in der den Menschen bestimmte Literatur, Zeitungen, Zeitschriften und andere Druckerzeugnisse vorenthalten wurden. Besonders die heutige Gesellschaft, die mit dem Internet und anderen Massenmedien aufwächst, kommt in den Genuss, jedes mediale Angebot überwiegend online nutzen zu können. Das bedeutet, dass wir jederzeit alle Informationen abrufen können, die wir benötigen.
Schauen wir jedoch 30 Jahre zurück, müssen wir feststellen, dass dies nicht immer selbstverständlich war. Eltern und Großeltern, die in der ehemaligen DDR gelebt haben, könnten uns diverse Geschichten darüber erzählen, welche Einschränkungen es damals gab, unter anderem im kulturellen Bereich. Es gab Unmengen an Literatur, die in der DDR entweder „nicht leicht zu haben, kulturpolitisch ausgegrenzt oder verboten war“. Doch nicht alle Bürger der DDR wollten sich vorschreiben lassen, was sie lesen durften und was nicht. Die Leser, die Verbotenes lesen wollten, waren durchaus einfallsreich in ihren Ideen, wie sie beispielsweise an Bücher aus dem westlichen Ausland herankamen. Nicht selten war dies mit enormen Risiken verbunden.
Prof. Dr. Rainer Eckert, bis vor Kurzem Direktor des Zeitgeschichtlichen Forums in Leipzig, vertritt folgende Ansicht: „Meine These ist die, dass es in der DDR möglich war, wenn auch in sehr langen Zeiträumen, unter schwierigen Bedingungen, letztlich jedes Buch auch zu bekommen.“ Diese Aussage wirft die Frage auf, ob es tatsächlich jedem Leser möglich war, die Literatur zu erstehen, die ihm wichtig war. Dies erfordert ein gewisses Hintergrundwissen zum heimlichen Leser. Wie kennzeichnete er sich, wie verhielt er sich? Außerdem ist von großem Interesse, welche Möglichkeiten er hatte, die begehrte verbotene Literatur zu erlangen, mit welchem Ziel er dies tat und welche Folgen das für ihn persönlich und auch für sein Umfeld hatte. Diese Fragen finden in der folgenden Abschlussarbeit mit Hilfe von Zeitzeugeninterviews Beantwortung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Heranführung an das Thema
- Aufbau und Struktur
- Bestimmung des Ausgangsmaterials
- Festlegung des Materials
- Entstehungssituationen der Interviews
- Formale Charakteristik des Ausgangsmaterials
- Die Zeitzeugen
- Methodisches Vorgehen
- Festlegung des Materials
- Heimliches Lesen in der DDR
- Die Literaturpolitik in der DDR
- Funktionen von Literatur aus Sicht der DDR
- Heimliche Leser und ihre Erfahrungen mit unerwünschter Literatur
- Baldur Haase
- Vera Lengsfeld
- Siegmar Faust
- Thomas Dahnert
- Siegbert Schefke
- Holger Irmer
- Matthias Chlebowski
- Auswertung der Zeitzeugeninterviews
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Phänomen des heimlichen Lesens und Bücherschmuggels in der DDR. Sie untersucht die Möglichkeiten, die DDR-Bürger hatten, um die Einschränkungen der Literaturpolitik zu umgehen, sowie die Folgen dieser Handlungen für die Beteiligten. Das zentrale Interesse liegt dabei auf den Erfahrungen und Perspektiven der heimlichen Leser selbst.
- Die Einschränkungen der Literaturpolitik in der DDR
- Die Motivationen und Strategien der heimlichen Leser
- Die Folgen des heimlichen Lesens für die Leser und ihre Umgebung
- Die Rolle der Literatur als Mittel der Meinungsbildung und des Widerstands
- Die Bedeutung von Zeitzeugeninterviews für die Erforschung des Themas
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des heimlichen Lesens und Bücherschmuggels in der DDR ein. Sie beleuchtet die Relevanz des Themas im Kontext der DDR-Literaturpolitik und stellt den Fokus auf die Erfahrungen der heimlichen Leser selbst. Das zweite Kapitel erläutert die Methode der Zeitzeugeninterviews und die Auswahl der Interviewpartner. Das dritte Kapitel bietet einen Überblick über die Literaturpolitik der DDR und die Funktionen, die Literatur aus Sicht des DDR-Regimes hatte. Das vierte Kapitel konzentriert sich auf die Erfahrungen der heimlichen Leser mit unerwünschter Literatur und analysiert ihre Motivationen, Strategien und die Folgen ihres Handelns. Das fünfte Kapitel fasst die Ergebnisse der Zeitzeugeninterviews zusammen.
Schlüsselwörter
Heimliches Lesen, Bücherschmuggel, DDR, Literaturpolitik, Zensur, Zeitzeugeninterviews, Meinungsfreiheit, Widerstand, Kulturgeschichte, Literaturkonsum, verbotene Literatur, Erfahrungsberichte.
- Quote paper
- Juliane Bonkowski (Author), 2015, Heimliches Lesen und Bücherschmuggel in der DDR, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/335646