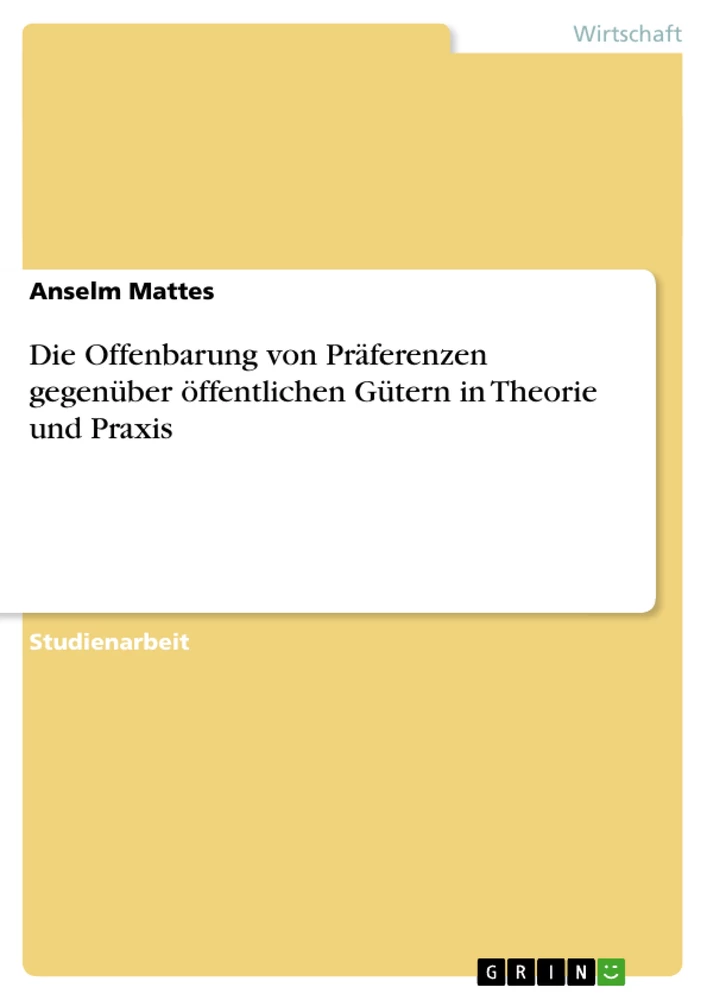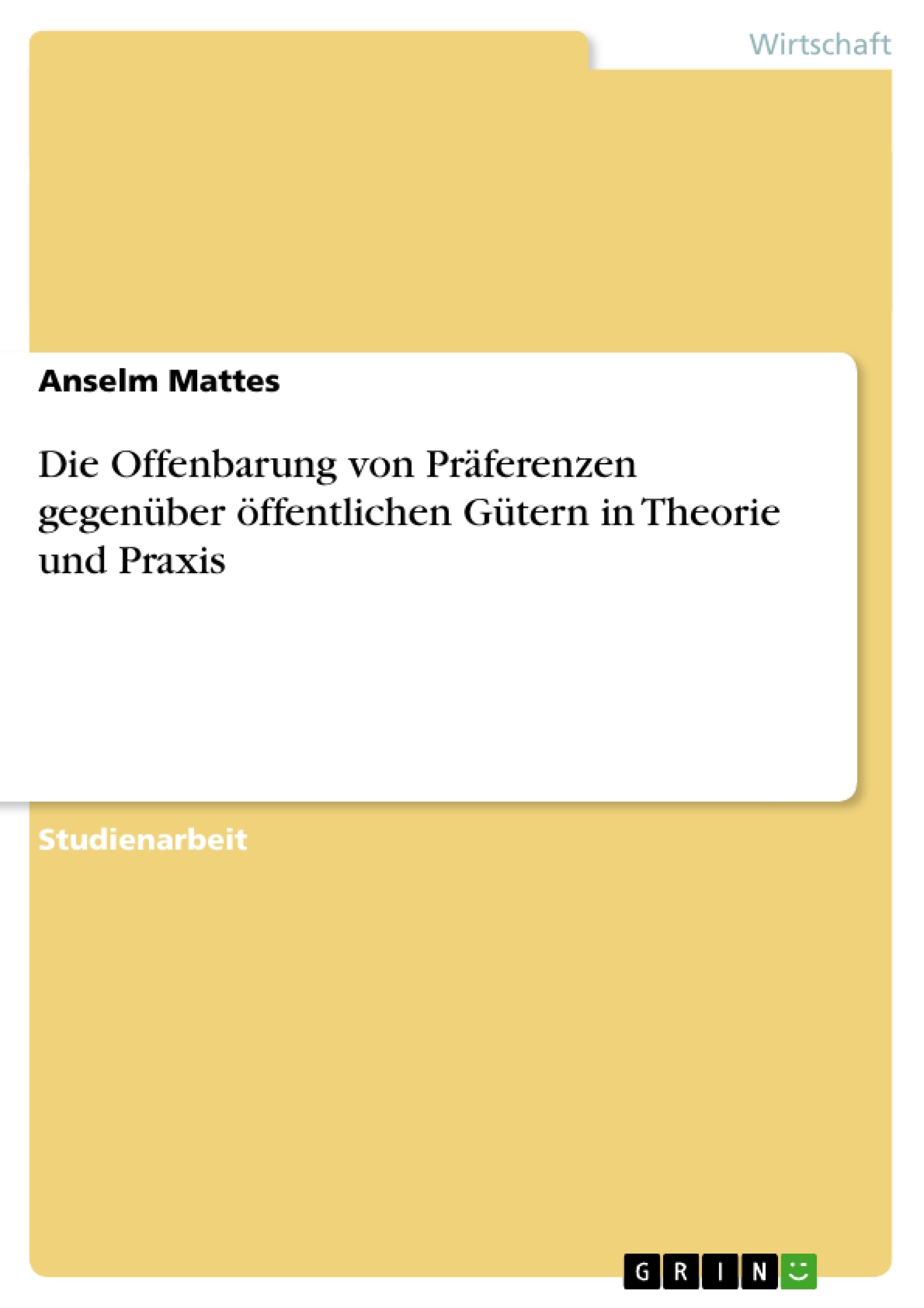Bei öffentlichen Güter versagt der Marktmechanismus; dies bedeutet, dass ihre Bereitstellung und optimale Allokation nicht über den Markt sichergestellt ist. Dies ist eine wesentliche ökonomische Begründung für Staatseingriffe in das Wirtschaftsgeschehen [vgl. Blankart (2003, S. 57ff.)].
So besteht auch ein wesentlicher Teil der Staatstätigkeit darin, öffentliche Güter bereitzustellen. Das Budget der westlichen Industrieländer besteht neben Sozialtransfers zu einem großen Teil aus Ausgaben für diese Güter. Doch gibt es viele Zeichen dafür, dass die Allokation dieser öffentlichen Güter nicht im Interesse der Bevölkerung ist oder - anders ausgedrückt - nicht den Präferenzen der Bürger entspricht. So nimmt nach Breitbach (2000, S.3) der Widerstand gegen Steuerzahlungen immer weiter zu und die Zufriedenheit mit den staatlichen Leistungen immer weiter ab [vgl. Pommerehne (1987, S. 1f)].
Dies bedeutet, dass die Mechanismen, die zur Allokation der öffentlichen Güter führen, nicht optimal sind. In repräsentativen Demokratien werden die Präferenzen für öffentliche Güter durch Wahlen ausgedrückt [vgl. Brümmerhoff (2001, S. 104)]. Ein Bürger wählt die Person oder Partei, die ihm das attraktivste Bündel an öffentlichen Gütern und deren Finanzierung verspricht. Offensichtlich führen Wahlen aber nicht zu einem effizienten Ergebnis [vgl. Brümmerhoff (2001, S. 222f)].
In diesem Zustand existieren wesentliche Gerechtigkeitsprobleme: Bürger, die ein öffentliches Gut ausdrücklich nicht wünschen (z.B. Verteidigung), müssen dieses trotzdem durch ihre Steuerzahlungen mitfinanzieren.
Ein wesentlicher Teil dieses Problems ist darauf zurückzuführen, dass im politischen Prozess unzureichende Informationen über die Präferenzen der Bürger für öffentliche Güter zur Verfügung stehen [Pommerehne (1987, S. 6)]. Jedoch hat, wie im zweiten Abschnitt dargestellt wird, jedes Individuum einen positiven Anreiz seine Präferenzen für öffentliche Güter zu verbergen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Eigenschaften privater und öffentlicher Güter
- 3. Die optimale Bereitstellung öffentlicher Güter - Das Samuelson-Modell
- 4. Das Lindahl-Modell
- 5. Methoden zur Ermittlung der Präferenzen gegenüber öffentlichen Gütern
- 5.1. Indirekte Methoden
- 5.1.1. Substitutionsbeziehungen
- 5.1.2. Komplementaritätsbeziehungen
- 5.1.3. Marktpreismethode
- 5.1.4. Aufwandmethode
- 5.1.5. Wanderungsanalyse
- 5.2. Direkte Methoden
- 5.2.1. Laborexperimente - Clarke-Steuer
- 5.2.2. Marktsimulationen
- 5.2.3. Contingent Valuation Method
- 5.1. Indirekte Methoden
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen bei der Bereitstellung öffentlicher Güter aufgrund des Marktversagens und der Schwierigkeit, die Präferenzen der Bürger zu ermitteln. Sie analysiert verschiedene theoretische Modelle und Methoden zur Ermittlung dieser Präferenzen, sowohl indirekte als auch direkte Ansätze. Das Ziel ist es, ein Verständnis für die Komplexität der optimalen Allokation öffentlicher Güter zu schaffen und die Vor- und Nachteile der verschiedenen Präferenz-Ermittlungsmethoden zu beleuchten.
- Marktversagen bei öffentlichen Gütern
- Theorien der optimalen Bereitstellung öffentlicher Güter (Samuelson, Lindahl)
- Indirekte Methoden zur Präferenzmessung
- Direkte Methoden zur Präferenzmessung
- Praktische Anwendbarkeit der Methoden
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Problematik der Bereitstellung öffentlicher Güter ein. Sie argumentiert, dass der Marktmechanismus bei öffentlichen Gütern versagt und der Staat deshalb eingreifen muss. Der zunehmende Widerstand gegen Steuerzahlungen und die sinkende Zufriedenheit mit staatlichen Leistungen verdeutlichen die Ineffizienz bestehender Allokationsmechanismen, insbesondere im Hinblick auf die unzureichende Information über die Bürgerpräferenzen. Die Arbeit kündigt die Analyse verschiedener Methoden zur Ermittlung dieser Präferenzen an, um eine effizientere Bereitstellung öffentlicher Güter zu ermöglichen und die Konsumentensouveränität zu stärken. Das Ziel ist die Verbesserung der Kosten-Nutzen-Analysen öffentlicher Projekte, besonders im umweltpolitischen Bereich.
2. Eigenschaften privater und öffentlicher Güter: Dieses Kapitel beschreibt die zentralen Eigenschaften privater und öffentlicher Güter. Private Güter zeichnen sich durch Rivalität im Konsum und Ausschließbarkeit aus, was zu einer pareto-effizienten Allokation über den Marktmechanismus führt. Öffentliche Güter hingegen sind durch Nicht-Rivalität und Nicht-Ausschließbarkeit gekennzeichnet. Diese Eigenschaften führen zum Problem des Trittbrettfahrerverhaltens (Free-Riding), welches das Marktversagen bei öffentlichen Gütern erklärt. Der Staat muss als Anbieter und Allokator fungieren, benötigt hierfür aber Informationen über die Präferenzen der Bürger, die jedoch aus strategischen Gründen oft nicht korrekt offenbart werden.
Schlüsselwörter
Öffentliche Güter, Marktversagen, Präferenzoffenbarung, Samuelson-Modell, Lindahl-Modell, Indirekte Methoden, Direkte Methoden, Contingent Valuation Method, Trittbrettfahrerverhalten, Kosten-Nutzen-Analyse, Allokation, Wohlfahrt.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument "Bereitstellung Öffentlicher Güter"
Was ist der Gegenstand des Dokuments?
Das Dokument befasst sich mit der Herausforderung der Bereitstellung öffentlicher Güter. Es analysiert die Gründe für Marktversagen im Kontext öffentlicher Güter und untersucht verschiedene Methoden zur Ermittlung der Präferenzen der Bürger bezüglich dieser Güter, um eine effizientere Allokation zu ermöglichen.
Welche Modelle zur optimalen Bereitstellung öffentlicher Güter werden behandelt?
Das Dokument behandelt das Samuelson-Modell und das Lindahl-Modell als zentrale theoretische Ansätze zur optimalen Bereitstellung öffentlicher Güter. Diese Modelle dienen als Grundlage für die Diskussion der Herausforderungen bei der praktischen Umsetzung.
Welche Methoden zur Ermittlung von Präferenzen werden vorgestellt?
Das Dokument unterscheidet zwischen indirekten und direkten Methoden zur Ermittlung der Bürgerpräferenzen. Indirekte Methoden umfassen beispielsweise die Analyse von Substitutions- und Komplementaritätsbeziehungen, die Marktpreismethode, die Aufwandmethode und die Wanderungsanalyse. Direkte Methoden beinhalten Laborexperimente (mit Clarke-Steuer), Marktsimulationen und die Contingent Valuation Method (CVM).
Was ist das Problem des "Trittbrettfahrerverhaltens"?
Das Trittbrettfahrerverhalten (Free-Riding) beschreibt das Phänomen, dass Individuen von öffentlichen Gütern profitieren, ohne dazu beizutragen. Dies ist eine zentrale Ursache für das Marktversagen bei öffentlichen Gütern, da der Marktmechanismus allein nicht in der Lage ist, eine effiziente Bereitstellung zu gewährleisten.
Welche Eigenschaften charakterisieren private und öffentliche Güter?
Private Güter zeichnen sich durch Rivalität im Konsum und Ausschließbarkeit aus. Öffentliche Güter hingegen sind durch Nicht-Rivalität und Nicht-Ausschließbarkeit gekennzeichnet. Diese Unterschiede erklären das unterschiedliche Verhalten von Märkten bei der Bereitstellung dieser Gütertypen.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument enthält folgende Kapitel: Einleitung, Eigenschaften privater und öffentlicher Güter, Das Samuelson-Modell, Das Lindahl-Modell, Methoden zur Ermittlung der Präferenzen (indirekte und direkte Methoden), und Fazit.
Was ist das Ziel des Dokuments?
Das Dokument zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis für die Komplexität der optimalen Allokation öffentlicher Güter zu schaffen. Es beleuchtet die Vor- und Nachteile verschiedener Methoden zur Präferenzmessung und trägt somit zu einer fundierteren Diskussion über die effiziente Bereitstellung öffentlicher Güter bei.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Dokuments?
Schlüsselwörter sind: Öffentliche Güter, Marktversagen, Präferenzoffenbarung, Samuelson-Modell, Lindahl-Modell, Indirekte Methoden, Direkte Methoden, Contingent Valuation Method, Trittbrettfahrerverhalten, Kosten-Nutzen-Analyse, Allokation, Wohlfahrt.
Welche praktischen Anwendungen werden angesprochen?
Das Dokument betont die praktische Anwendbarkeit der vorgestellten Methoden, insbesondere im Hinblick auf die Verbesserung von Kosten-Nutzen-Analysen öffentlicher Projekte, vor allem im umweltpolitischen Bereich. Die Verbesserung der Information über Bürgerpräferenzen soll zu einer effizienteren und konsumentensouveräneren Gestaltung der öffentlichen Daseinsvorsorge beitragen.
- Quote paper
- Anselm Mattes (Author), 2004, Die Offenbarung von Präferenzen gegenüber öffentlichen Gütern in Theorie und Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33547