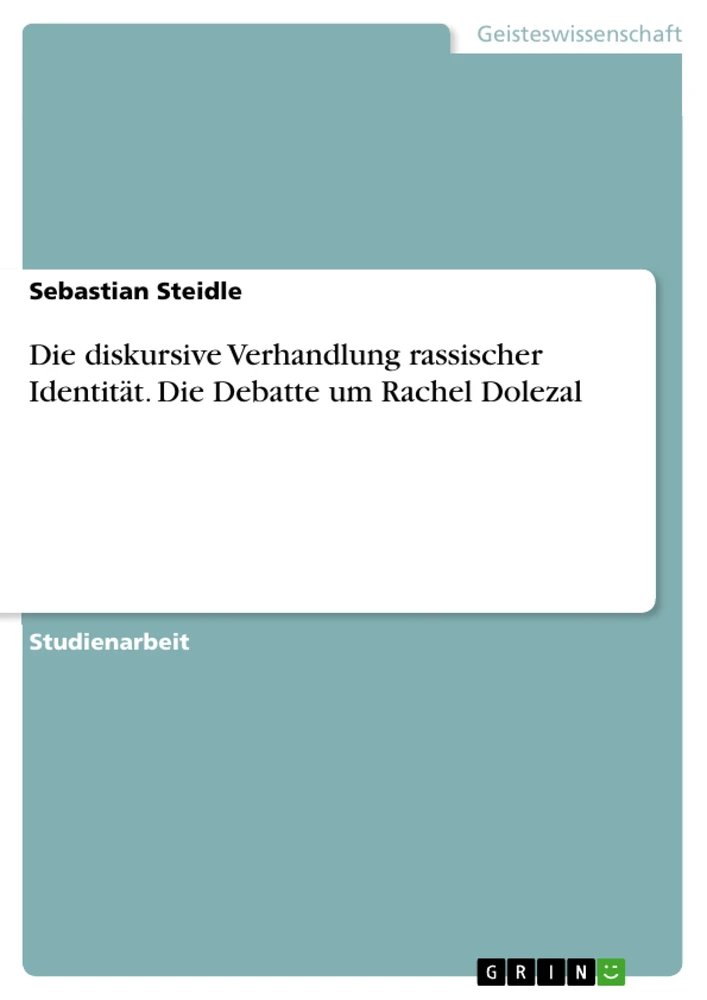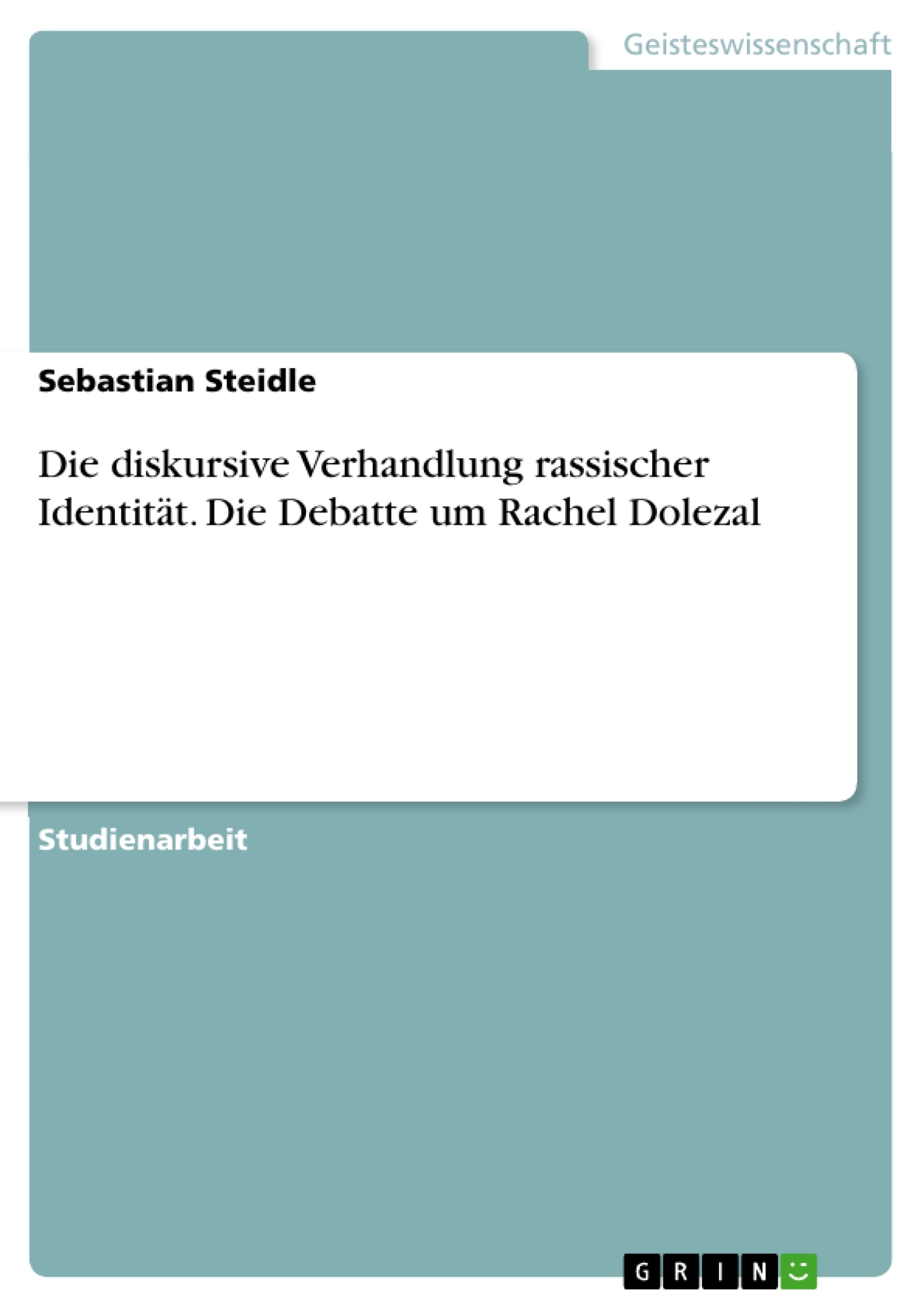Am 12. Juni 2015 sorgte Rachel Dolezal, Dozentin für afrikanische und afroamerikanische Studien an der Eastern Washington University und Präsidentin der lokalen Abteilung der National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), in den USA und darüber hinaus für einen medialen Skandal. Die Frau, die sich seit Jahren für die Rechte von Afroamerikanern einsetzt und die von sich selbst behauptet, als Schwarze unter der anhaltenden Rassendiskriminierung in Amerika zu leiden, wurde von ihren Eltern als Weiße „geoutet“.
Rachel Dolezal hatte zu diversen Anlässen angegeben, Tochter einer weißer Mutter und eines schwarzen Vaters zu sein, was ihr in der dominierenden Anschauung innerhalb der US-Amerikanischen Gesellschaft eine schwarze Identität zuschreiben würde. Eine Identität, die sie sich auch selbst gab, indem sie in Bewerbungen für Arbeitsstellen mehrfach die Kategorie „African American“ ankreuzte und indem sie in den von ihr veröffentlichten Artikeln über Rassismus die inkludierenden Pronomen „we“ und „us“ verwendete.
Im Anschluss daran wurde Rachel Dolezal zum Subjekt einer landesweiten Debatte, welche in der „Logik eines Gerichtsprozesses“ (Brubaker 2016: 434) geführt wurde, wobei die meisten Kommentatoren zum Schluss kamen, dass sich Frau Dolezal des Betruges, in Form des Identitätsdiebstahls, schuldig gemacht habe. Der Fall löste jedoch auch eine tiefergehende Debatte über Beschaffenheit von Rasse und rassischen Kategorisierungen in den USA aus.
Auch in deutschen Medien wurde über den Fall im Sinne einer kuriosen Betrugsgeschichte berichtet, wobei der Tenor, derselbe war: Es wurde als Fakt dargestellt, dass Rachel Dolezal keine Afroamerikanerin sei, sich jedoch als solche ausgab, was sie wahlweise zur Lügnerin, Opportunistin oder gar Rassistin machte.
Ich möchte in dieser Arbeit darstellen, wie in der Debatte um die Person Rachel Dolezal die Kategorie Rasse als soziale Tatsache reifiziert bzw. ins Wanken gebracht wurde. Ferner möchte erörtern, ob eine Analogie der Kategorien Rasse bzw. Ethnie und Geschlecht analytisch sinnvoll ist und deshalb von „Cisracial“ und „Transracial“ gesprochen werden kann, das Konzept "Trans-" also auch über seinen Herkunftskontext hinaus analytisch sinvoll ausgeweitet werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- Der Fall Rachel Dolezal
- Die Konzeption von Rasse in den Vereinigten Staaten von Amerika
- Die Debatte um Rachel Dolezal im Kontext der Debatte um die Person Caitly Jenner
- Die Ideologischen Positionen im Diskurs
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Debatte um Rachel Dolezal und analysiert, wie die Kategorie Rasse als soziale Tatsache reifiziert oder in Frage gestellt wurde. Sie betrachtet die Analogie zwischen den Kategorien Rasse/Ethnie und Geschlecht und hinterfragt die analytische Sinnhaftigkeit von Begriffen wie "Cisracial" und "Transracial". Darüber hinaus beleuchtet sie die Frage, ob die Existenz und Anerkennung von Transidentitäten zur Desessentialisierung sozialer Kategorien führt oder ob sie diese eher reifizieren.
- Reifizierung der Kategorie Rasse in der Debatte um Rachel Dolezal
- Analogie zwischen Rasse/Ethnie und Geschlecht und die analytische Sinnhaftigkeit von "Cisracial" und "Transracial"
- Einfluss der Anerkennung von Transidentitäten auf die Desessentialisierung oder Reifizierung sozialer Kategorien
- Analyse verschiedener Deutungskämpfe in der Debatte um Rachel Dolezal, insbesondere zwischen Konstruktivisten und Essentialisten sowie zwischen Voluntaristen/Subjektivisten und Intersubjektivisten/Objektivisten/Realisten
- Bedeutung individueller Entscheidungsfreiheit und Mobilität zwischen sozialen Kategorien für deren Destabilisierung oder Reifizierung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Der Fall Rachel Dolezal
Das Kapitel beleuchtet den Fall Rachel Dolezal, einer Dozentin für afrikanische und afroamerikanische Studien, die für einen medialen Skandal sorgte, als ihre Eltern sie als Weiße „outeten“. Die Debatte um Dolezal wird als „Logik eines Gerichtsprozesses“ beschrieben, in dem sie des Betruges, in Form von Identitätsdiebstahl, beschuldigt wurde. Der Fall löste jedoch auch eine tiefere Debatte über die Beschaffenheit von Rasse und rassischen Kategorisierungen in den USA aus. Die deutsche Medienberichterstattung wird ebenfalls analysiert, wobei der Fokus auf der Darstellung von Dolezal als Lügnerin, Opportunistin oder Rassistin liegt.
2. Die Konzeption von Rasse in den Vereinigten Staaten von Amerika
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Definition von Rasse und differenziert zwischen essentialistischen und konstruktivistischen Ansätzen. Es wird betont, dass der Begriff der Rasse in der Biologie und Anthropologie weitgehend desavouiert wurde, während er im US-amerikanischen Alltag weiterhin eine wichtige Rolle spielt. Das Kapitel beleuchtet die verschiedenen Faktoren, die bei der Zuschreibung einer Rasse relevant sind, wie beispielsweise das äußere Erscheinungsbild, die sozialen Kreise und kulturellen Praktiken, die Selbstidentifikation und die unterstellte Herkunft der Vorfahren.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokus-Themen der Arbeit sind: Rasse, Rassismus, Identität, Transracialität, Konstruktivismus, Essentialismus, Voluntarismus, Intersubjektivismus, Objektivismus, Realismus, soziale Kategorien, Desessentialisierung, Reifizierung, Debatte, Rachel Dolezal, Caitlyn Jenner, USA.
- Quote paper
- Sebastian Steidle (Author), 2016, Die diskursive Verhandlung rassischer Identität. Die Debatte um Rachel Dolezal, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/334703