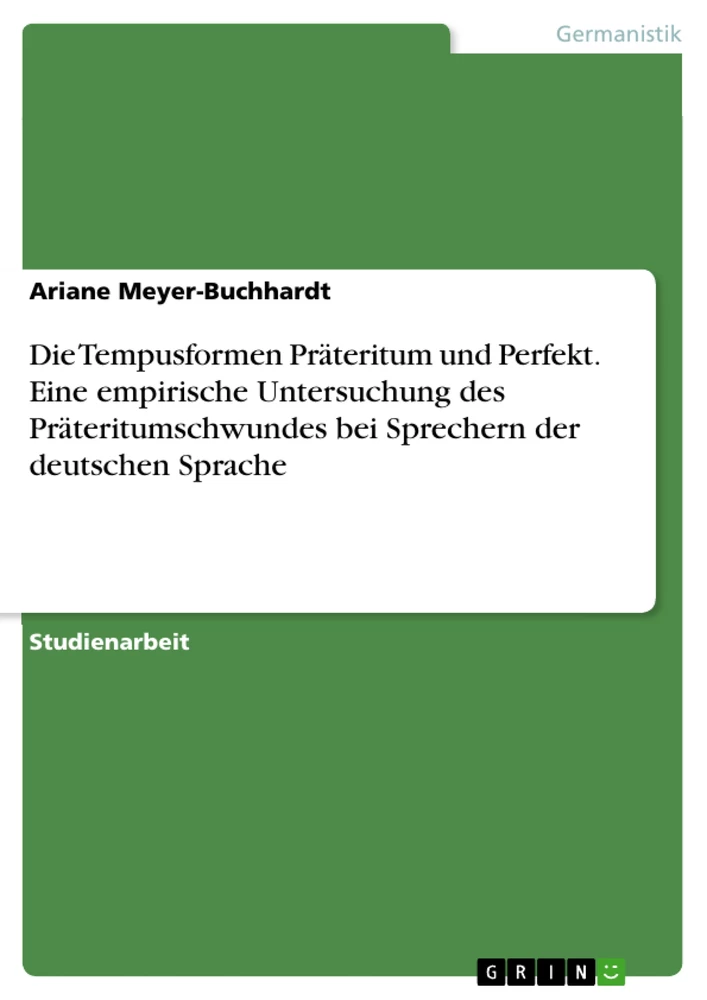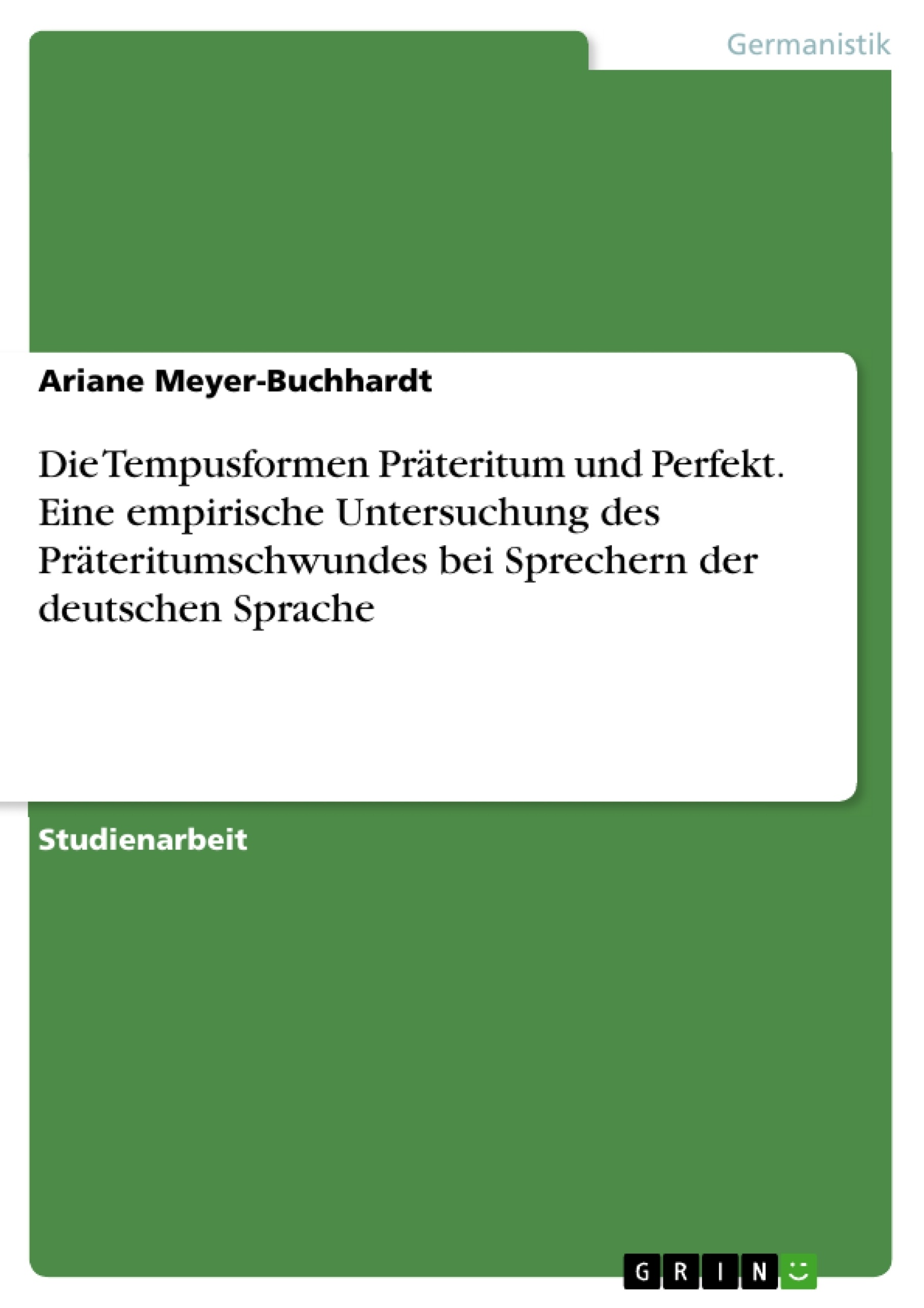Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit der allgemein bekannten Tatsache des Präteritumschwundes anhand einer Untersuchung der Gebrauchshäufigkeit der Tempusformen Präteritum und Perfekt. Dazu werden Schülertexte darauf hin untersucht, wo statt einem zu erwartenden Präteritum das Perfekt gebraucht wurde. LINDGREN schreibt dazu, dass die Verwendung der Vergangenheitstempora im Deutschen eine recht unklare Sache darstellt. Feste, eindeutige Regeln für ihre Verteilung lassen sich nicht aufstellen.
Somit werde ich in dieser Arbeit versuchen das genannte Problem anhand von zwei unterschiedlichen Hypothesen und einem Vergleich zwischen der Verwendung des Perfekts und Präteritums in schriftlichen Texten sowie in mündlichen Erzählungen zu untersuchen.
Dazu wird zunächst im theoretischen Teil (Kapitel 2) der vorliegenden Arbeit die Definitionen sowie die Darstellungen der beiden Tempusformen Präteritum und Perfekt in den deutschen Grammatiken sowie Schülergrammatiken und Schulbüchern geklärt werden. Anschließend daran wird das Phänomen des Präteritumschwundes durch eine allgemeine Begriffsklärung, den historischen Verlauf des Schwundes, Erklärungen für diesen und durch die Darstellung des heutigen Zustandes in der deutschen Sprache dargestellt.
Der methodische Teil (Kapitel 3) stellt die von mir zu bearbeitenden zwei Hypothesen ROWLEYS sowie den von mir durchzuführenden Vergleich vor, anhand derer ich die unterschiedlichen Gebrauchshäufigkeiten von Präteritum und Perfekt, sowohl in geschriebenen Texten als auch in der verschriftlichten Form von mündlichen Erzählungen, an den mir zur Verfügung gestellten Korpus an Schülertexten untersuchen werde.
Im Analyseteil (Kapitel 4) werden nach den Hypothesen geordnet alle darin aufkommenden Fragen in Bezug auf die Verwendung der beiden Tempusformen untersucht sowie festgestellte Unterschiede und Tendenzen zu erklären versucht. Im fünften Kapitel werde ich die vorherigen gewonnenen Ergebnisse zum unterschiedlichen Gebrauch von Präteritum und Perfekt im Deutschen zusammenfassen sowie die Frage zu klären versuchen, ob tatsächlich das Phänomen des Präteritumschwundes in den von mir zu untersuchenden Texten zu finden ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Teil
- Darstellung von Präteritum und Perfekt in deutschen Grammatiken
- Darstellung von Präteritum und Perfekt in Schulgrammatiken und Schulbüchern
- Der Präteritumschwund in der deutschen Sprache
- Begriffsklärung
- Historischer Verlauf
- Erklärungen für den Präteritumschwund
- Heutiger Zustand in der deutschen Sprache
- Methodischer Teil
- Hypothesen
- Das Korpus
- Analyseteil
- Hypothese 1
- Hypothese 2
- Vergleich Präteritum und Perfekt
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Präteritumschwund im Deutschen anhand der Gebrauchshäufigkeit von Präteritum und Perfekt in Schülertexten. Ziel ist es, mittels Hypothesenprüfung und Vergleich der Tempusverwendung in schriftlichen und mündlichen Erzählungen, das Ausmaß des Präteritumschwundes zu belegen oder zu widerlegen.
- Definition und Darstellung von Präteritum und Perfekt in Grammatiken
- Historischer Verlauf und Erklärungen für den Präteritumschwund
- Empirische Untersuchung der Tempusverwendung in Schülertexten
- Hypothesenprüfung und Vergleich von Präteritum und Perfekt
- Analyse der Ergebnisse und Schlussfolgerungen zum Präteritumschwund
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema des Präteritumschwundes ein und skizziert die Methodik der Arbeit. Es wird die Problematik der uneindeutigen Regeln für die Verwendung von Vergangenheitstempora im Deutschen angesprochen und die Vorgehensweise der Untersuchung mit zwei Hypothesen und einem Vergleich von schriftlichen und mündlichen Texten beschrieben. Der theoretische, methodische und Analyseteil der Arbeit werden kurz umrissen.
Theoretischer Teil: Dieser Teil beleuchtet zunächst die Darstellung des Präteritums und Perfekts in verschiedenen Grammatiken, sowohl allgemeinen als auch schulischen. Im Anschluss wird das Phänomen des Präteritumschwundes umfassend behandelt: Seine Definition wird präzisiert, sein historischer Verlauf nachgezeichnet, verschiedene Erklärungen dafür diskutiert und der aktuelle Stand in der deutschen Sprache dargestellt. Dieser Abschnitt legt das theoretische Fundament für die spätere empirische Analyse.
Methodischer Teil: In diesem Kapitel werden die beiden zentralen Hypothesen der Arbeit vorgestellt, die den Rahmen für die anschließende Analyse bilden. Darüber hinaus wird das verwendete Korpus an Schülertexten beschrieben, das als Grundlage für die empirische Untersuchung dient. Die Methodik der Analyse, die auf dem Vergleich der Häufigkeit von Präteritum und Perfekt basiert, wird ebenfalls erläutert.
Analyseteil: Dieser Teil präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung, gegliedert nach den zuvor formulierten Hypothesen. Die Analyse betrachtet die Verwendung von Präteritum und Perfekt in den Schülertexten und untersucht Unterschiede und Tendenzen im Gebrauch beider Tempusformen. Es wird versucht, die festgestellten Ergebnisse zu erklären und in einen umfassenderen Kontext zu stellen.
Schlüsselwörter
Präteritumschwund, Perfekt, Präteritum, Tempusgebrauch, deutsche Grammatik, Schulgrammatik, empirische Untersuchung, Schülertexte, Hypothesenprüfung, Vergangenheitstempora.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit über den Präteritumschwund
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Präteritumschwund im Deutschen. Sie analysiert die Gebrauchshäufigkeit von Präteritum und Perfekt in Schülertexten, um das Ausmaß des Präteritumschwundes zu belegen oder zu widerlegen.
Welche Aspekte werden im theoretischen Teil behandelt?
Der theoretische Teil beleuchtet die Darstellung von Präteritum und Perfekt in verschiedenen Grammatiken (allgemein und schulisch). Er behandelt umfassend den Präteritumschwund: seine Definition, seinen historischen Verlauf, verschiedene Erklärungen und den aktuellen Stand in der deutschen Sprache. Dieser Teil bildet das theoretische Fundament für die empirische Analyse.
Welche Methodik wird angewendet?
Die Arbeit verwendet eine empirische Methode. Zentrale Bestandteile sind die Formulierung von zwei Hypothesen, die Beschreibung eines Korpus an Schülertexten und die Analyse der Häufigkeit von Präteritum und Perfekt in diesen Texten. Der Vergleich schriftlicher und mündlicher Erzählungen spielt ebenfalls eine Rolle.
Welche Hypothesen werden geprüft?
Die konkreten Hypothesen werden im methodischen Teil der Arbeit detailliert vorgestellt. Die Analyse der Ergebnisse erfolgt im Hinblick auf die Bestätigung oder Widerlegung dieser Hypothesen.
Wie ist der Aufbau der Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen theoretischen Teil, einen methodischen Teil, einen Analyseteil und ein Fazit. Der theoretische Teil befasst sich mit der Darstellung des Präteritums und Perfekts in Grammatiken und dem Präteritumschwund. Der methodische Teil beschreibt die Hypothesen und das Korpus. Der Analyseteil präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung von Präteritum und Perfekt in Schülertexten.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden gegeben?
Es werden Kapitelzusammenfassungen für die Einleitung (Einführung in das Thema und die Methodik), den theoretischen Teil (Darstellung von Präteritum und Perfekt und des Präteritumschwunds), den methodischen Teil (Hypothesen und Korpusbeschreibung) und den Analyseteil (Ergebnisse der empirischen Untersuchung) bereitgestellt.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter umfassen: Präteritumschwund, Perfekt, Präteritum, Tempusgebrauch, deutsche Grammatik, Schulgrammatik, empirische Untersuchung, Schülertexte, Hypothesenprüfung, Vergangenheitstempora.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das Ausmaß des Präteritumschwundes im Deutschen durch die Untersuchung der Tempusverwendung in Schülertexten zu belegen oder zu widerlegen. Die Hypothesenprüfung und der Vergleich der Tempusverwendung in schriftlichen und mündlichen Erzählungen sind zentrale Bestandteile der Zielsetzung.
Wo finde ich das Inhaltsverzeichnis?
Das Inhaltsverzeichnis ist im HTML-Dokument enthalten und listet alle Kapitel und Unterkapitel auf, beginnend mit der Einleitung und endend mit dem Fazit. Es bietet einen detaillierten Überblick über den Aufbau der Arbeit.
- Quote paper
- Ariane Meyer-Buchhardt (Author), 2015, Die Tempusformen Präteritum und Perfekt. Eine empirische Untersuchung des Präteritumschwundes bei Sprechern der deutschen Sprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/334456