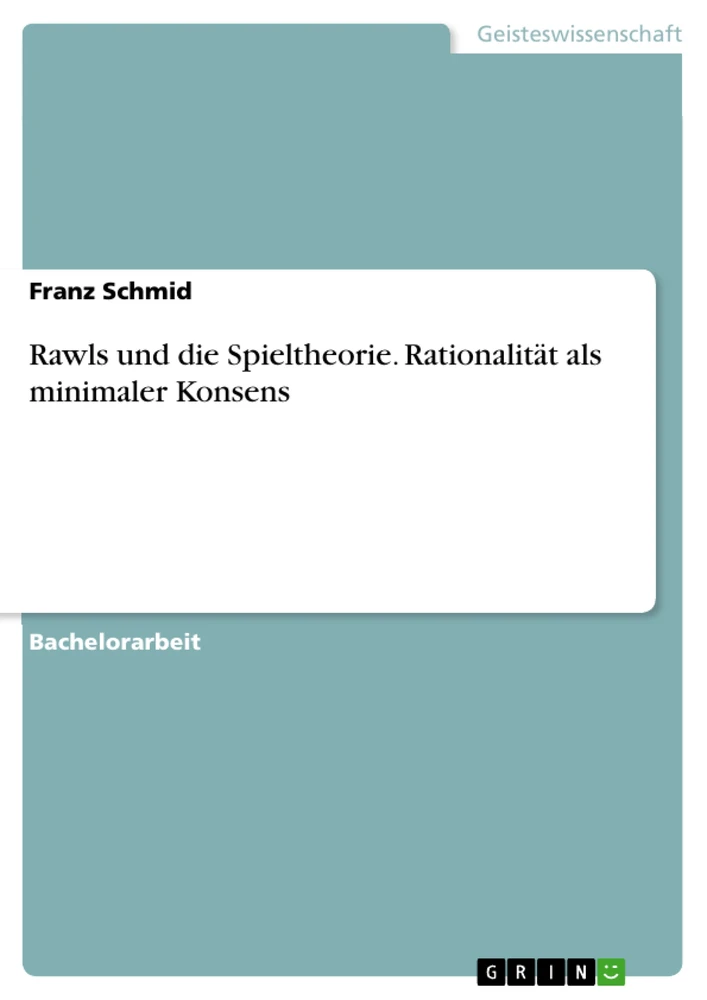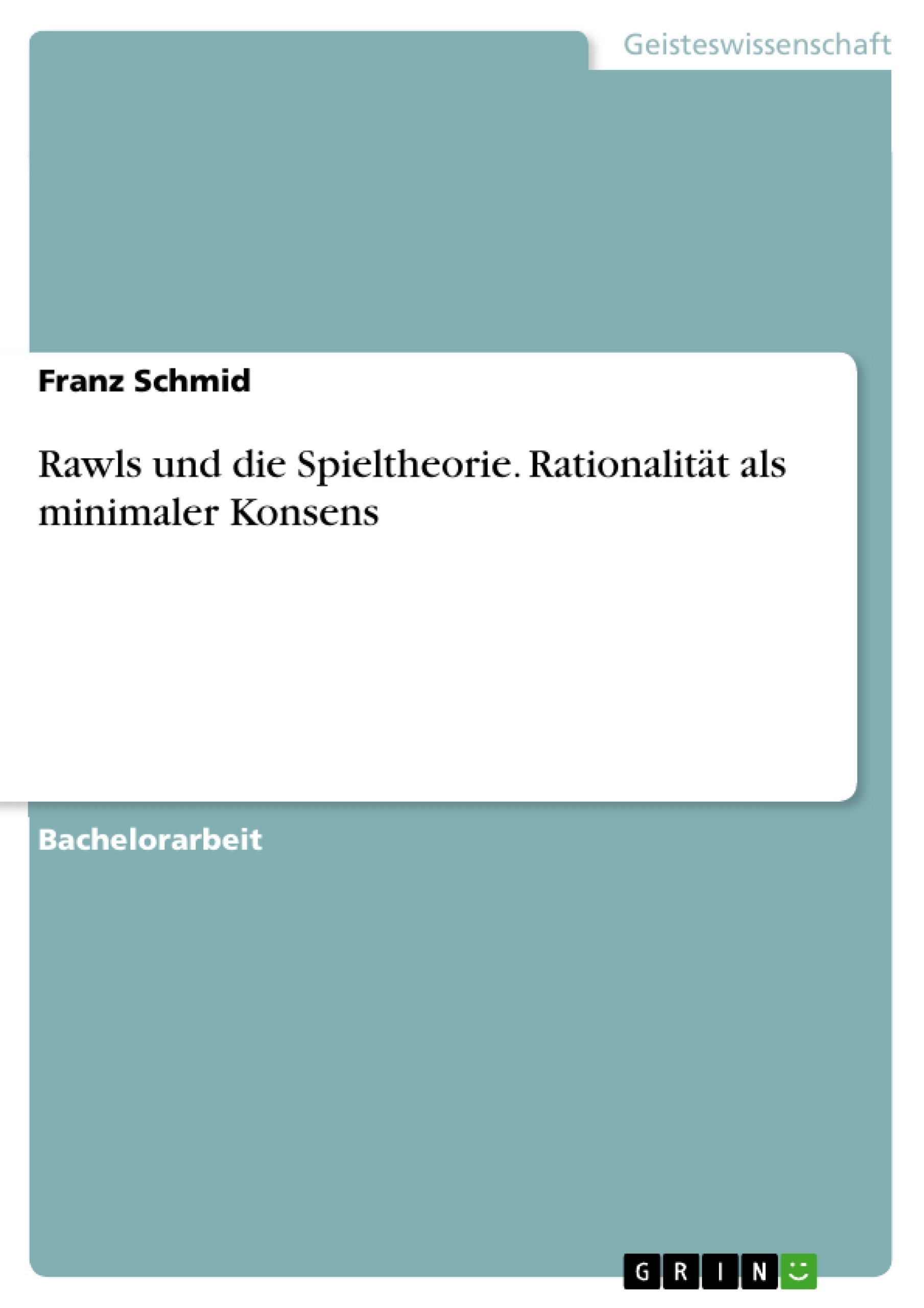Diese Arbeit greift das Konzept der „Theorie der Gerechtigkeit“ von Rawls auf und insbesondere den Gedanken, dass durch die Verhandlung unter einem hypothetischen „Schleier des Nichtwissens“, ein Ergebnis erzielt werden kann, das eine normative Aussage gibt, wie die Verteilung in einer fairen Gesellschaft aussehen könnte. Die Arbeit greift also den Bereich der Verteilungsfrage heraus. Anstatt zu fragen: „Wie soll eine gerechte Gesellschaft allgemeine aussehen?“, wird sich die Arbeit darauf fokussieren, nach der gerechten Verteilung von materiellen Gütern zu fragen.
Die Grundthese der Arbeit lautet: Da Gerechtigkeitsvorstellung divergieren, könnten sich die Menschen im Urzustand nicht auf eine allgemein anerkannte Gerechtigkeitsvorstellung einigen. Die Diskussion zwischen Rawls und Harsanyi zeigt bereits diese Problematik. Obwohl beide von einem sehr ähnlichen Urzustand ausgehen, leiten sie daraus unterschiedliche Entscheidungsregeln ab. Unter den Ökonomen war Harsanyi Rawls engagiertester Kritiker. Sein alternatives Gleichwahrscheinlichkeitsmodell soll darum, bezüglich Aussage und Konsistenz mit Rawls' „Theorie der Gerechtigkeit“ verglichen werden.
Da zuvor bereits dargelegt wird, dass die Ansichten der Individuen im Urzustand nicht eindeutig vereinbar sind, wird auch die Konsensfähigkeit beider Ansätze betrachtet, die sie bei den Individuen im Urzustand haben. Die zentrale Fragestellung lautet also: Auf welche Verteilungsform können sich die Menschen im Urzustand einigen?
Das Ergebnis der hypothetisch gewählten Verteilung unterscheidet sich in beiden Konzepten weniger. Ähnlich wie durch Rawls' Differenzprinz wird auch hier eine Verteilung mit egalitären Zügen gewählt. Die normative Bedeutung dieser Verteilung, soll durch eine plausiblere und rationalere Herleitung gestärkt werden. Wobei das Gewicht einer rationalen Argumentation, dabei nicht in der Rationalität als Selbstzweck liegt, sondern in der Konsensfähigkeit die ein rationaler Lösungsvorschlag mit sich bringt. Die Fokussierung auf die Verteilung von materiellen Gütern soll allerdings nicht bedeuten, dass die Frage nach einer gerechten Gesellschaft nicht von Bedeutung wäre. Im Gegenteil ist sie eine der zentralen Fragen der Sozialwissenschaft. Allerdings ist sie zu weitgehend um im Folgenden erörtert zu werden, da wie erwähnt der Aussagebereich enger gefasst werden soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Rawls',,Theorie der Gerechtigkeit“
- Leitgedanke
- Urzustand
- Überlegungsgleichgewicht
- Die beiden Grundsätze der Gerechtigkeit
- Deutung und Kritik
- Die Divergenz der Gerechtigkeitskonzepte
- Kriterien der Wohlfahrtsprinzipien
- Arrow Theorem
- Flöttenbeispiel
- Fehlende Universalisierbarkeit des Differenzprinzips
- Utilitarismus als minimaler Konsens
- Bedeutung von Neumann-Morgenstern-Nutzenfunktionen
- Harsanyis Gleichwahrscheinlichkeitsmodell
- Rationalität als minimaler Konsens
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die "Theorie der Gerechtigkeit" von John Rawls, insbesondere im Hinblick auf die Verteilung von materiellen Gütern. Der Fokus liegt auf der Frage, wie sich Individuen im hypothetischen Urzustand, in dem sie über die Folgen ihrer Entscheidungen nicht informiert sind, auf eine gerechte Verteilung einigen könnten. Die Arbeit setzt sich mit der Divergenz von Gerechtigkeitskonzepten auseinander und untersucht die unterschiedlichen Herangehensweisen von Rawls und Harsanyi, um den minimalen Konsens zu ermitteln, auf den sich Individuen im Urzustand einigen könnten.
- Rawls' "Theorie der Gerechtigkeit" und seine beiden Grundsätze der Gerechtigkeit
- Divergenz von Gerechtigkeitskonzepten und ihre Unvereinbarkeit
- Harsanyis Gleichwahrscheinlichkeitsmodell und der minimaler Konsens im Urzustand
- Rationalität und Konsensfähigkeit im Kontext der Verteilungsfrage
- Die normative Bedeutung einer hypothetisch gewählten Verteilung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die historische und aktuelle Bedeutung der Frage nach einer gerechten Verteilung und führt die Arbeit von John Rawls und seinen Beitrag zur Gerechtigkeitsdebatte ein. Es wird argumentiert, dass moderne Gesellschaften aufgrund des Verhältnisses zwischen Arbeit und Eigentum eine normative Theorie der Verteilung benötigen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Frage, wie sich Individuen im Urzustand, unter einem "Schleier des Nichtwissens", auf eine gerechte Verteilung von materiellen Gütern einigen könnten. Das Hauptproblem wird in der Divergenz von Gerechtigkeitsvorstellungen und deren Unvereinbarkeit gesehen.
Hauptteil
Der Hauptteil gliedert sich in drei Teile. Der erste Teil behandelt Rawls' "Theorie der Gerechtigkeit" und seine Argumentationslinie, die vom Urzustand über das Überlegungsgleichgewicht zu seinen beiden Grundprinzipien der Gerechtigkeit führt. Der zweite Teil befasst sich mit der Divergenz von Gerechtigkeitskonzepten und zeigt auf, dass sich der Unterschied der Gerechtigkeitstheorien vor allem in den Annahmen liegt, die die Theorien erfüllen sollen. Der letzte Teil des Hauptteils soll erklären, warum Harsanyis alternatives Konzept, die Verteilungsfrage mit dem Neumann-Morgenstern Nutzenkonzept zu lösen, als minimaler Konsens der Individuen im Urzustand akzeptiert werden würde.
2.1 Rawls',,Theorie der Gerechtigkeit“
Dieses Kapitel stellt Rawls' "Theorie der Gerechtigkeit" vor, insbesondere die Aspekte, die für die Fragestellung relevant sind. Es beleuchtet den Leitgedanken der Theorie, die Rolle des Urzustands und des Überlegungsgleichgewichts sowie die beiden Grundprinzipien der Gerechtigkeit.
2.2 Die Divergenz der Gerechtigkeitskonzepte
Dieser Abschnitt vergleicht verschiedene Gerechtigkeitskonzepte und zeigt auf, dass die primären Unterschiede in den Annahmen liegen, denen die Theorie genügen soll. Es werden die Kriterien der Wohlfahrtsprinzipien, das Arrow Theorem, das Flöttenbeispiel und die fehlende Universalisierbarkeit des Differenzprinzips diskutiert.
2.3 Utilitarismus als minimaler Konsens
Hier wird argumentiert, warum Harsanyis alternatives Konzept, die Verteilungsfrage mit dem Neumann-Morgenstern Nutzenkonzept zu lösen, am ehesten von allen Individuen im Urzustand akzeptiert würde. Es wird die Bedeutung von Neumann-Morgenstern-Nutzenfunktionen, Harsanyis Gleichwahrscheinlichkeitsmodell und die Rolle der Rationalität als minimaler Konsens beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen der Gerechtigkeitsverteilung, der "Theorie der Gerechtigkeit" von John Rawls, dem Urzustand, dem Schleier des Nichtwissens, den beiden Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Divergenz von Gerechtigkeitskonzepten, dem Arrow Theorem, dem Utilitarismus, dem Neumann-Morgenstern Nutzenkonzept, Harsanyis Gleichwahrscheinlichkeitsmodell, der Sozialwahltheorie und dem minimalen Konsens.
- Quote paper
- Franz Schmid (Author), 2012, Rawls und die Spieltheorie. Rationalität als minimaler Konsens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/334303