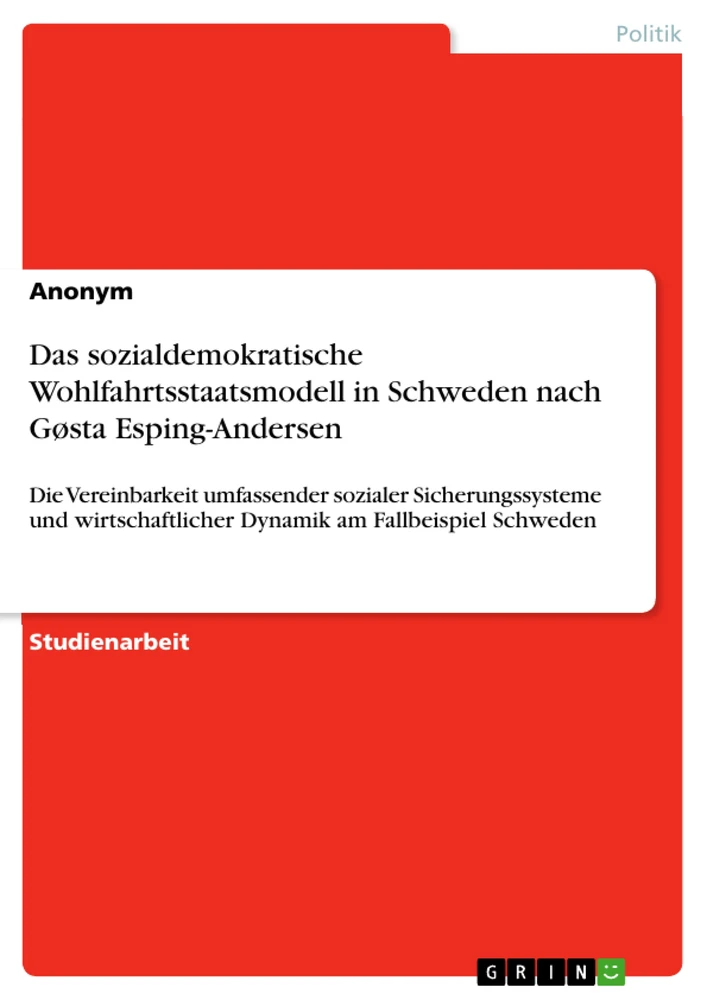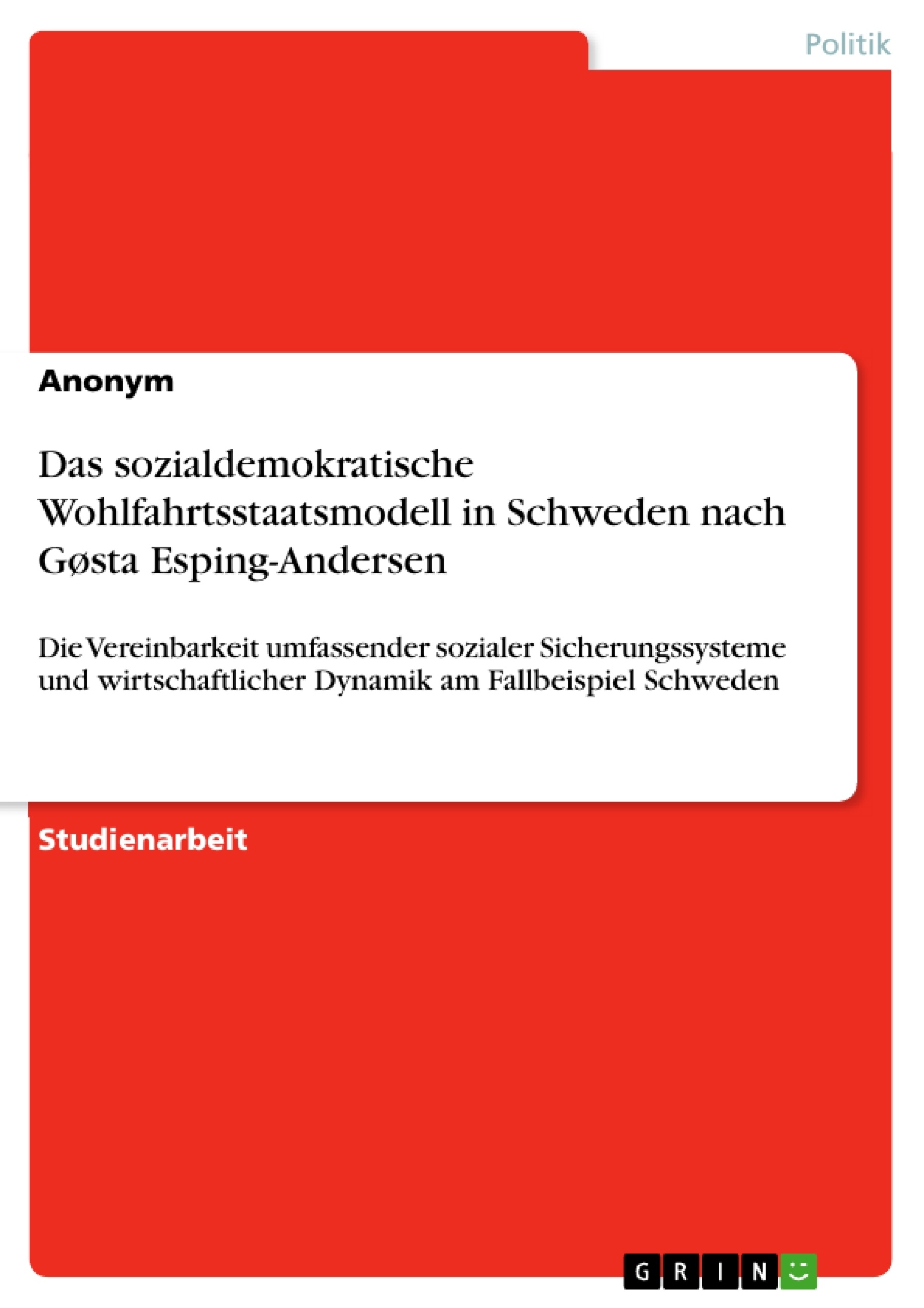Die vorliegende Seminararbeit befasst sich mit der Vereinbarkeit von umfassenden sozialen Sicherungssystemen und einem effizienten Wirtschaftssystem. Intuitiv würde man einem ausgeprägten Wohlfahrtsstaat mit weitreichenden sozialen Dienst- und Geldleistungen wohl nicht unbedingt eine hohe Wirtschaftskraft zusprechen – sondern diese eher von besonders liberalen Staatsmodellen erwarten. Diesem unterbewussten „Bauchgefühl“ soll in dieser Arbeit durch die wissenschaftliche Analyse des Fallbeispiels Schweden überprüft werden.
Dem Wirtschafts- und Sozialmodell der nordischen Länder insgesamt wird nachgesagt, ein hohes Maß an Verteilungsgerechtigkeit und wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit zu verbinden. Sie vereinen ökonomische Merkmale, die im „Mainstream“ der Wirtschaftswissenschaften als kaum vereinbar gelten, denn laut der „reinen“ Volkswirtschaftslehre werden dynamische, innovative Märkte vor allem durch eine zurückhaltende Staatlichkeit und ein gewisses Maß ökonomischer Ungleichheit ermöglicht und gefördert. Im Norden hingegen gelten die Volkswirtschaften im überdurchschnittlichen Maße als „gemischt“, das heißt die Rolle des Staates im Wirtschaftsleben ist in vergleichender Perspektive sehr stark ausgeprägt. Die besondere Kombination aus relativ hoher ökonomischer Wettbewerbsfähigkeit, der weitreichenden Egalität beziehungsweise Universalität, dem ausgeprägten sozialen Leistungsumfang und der starken Rolle des Staates im Wirtschaftsleben machen einen Blick auf die Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik der nordischen Länder lohnenswert.
Gerade die Betrachtung des Beispiels Schwedens kann interessant sein, da Schweden nach der schweren Wirtschaftskrise in den frühen 1990er Jahren schon seit dem neuen Jahrtausend (zusammen mit Dänemark und den Niederlanden) wieder als Modell einer Alternative zum liberal-angelsächsischen Modell gilt. Insgesamt zeigte Skandinavien im Vergleich zu anderen Ländern (viele verblieben von 2001 bis 2005 in einer Phase der wirtschaftlichen Stagnation) ein robustes Wachstum, rückte schnell wieder in die Spitzengruppe innovativer Länder auf und hielt sein Sozialstaatsniveau trotz einiger „Krisenpakete“ zur Stabilisierung der Wirtschaft aufrecht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Begriffsdefinitionen und theoretischer Rahmen
- 2.1 Wohlfahrtsstaat nach Esping-Andersen
- 2.2 Die drei Wohlfahrtsregime
- 3. Fallbeispiel Schweden
- 3.1 Schweden als idealtypisches Modell des sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaats
- 3.2 Wirtschaftsindikatoren Schwedens
- 4. Abschließende Bewertung: Wirtschaftliche Dynamik trotz oder aufgrund von umfassender sozialer Sicherung?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Vereinbarkeit umfassender sozialer Sicherungssysteme mit wirtschaftlicher Dynamik am Beispiel Schwedens. Sie hinterfragt die intuitive Annahme, dass ein starker Wohlfahrtsstaat wirtschaftliche Stärke behindert. Die Arbeit analysiert, ob Schweden trotz oder gerade wegen seines sozialdemokratischen Wohlfahrtsmodells wirtschaftlich erfolgreich ist.
- Vereinbarkeit von sozialer Sicherheit und wirtschaftlicher Dynamik
- Das sozialdemokratische Wohlfahrtsmodell nach Esping-Andersen
- Schweden als Fallbeispiel eines sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaats
- Analyse schwedischer Wirtschaftsindikatoren
- Die Rolle des Staates in der schwedischen Wirtschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Arbeit untersucht die scheinbar widersprüchliche Verbindung zwischen einem starken Wohlfahrtsstaat und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. Am Beispiel Schwedens, das als Modell eines sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaats gilt, wird analysiert, ob und wie umfassende soziale Sicherungssysteme mit wirtschaftlicher Dynamik vereinbar sind. Die Arbeit hinterfragt die gängige Annahme, dass liberale Staatsmodelle wirtschaftlich erfolgreicher sind als Modelle mit ausgeprägten sozialen Sicherungssystemen. Schwedens Entwicklung nach der Wirtschaftskrise der 1990er Jahre dient als empirische Grundlage, um diese These zu überprüfen.
2. Begriffsdefinitionen und theoretischer Rahmen: Dieses Kapitel definiert den Begriff des Wohlfahrtsstaates nach Esping-Andersen und beschreibt seine drei Wohlfahrtsregime: das liberale, das konservativ-korporatistische und das sozialdemokratische. Es legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse des schwedischen Modells, indem es die zentralen Merkmale der drei Regime herausarbeitet und deren jeweilige Stärken und Schwächen in Bezug auf soziale Sicherheit und wirtschaftliche Effizienz beleuchtet. Dies bildet die Basis für die spätere Einordnung Schwedens in eines dieser Regime und die Bewertung seiner wirtschaftlichen Performance im Kontext seines sozialen Sicherungssystems.
3. Fallbeispiel Schweden: Dieses Kapitel präsentiert Schweden als Fallbeispiel für einen sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat. Es beschreibt die charakteristischen Merkmale des schwedischen Sozialsystems, seine umfassende soziale Absicherung und die starke Rolle des Staates in der Wirtschaft. Durch die Analyse relevanter Wirtschaftsindikatoren, wie z.B. BIP pro Kopf, Arbeitslosenquote und Einkommensungleichheit, wird die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Schwedens beleuchtet. Der Fokus liegt darauf, die scheinbar gegensätzlichen Aspekte eines starken Wohlfahrtsstaates und einer dynamischen Wirtschaft zu vereinen und zu zeigen, ob ein Zusammenhang zwischen beiden besteht.
Schlüsselwörter
Sozialdemokratisches Wohlfahrtsstaatsmodell, Gøsta Esping-Andersen, Schweden, soziale Sicherungssysteme, wirtschaftliche Dynamik, Wirtschaftsindikatoren, Verteilungsgerechtigkeit, Wohlfahrtsregime, Staatsintervention.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Schweden – Wohlfahrtsstaat und wirtschaftliche Dynamik
Was ist das Thema der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Vereinbarkeit von umfassenden sozialen Sicherungssystemen mit wirtschaftlicher Dynamik am Beispiel Schwedens. Sie hinterfragt die Annahme, dass ein starker Wohlfahrtsstaat die wirtschaftliche Stärke behindert und analysiert, ob Schweden trotz oder gerade wegen seines sozialdemokratischen Wohlfahrtsmodells wirtschaftlich erfolgreich ist.
Welche Aspekte werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Vereinbarkeit von sozialer Sicherheit und wirtschaftlicher Dynamik, das sozialdemokratische Wohlfahrtsmodell nach Esping-Andersen, Schweden als Fallbeispiel, die Analyse schwedischer Wirtschaftsindikatoren und die Rolle des Staates in der schwedischen Wirtschaft.
Welche Struktur hat die Seminararbeit?
Die Seminararbeit gliedert sich in eine Einführung, ein Kapitel zu Begriffsdefinitionen und dem theoretischen Rahmen (inkl. Esping-Andersens Wohlfahrtsregime), ein Kapitel zum Fallbeispiel Schweden (inkl. Wirtschaftsindikatoren) und eine abschließende Bewertung.
Wie wird der Wohlfahrtsstaat in der Arbeit definiert?
Der Wohlfahrtsstaat wird nach dem Modell von Gøsta Esping-Andersen definiert, welches drei Wohlfahrtsregime unterscheidet: das liberale, das konservativ-korporatistische und das sozialdemokratische. Die Arbeit beschreibt die zentralen Merkmale dieser Regime und deren Stärken und Schwächen.
Welche Rolle spielt Schweden in der Arbeit?
Schweden dient als Fallbeispiel für einen sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat. Die Arbeit analysiert die charakteristischen Merkmale des schwedischen Sozialsystems, seine umfassende soziale Absicherung und die starke Rolle des Staates in der Wirtschaft anhand von Wirtschaftsindikatoren wie BIP pro Kopf, Arbeitslosenquote und Einkommensungleichheit.
Welche Wirtschaftsindikatoren werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert relevante Wirtschaftsindikatoren, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Schwedens zu beleuchten. Konkrete Beispiele werden im Kapitel zum Fallbeispiel Schweden genannt (z.B. BIP pro Kopf, Arbeitslosenquote und Einkommensungleichheit).
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die abschließende Bewertung untersucht, ob die wirtschaftliche Dynamik Schwedens trotz oder gerade wegen seines umfassenden sozialen Sicherungssystems besteht. Sie prüft die These, ob liberale Staatsmodelle tatsächlich wirtschaftlich erfolgreicher sind als Modelle mit ausgeprägten sozialen Sicherungssystemen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sozialdemokratisches Wohlfahrtsstaatsmodell, Gøsta Esping-Andersen, Schweden, soziale Sicherungssysteme, wirtschaftliche Dynamik, Wirtschaftsindikatoren, Verteilungsgerechtigkeit, Wohlfahrtsregime, Staatsintervention.
Für wen ist diese Seminararbeit bestimmt?
Diese Seminararbeit ist für akademische Zwecke bestimmt und dient der Analyse von Themen im Zusammenhang mit Wohlfahrtsstaaten und wirtschaftlicher Entwicklung.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2016, Das sozialdemokratische Wohlfahrtsstaatsmodell in Schweden nach Gøsta Esping-Andersen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/333995