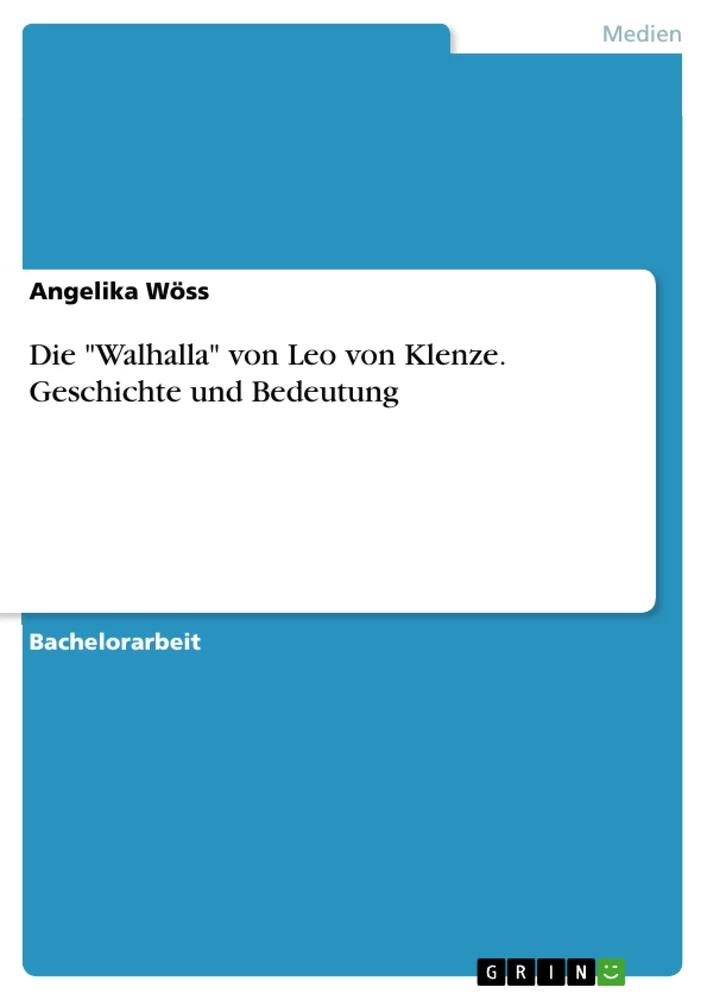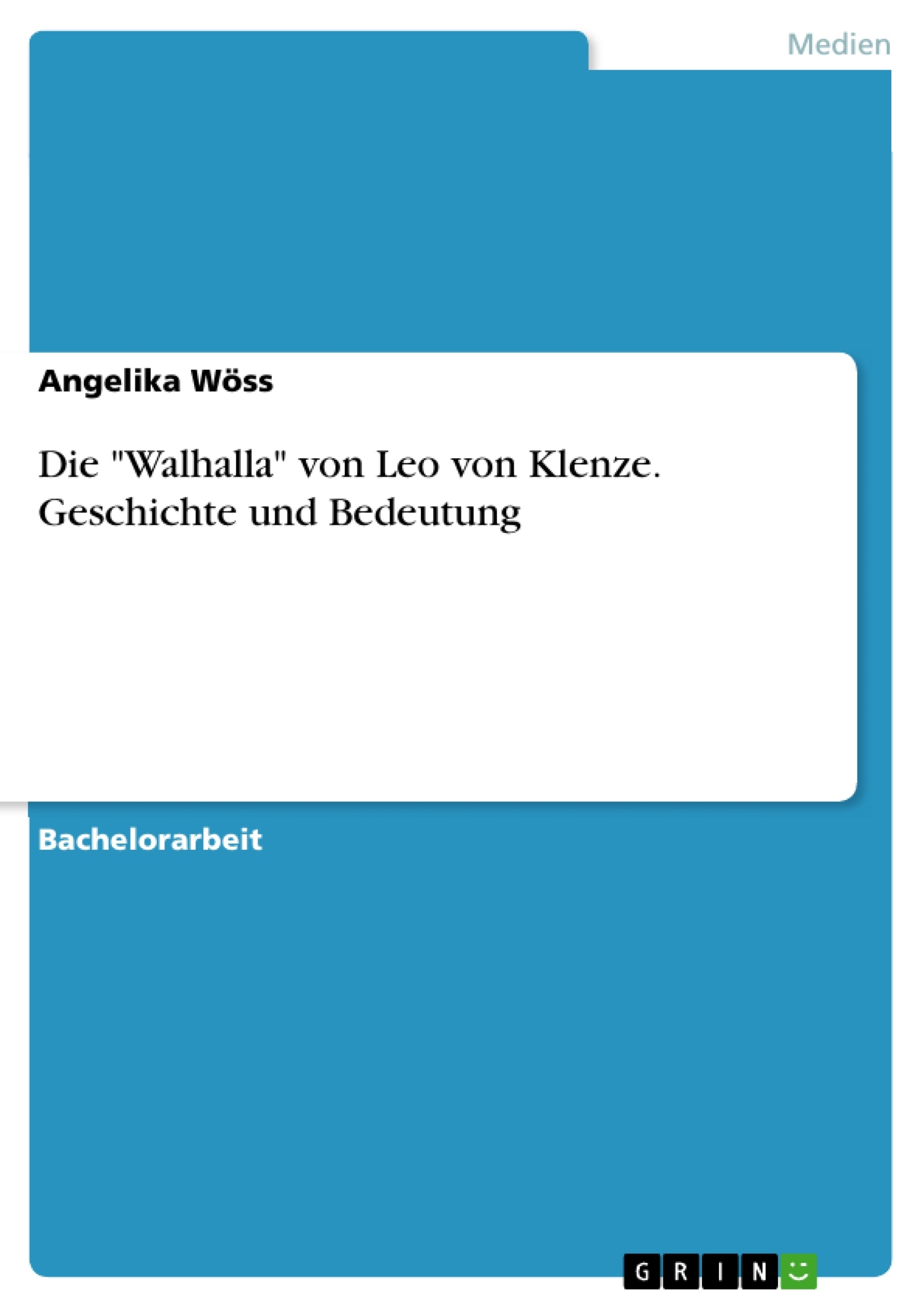In der vorliegenden Arbeit werden ein Überblick über den Forschungstand und eine Definition des Begriffes „Walhalla“, sowie allgemeine Informationen über den Architekten Leo von Klenze, über den Auftraggeber Ludwig I. von Bayern und das etwas schwierige Verhältnis zwischen den beiden dargelegt. Nach der Schilderung der Entstehung sowie der Baubeschreibung der Walhalla wird näher auf die so genannte „Walhalla-Idee“, die Wahl des Stils und die verschiedenen metaphorischen Bedeutungsebenen in der architektonischen Ausgestaltung eingegangen.
Um den Bau der Walhalla historisch verorten zu können, werden verschiedenste Vorläufer vorgestellt, welche unterschiedliche Anregungen und Inspirationen zur Walhalla lieferten, sowie auch Nachwirkungen und Rezeption der Walhalla-Idee veranschaulicht.
In der Arbeit sollen neben den Fakten zur Walhalla vor allem ihr Zweck als ein Nationaldenkmal sowie ihre Verkörperung einer ästhetischen und poetischen Idee verdeutlicht werden.
Die Walhalla bei Regensburg ist vermutlich das noch heute eindrucksvollste deutsche Nationaldenkmal des 19. Jahrhunderts. Der am griechischen Parthenon orientierte Bau erhebt sich auf dem Bräuberg bei Donaustauf, neun Kilometer donauabwärts von Regensburg entfernt. Initiiert wurde er von König Ludwig I. von Bayern und erbaut von seinem Hofarchitekten Leo von Klenze. Die Idee dahinter war, im Sinne einer deutschen Einheit die berühmtesten Deutschen in Büstenform zu präsentieren und zu ehren. Im Inneren des Tempels werden heute 130 Büsten und 64 Gedenktafeln verschiedener bedeutender Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft und Kunst beherbergt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitendes
- Forschungsstand
- Begriff „Walhalla“
- Architekt und Bauherr
- Leo von Klenze
- Ludwig I. von Bayern und seine Kunstpolitik
- Vorgeschichte
- Kunstpolitik
- Leo von Klenze und Ludwig I. von Bayern
- Entstehungsgeschichte der Walhalla
- Vorgeschichte
- Erste Entwürfe
- Rundbauprojekte
- Die Halle der Erwartung
- Standortwahl
- Baugeschichte
- Baubeschreibung der Walhalla
- Außenansicht
- Innenansicht
- Idee und Zweck der Walhalla
- Gleichheit im Büstenprogramm
- Nationale Einheit
- Monarchisches Denkmal
- Zur Wahl des Stils
- Ursprünge und Vorläufer der Walhalla
- Antike Vorläufer
- Allgemeine antike Vorbilder
- Vorbilder für den Unterbau
- Hypogaion
- Verhältnis von Bauwerk und Landschaft in der Antike
- Neuzeitliche Vorläufer
- Ideelle Vorläufer in Malerei und Literatur
- Ideelle architektonische Vorläufer
- Naturbezug und Landschaftsgarten
- Ikonologische, ikonographische und metaphorische Bedeutungsebenen der Walhalla
- Allgemeine Ikonologie und Ikonographie
- Inneres
- Germanische Ikonographie im Inneren
- Karyatiden und Senkgiebel
- Walhallafries
- Viktorien und Ruhmesgenien
- Ikonologie und Ikonographie des Äußeren
- Giebel
- Außenbau
- Halle der Erwartung
- Einbindung in einen Kult
- Innenraum als Kirche
- Offenes Denkmal
- Landschaftlicher Bezug
- Variatio der Ansichten
- Metaphorische Wanderung
- Nachwirkungen der Walhalla und Vergleiche
- Rezeption
- Abschließendes
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Walhalla bei Regensburg, ein bedeutendes deutsches Nationaldenkmal des 19. Jahrhunderts. Ziel ist es, die Entstehungsgeschichte, die architektonische Gestaltung und die ideologische Bedeutung des Bauwerks im Kontext der Kunstpolitik König Ludwigs I. von Bayern und der Arbeit seines Hofarchitekten Leo von Klenze zu beleuchten. Die Arbeit analysiert die vielfältigen Einflüsse und Vorläufer, die zur Gestaltung der Walhalla beigetragen haben und untersucht die Symbolik und die verschiedenen Bedeutungsebenen des Bauwerks.
- Die Entstehungsgeschichte der Walhalla und die Rolle von Ludwig I. und Leo von Klenze
- Die architektonische Gestaltung der Walhalla und ihre antiken Vorbilder
- Die ideologische Bedeutung der Walhalla als Nationaldenkmal
- Die metaphorischen und symbolischen Ebenen der Walhalla
- Die Rezeption und Nachwirkungen der Walhalla
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitendes: Die Einleitung stellt die Walhalla als eindrucksvolles deutsches Nationaldenkmal des 19. Jahrhunderts vor und gibt einen kurzen Überblick über den Forschungsstand, beginnend mit den frühen Schriften Ludwigs I. und Leo von Klenzes bis hin zu den umfangreichen Arbeiten von Jörg Traeger. Sie skizziert die zentralen Fragestellungen der Arbeit und ihren Fokus auf die Entstehung, Gestaltung und Bedeutung der Walhalla.
Architekt und Bauherr: Dieses Kapitel präsentiert detaillierte Informationen über Leo von Klenze, den Architekten der Walhalla, sowie über König Ludwig I. von Bayern, den Bauherrn. Es beleuchtet die Kunstpolitik Ludwigs I. und das Arbeitsverhältnis zwischen Klenze und dem König, welches durch die anspruchsvollen Wünsche Ludwigs I. und die kreativen, mitunter auch kompromissbereiten Lösungen Klenzes gekennzeichnet war.
Entstehungsgeschichte der Walhalla: Dieses Kapitel verfolgt die Entwicklung der Walhalla von der ersten Idee bis zur Fertigstellung. Es beschreibt die verschiedenen Planungs- und Bauphasen, einschließlich der Veränderungen der Konzeption und der Herausforderungen, die Klenze während des Prozesses meistern musste. Die Auseinandersetzung mit den frühen Entwürfen und der Wahl des Standortes geben wichtige Einblicke in die Entstehung des Bauwerks.
Baubeschreibung der Walhalla: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Beschreibung der Architektur der Walhalla, sowohl der Außen- als auch der Innenansicht. Es analysiert die detaillierte Gestaltung des Bauwerks und zeigt auf, wie Klenze antike Vorbilder mit eigenen Gestaltungselementen verband, um ein einzigartiges und imposantes Gebäude zu schaffen. Die Beschreibung umfasst den Unterbau, das Äußere und das Innere der Walhalla und deren Zusammenspiel.
Idee und Zweck der Walhalla: Dieser Abschnitt befasst sich eingehend mit dem Konzept und der Absicht hinter dem Bau der Walhalla. Es werden die verschiedenen Bedeutungsaspekte diskutiert – die Idee der nationalen Einheit, die Präsentation herausragender Persönlichkeiten, sowie die Rolle des Bauwerks als monarchisches Denkmal. Das Kapitel beleuchtet den Versuch, mittels der Walhalla eine spezifische Geschichtsinterpretation zu vermitteln.
Zur Wahl des Stils: Diese Kapitel analysiert die bewusste Entscheidung für einen griechischen Tempelstil und untersucht die Gründe für diese Wahl im Kontext der damaligen Zeit und der gewünschten Symbolik. Es wird dargelegt, wie Klenze den antiken Stil interpretierte und adaptierte, um ihn für den Zweck der Walhalla einzusetzen.
Ursprünge und Vorläufer der Walhalla: Dieser Abschnitt präsentiert eine eingehende Untersuchung der antiken und neuzeitlichen Vorläufer der Walhalla. Es wird analysiert, wie Klenze Inspirationen aus verschiedenen Quellen schöpfte, sowohl in der Architektur als auch in der Malerei und Literatur, um seine Vision zu verwirklichen. Der Fokus liegt auf den vielfältigen Einflüssen, die das Design der Walhalla prägten.
Schlüsselwörter
Walhalla, Leo von Klenze, Ludwig I. von Bayern, Nationaldenkmal, griechischer Tempel, Architektur, Kunstpolitik, nationale Einheit, Ikonographie, Metaphorik, Antike, Vorbilder, Landschaftsgestaltung.
Häufig gestellte Fragen zur Walhalla
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet eine umfassende Auseinandersetzung mit der Walhalla bei Regensburg. Sie untersucht die Entstehungsgeschichte, die Architektur, die ideologische Bedeutung und die Symbolik des Bauwerks im Kontext der Kunstpolitik König Ludwigs I. von Bayern und der Arbeit seines Hofarchitekten Leo von Klenze. Der Text beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und Schlüsselwörter.
Wer waren die wichtigsten Akteure beim Bau der Walhalla?
Die wichtigsten Akteure waren König Ludwig I. von Bayern (Bauherr) und Leo von Klenze (Architekt). Die Arbeit beleuchtet die Kunstpolitik Ludwigs I. und die enge Zusammenarbeit zwischen ihm und Klenze, einschließlich der Herausforderungen und Kompromisse während des Bauprozesses.
Welche architektonischen Stile und Vorbilder beeinflussten die Walhalla?
Die Walhalla ist im griechischen Tempelstil erbaut. Die Arbeit analysiert die bewusste Wahl dieses Stils und untersucht detailliert die antiken und neuzeitlichen Vorbilder, die Klenze bei der Gestaltung des Bauwerks beeinflussten. Dies beinhaltet sowohl architektonische Vorbilder als auch Einflüsse aus Malerei und Literatur.
Welche ideologische Bedeutung hatte die Walhalla?
Die Walhalla war als Nationaldenkmal konzipiert, das die nationale Einheit Deutschlands symbolisieren sollte. Die Arbeit untersucht die verschiedenen Bedeutungsebenen des Bauwerks, darunter die Präsentation herausragender Persönlichkeiten und die Rolle als monarchisches Denkmal. Die spezifische Geschichtsinterpretation, die durch die Walhalla vermittelt werden sollte, wird ebenfalls analysiert.
Wie ist die Walhalla aufgebaut und gestaltet?
Der Text bietet eine detaillierte Baubeschreibung, sowohl der Außen- als auch der Innenansicht. Er analysiert die Gestaltung des Bauwerks, das Zusammenspiel von Unterbau, Außen- und Innenbereich und die Verwendung antiker Vorbilder im Kontext der eigenen Gestaltungselemente Klenzes. Die Ikonographie und Symbolik der Walhalla, einschließlich des Walhallafrieses, der Karyatiden und der Ruhmesgenien, werden ebenfalls untersucht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu folgenden Themen: Einleitendes, Architekt und Bauherr, Entstehungsgeschichte der Walhalla, Baubeschreibung der Walhalla, Idee und Zweck der Walhalla, Zur Wahl des Stils, Ursprünge und Vorläufer der Walhalla, Ikonologische, ikonographische und metaphorische Bedeutungsebenen der Walhalla, Nachwirkungen der Walhalla und Vergleiche, Rezeption und Abschließendes. Jedes Kapitel wird im Text kurz zusammengefasst.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Walhalla, Leo von Klenze, Ludwig I. von Bayern, Nationaldenkmal, griechischer Tempel, Architektur, Kunstpolitik, nationale Einheit, Ikonographie, Metaphorik, Antike, Vorbilder, Landschaftsgestaltung.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke gedacht und dient der Analyse von Themen im Zusammenhang mit der Walhalla auf strukturierte und professionelle Weise. Die OCR-Daten sind nur für die akademische Nutzung bestimmt.
- Citar trabajo
- Angelika Wöss (Autor), 2012, Die "Walhalla" von Leo von Klenze. Geschichte und Bedeutung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/333972