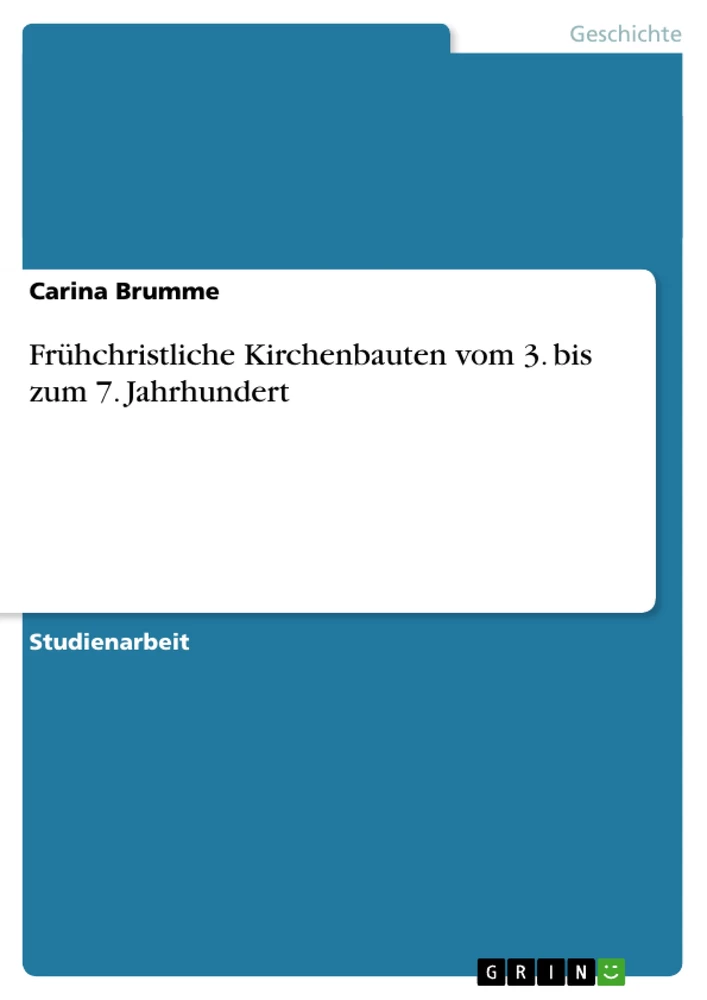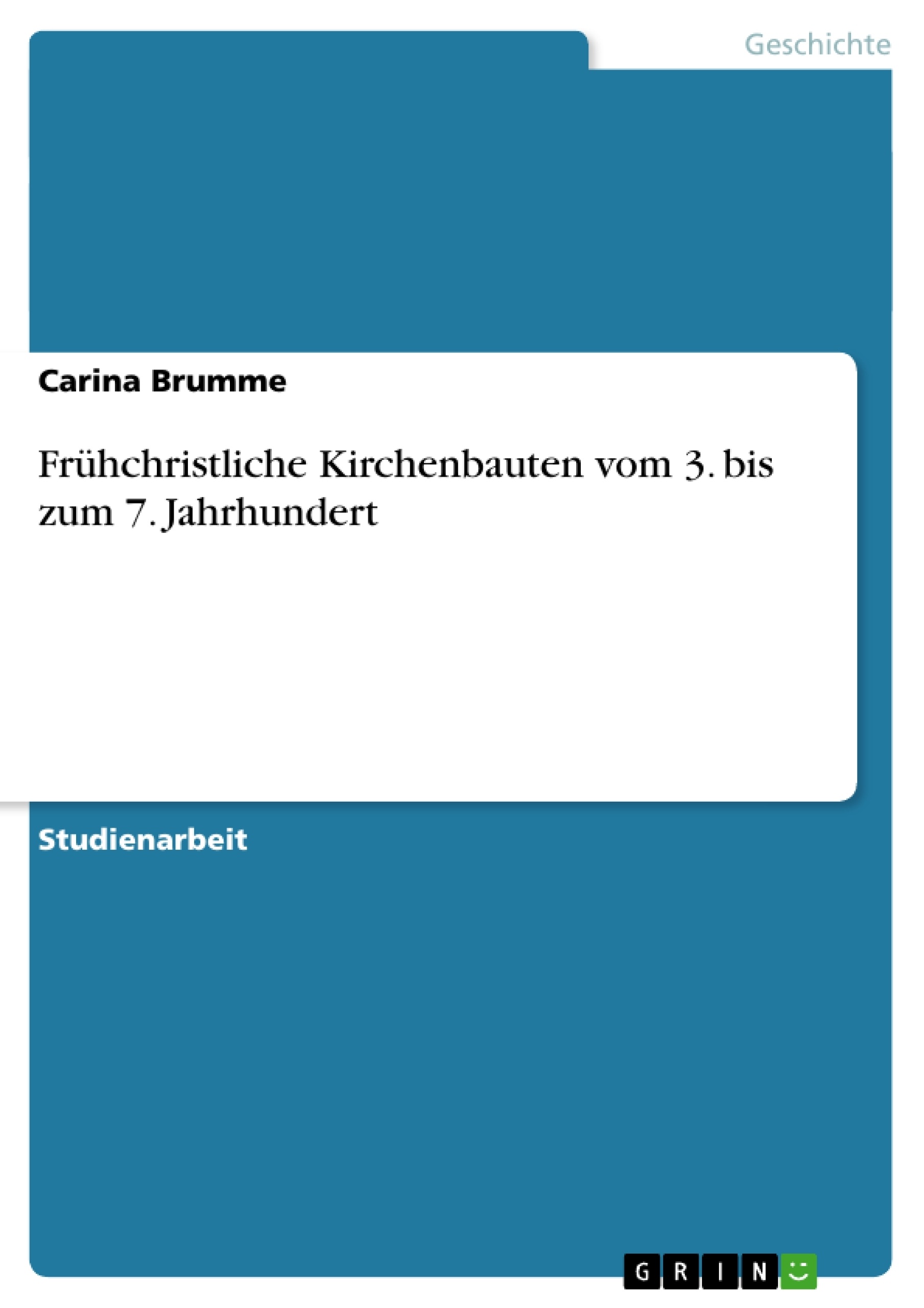Die vorliegende Arbeit möchte wesentliche Grundzüge des frühchristlichen Kirchenbaus im römischen Imperium, von den Anfängen im 3. Jh. n. Chr. bis zur allmählichen Durchsetzung der römisch-katholischen Kirche im weströmischen Reich im 7. Jh., an verschiedenen Exempeln und in vergleichender Betrachtung zum liturgischen Hintergrund, vorstellen.
Zentrale Themen werden der Einfluss der Liturgie auf die Gestalt der Kirchenbauten und im II. Teil die diversen Arten von christlichen Sakralbauten, unterschieden nach ihrer Funktion und im Falle der germanischen Eigenkirchen auch nach ihrer Trägerschaft sein. Angesprochen werden als funktional zu unterscheidende Typen: Hauskirchen, Bischofs- und Gemeindekirchen, Memorialkirche, Eigenkirche und Wallfahrtszentren. Um das Thema einzugrenzen, wird der Fokus auf der Entwicklung des Kirchenbaues ab dem 4. Jh. im gut dokumentierten Alpengebiet mit den angrenzenden Gebieten und auf Rom, besonders in Hinsicht auf die Monumentalbauten, liegen.
Zum Ende soll ein kurzer Exkurs zu den großen Wallfahrtszentren des 4. Jh. in Palästina und Syrien, sowie ein Blick auf die christlichen Sakralbauten im oströmischen Reich, den Überblick über die frühchristlichen Sakralbauten abrunden.
Ziel der Ausführungen ist es letztlich, die wichtigsten verschiedenen Bautypen funktional einzuordnen und dort, wo sich am Baukörper Rückschlüsse auf die Funktion, Liturgie oder besondere Trägerschaft ziehen lassen, diese darzustellen. Der große Formenreichtum wird eine generelle Zuordnung von Bautypen nur insofern ermöglichen, als man grobe, generelle Tendenzen und Strukturen aufzeigen kann.
Alle im Text angesprochenen Bauten erscheinen in einem Katalog im Anhang mit den wichtigsten Grunddaten (Dimensionen, Typus, Datierung, Standort, Material etc.) und einer Abbildung. Eine ausführliche Beschreibung der Objekte im Text wird meist entfallen, da das Ziel ein Überblick über die frühen Bauten sein soll.
Das frühchristliche Klosterwesen wird nicht mit in die Betrachtungen aufgenommen, da dieses Thema so umfangreich ist, dass es eine eigene Bearbeitung erfahren müsste.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsgeschichte
- Historische Entwicklung des frühen Christentums von den Anfängen bis zum 7. Jh.
- Liturgiegeschichtliche und funktionale Betrachtung von frühen Kirchenbauten
- Die Taufe
- Die Eucharistie und der Wortgottesdienst
- Märtyrerverehrung
- Früher Kirchenbau vom 3. Jh. - 7. Jh.
- Frühe Gemeinde- und Bischofskirchen
- Frühe Hauskirchen
- Längsbauten - Basiliken und Saalkirchen
- Saalkirchen
- Doppelanlagen
- Basiliken
- Zentralbau - Baptisterien
- Bauten der konstantinischen und nachkonstantinischen Zeit
- Memorial- und Eigenkirchen
- Memorialkirchen
- Die Eigenkirchen
- Exkurs: Entwicklung im byzantinischen Raum und in Nordafrika ab dem 5. Jh.
- Kuppelbau
- Christliche Kultbauten in Nordafrika
- Fazit
- Entwicklung des Kirchenbaus ab dem 4. Jh. im Alpengebiet mit den angrenzenden Gebieten und in Rom
- Funktionale Einordnung der wichtigsten Bautypen
- Beziehung zwischen Baukörper, Funktion, Liturgie und Trägerschaft
- Generelle Tendenzen und Strukturen im Formenreichtum des frühchristlichen Kirchenbaus
- Exkurs zu den großen Wallfahrtszentren des 4. Jh. in Palästina und Syrien sowie ein Blick auf die christlichen Sakralbauten im oströmischen Reich
- Einleitung: Diese Einleitung gibt einen Überblick über die Thematik der Arbeit und ihre Zielsetzung. Sie beleuchtet die Zeitspanne, die verschiedenen Bautypen und die geografischen Schwerpunkte. Außerdem werden die Grenzen der Arbeit definiert und der Aufbau der Arbeit erläutert.
- Forschungsgeschichte: Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über die Entwicklung der Forschung zu frühchristlichen Zeugnissen. Es zeigt die wichtigsten Forschungsstränge auf, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, und beleuchtet die Entwicklung der christlichen Archäologie als eigenständige Disziplin.
- Historische Entwicklung des frühen Christentums: Dieses Kapitel beleuchtet die historischen Entwicklungen im frühen Christentum, die für die Entstehung und Entwicklung des frühchristlichen Kirchenbaus relevant sind. Es konzentriert sich auf die Zeitspanne von den Anfängen des Christentums bis zum 7. Jh., die den Fokus der Arbeit bildet.
- Liturgiegeschichtliche und funktionale Betrachtung: Dieses Kapitel betrachtet die frühchristlichen Kirchenbauten aus liturgiegeschichtlicher und funktionaler Perspektive. Es analysiert die wichtigsten liturgischen Handlungen wie die Taufe, die Eucharistie und die Märtyrerverehrung und deren Einfluss auf die Form und Gestaltung der Kirchenbauten.
- Früher Kirchenbau: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entwicklung des frühen Kirchenbaus vom 3. bis zum 7. Jh. Es untersucht verschiedene Bautypen wie Gemeinde- und Bischofskirchen, Hauskirchen, Längsbauten (Basiliken und Saalkirchen) und Zentralbauten (Baptisterien).
- Bauten der konstantinischen und nachkonstantinischen Zeit: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Entwicklung des Kirchenbaus in der Zeit nach Konstantin dem Großen, einem wichtigen Wendepunkt in der Geschichte des Christentums. Es analysiert die Bauwerke dieser Zeit und ihren Einfluss auf die weitere Entwicklung des Kirchenbaus.
- Memorial- und Eigenkirchen: Dieses Kapitel befasst sich mit den Memorialkirchen, die an Märtyrer oder Heilige erinnern, und den Eigenkirchen, die von Privatpersonen oder Familien erbaut wurden. Es beleuchtet die Besonderheiten dieser Bauwerke und ihre Bedeutung für die Geschichte des frühchristlichen Kirchenbaus.
- Exkurs: Entwicklung im byzantinischen Raum und in Nordafrika: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entwicklung des Kirchenbaus im byzantinischen Raum und in Nordafrika ab dem 5. Jh. Es analysiert die Besonderheiten des Kuppelbaus in der byzantinischen Architektur und die Entwicklung christlicher Kultbauten in Nordafrika.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den Grundzügen des frühchristlichen Kirchenbaus im römischen Imperium vom 3. bis zum 7. Jh., indem sie verschiedene Beispiele in vergleichender Betrachtung zum liturgischen Hintergrund vorstellt. Die Arbeit konzentriert sich auf den Einfluss der Liturgie auf die Gestalt der Kirchenbauten und analysiert verschiedene Arten von christlichen Sakralbauten, unterschieden nach ihrer Funktion und, im Falle der germanischen Eigenkirchen, auch nach ihrer Trägerschaft.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem frühchristlichen Kirchenbau, dem Einfluss der Liturgie auf die Architektur, verschiedenen Bautypen wie Hauskirchen, Bischofskirchen, Memorialkirchen und Eigenkirchen, der Entwicklung des Kirchenbaus im Alpenraum und in Rom, sowie dem Vergleich mit Entwicklungen im byzantinischen Raum und in Nordafrika.
- Citar trabajo
- Carina Brumme (Autor), 2004, Frühchristliche Kirchenbauten vom 3. bis zum 7. Jahrhundert, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33291