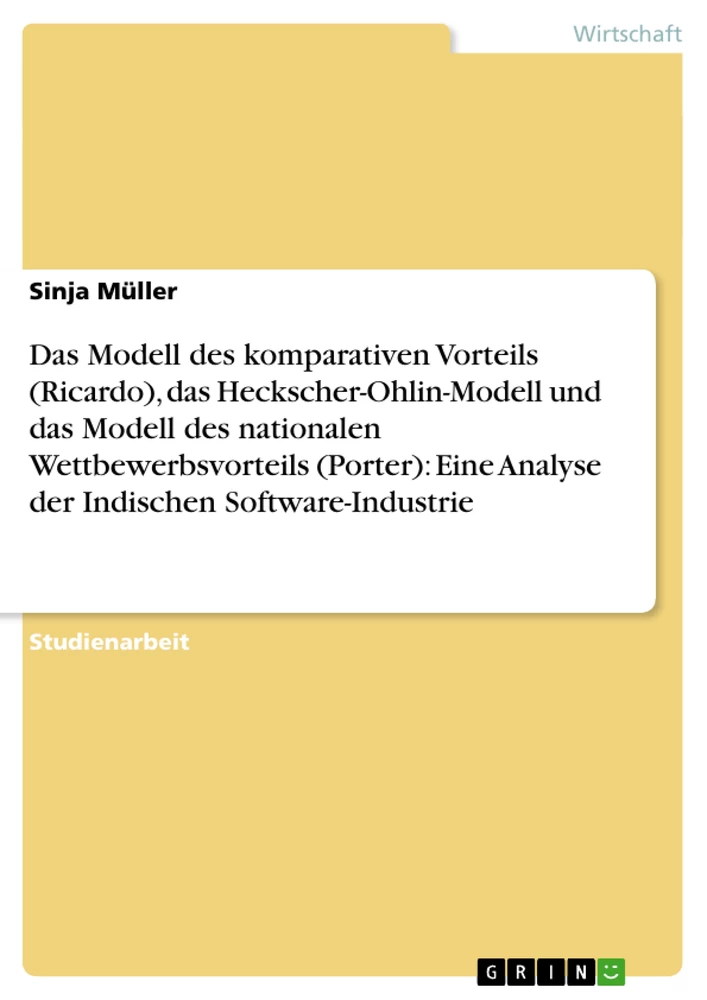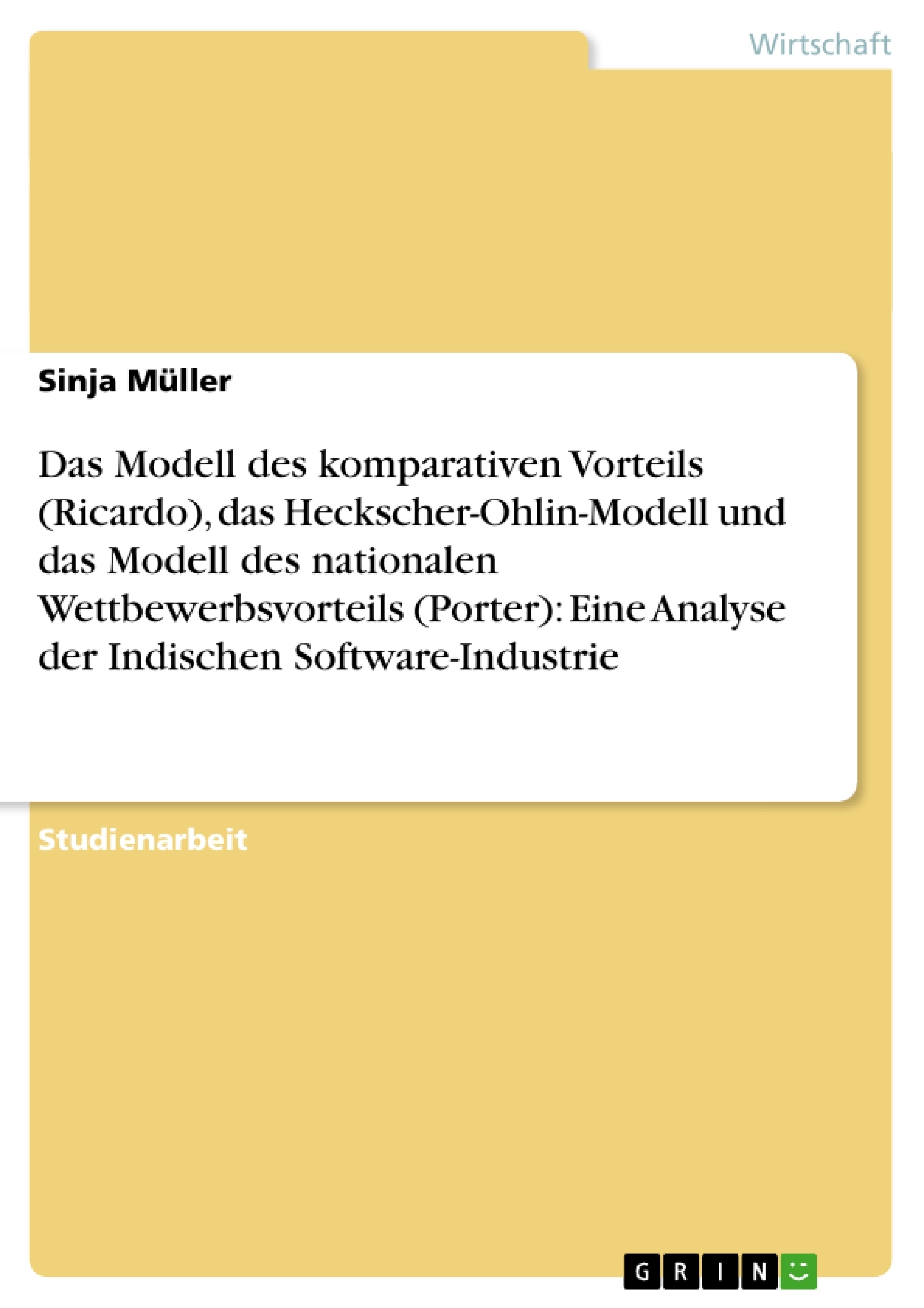Indien, allgemein als relativ armes Land bekannt, hat sich in den letzten Jahren zu einer wichtigen Kraft in der globalen Software Industrie entwickelt. 1998 gab es 558 Softwarefirmen mit 250.000 – 280.000 Software-Ingenieuren. Im Jahr 2000 ist die Zahl schon auf ca.1000 Firmen angestiegen. Die indische Software Industrie wird von der Weltbank als eine der dynamischsten der Welt bezeichnet, mit Umsätzen von ca. 6 Milliarden US-Dollar im Jahre 2000. In den letzten fünf Jahren lag die jährliche Wachstumsrate jeweils über 50 Prozent, wobei Exporte wesentlich schneller zunahmen als der Absatz im Inland. Indische Softwareunternehmen beliefern Kunden in 91 Ländern, wobei 61 Prozent der Exporte in die USA und weitere 20 Prozent (580 Millionen US-Dollar) nach Europa gehen. Die Exporteinnahmen lagen 1985 noch unter 10 Millionen US-Dollar und nahmen im Jahr 2000 schon einen Wert von 4 Milliarden US-Dollar an.
Der Wachstumstrend in diesem Sektor spiegelt sich in dem wachsenden Volumen der Investitionen in die indischen Software Entwicklungsgeschäfte von ausländischen Firmen wider. Große Softwarefirmen wie Microsoft und SAP unterhalten in Indien Tochterunternehmen, die an ihren Programmpaketen mitarbeiten oder in der Anpassung an die speziellen Bedürfnisse der Region eingesetzt werden. 200 der 1000 weltweit größten Firmen decken ihren Softwarebedarf in Indien. Was hat zu dieser überraschenden Entwicklung eines besonders modernen Exportsektors in einem Land geführt, das in vielen Regionen noch immer von tiefer Armut, sozialer Ungerechtigkeit und Rückständigkeit geprägt ist? Anhand der Theorien von Ricardo, Heckscher-Ohlin und Porter wird im Folgenden der Aufstieg der Software-Industrie in Indien näher erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Das Modell des komparativen Vorteils
- 2.1 Anwendung des Modells auf die Indische Software-Industrie
- 3 Das Heckscher-Ohlin-Modell
- 3.1 Anwendung des Modells auf die Indische Software-Industrie
- 4 Porters Modell des nationalen Wettbewerbsvorteils
- 4.1 Anwendung des Modells auf die Indische Software-Industrie
- 5 Vergleich der Theorien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den rasanten Aufstieg der indischen Softwareindustrie anhand dreier internationaler Handelstheorien: dem Modell des komparativen Vorteils (Ricardo), dem Heckscher-Ohlin-Modell und dem Modell des nationalen Wettbewerbsvorteils (Porter). Ziel ist es, die Schlüsselfaktoren für den Erfolg der indischen Softwareindustrie zu identifizieren und zu erklären.
- Komparativer Vorteil Indiens in der Softwareentwicklung
- Rolle von Faktorproportionen (Heckscher-Ohlin)
- Nationale Wettbewerbsvorteile der indischen Softwareindustrie
- Vergleich der drei Theorien in Bezug auf die indische Softwareindustrie
- Analyse der Produktivitätsunterschiede und Lohnkosten
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt den bemerkenswerten Aufstieg der indischen Softwareindustrie, von 558 Firmen im Jahr 1998 auf ca. 1000 im Jahr 2000, mit einem Umsatz von ca. 6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2000 und einer jährlichen Wachstumsrate von über 50 Prozent. Der Fokus liegt auf dem überraschenden Erfolg dieses modernen Exportsektors in einem Land, das in vielen Regionen noch von Armut und sozialer Ungerechtigkeit geprägt ist. Die Arbeit kündigt die Analyse dieses Aufstiegs anhand der Theorien von Ricardo, Heckscher-Ohlin und Porter an.
2 Das Modell des komparativen Vorteils: Dieses Kapitel erläutert Ricardos Theorie des komparativen Vorteils, die auf Unterschieden in der Arbeitsproduktivität zwischen Ländern basiert. Es beschreibt die vereinfachenden Annahmen des Modells (zwei Länder, zwei Güter, Arbeit als einziger Produktionsfaktor, konstante Skalenerträge) und erklärt, wie komparative Kostenvorteile internationalen Handel ermöglichen, selbst wenn ein Land in der Produktion beider Güter absolut weniger effizient ist. Der Fokus liegt auf der Spezialisierung und dem gegenseitigen Vorteil durch Handel.
2.1 Anwendung des Modells auf die Indische Software-Industrie: Dieses Unterkapitel wendet Ricardos Theorie auf die indische Softwareindustrie an. Es argumentiert, dass Indiens niedrige Lohnkosten und die hohe Qualität der technischen Ausbildung komparative Vorteile gegenüber Ländern wie den USA darstellen. Die hohe Produktivität indischer Softwareingenieure trotz niedriger Löhne wird hervorgehoben. Die Kostenunterschiede in der Softwareentwicklung zwischen Indien und den USA werden als Triebkraft für den Export indischer Software dargestellt.
3 Das Heckscher-Ohlin-Modell: Das Kapitel präsentiert das Heckscher-Ohlin-Modell, welches komparative Vorteile auf unterschiedliche relative Faktorausstattungen zurückführt (Kapital und Arbeit). Im Gegensatz zu Ricardo, betont dieses Modell die Rolle von Kapital und Arbeit als Produktionsfaktoren und wie deren unterschiedliche Verfügbarkeit in verschiedenen Ländern zu Spezialisierung und Handel führt. Annahmen des Modells wie die fix vorgegebenen Faktoren werden erläutert.
Häufig gestellte Fragen zur Analyse der Indischen Softwareindustrie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert den rasanten Aufstieg der indischen Softwareindustrie anhand dreier internationaler Handelstheorien: dem Modell des komparativen Vorteils (Ricardo), dem Heckscher-Ohlin-Modell und dem Modell des nationalen Wettbewerbsvorteils (Porter). Ziel ist die Identifizierung und Erklärung der Schlüsselfaktoren für den Erfolg der indischen Softwareindustrie.
Welche Theorien werden verwendet?
Die Arbeit verwendet das Modell des komparativen Vorteils (Ricardo), das Heckscher-Ohlin-Modell und Porters Modell des nationalen Wettbewerbsvorteils, um den Erfolg der indischen Softwareindustrie zu erklären.
Wie wird der komparative Vorteil Indiens erklärt?
Der komparative Vorteil Indiens in der Softwareentwicklung wird durch niedrige Lohnkosten und die hohe Qualität der technischen Ausbildung begründet. Die hohe Produktivität indischer Softwareingenieure trotz niedriger Löhne wird als entscheidender Faktor hervorgehoben.
Welche Rolle spielen Faktorproportionen (Heckscher-Ohlin)?
Das Heckscher-Ohlin-Modell wird angewendet, um die Rolle unterschiedlicher relativer Faktorausstattungen (Kapital und Arbeit) im Kontext des Erfolgs der indischen Softwareindustrie zu untersuchen. Die unterschiedliche Verfügbarkeit von Kapital und Arbeit in Indien im Vergleich zu anderen Ländern wird analysiert.
Welche nationalen Wettbewerbsvorteile werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die nationalen Wettbewerbsvorteile der indischen Softwareindustrie im Rahmen von Porters Modell. Konkrete Faktoren werden in der Analyse nicht detailliert genannt, aber die Anwendung des Modells auf die indische Softwareindustrie wird untersucht.
Wie werden die Theorien verglichen?
Die Arbeit vergleicht die drei Theorien (Ricardo, Heckscher-Ohlin, Porter) in Bezug auf ihre Erklärungskraft für den Erfolg der indischen Softwareindustrie. Ein expliziter Vergleich der Theorien ist Teil der Analyse.
Welche Aspekte der Produktivität werden analysiert?
Die Analyse untersucht Produktivitätsunterschiede und Lohnkosten in der indischen Softwareindustrie im Vergleich zu anderen Ländern, insbesondere im Zusammenhang mit dem komparativen Vorteil und dem Heckscher-Ohlin-Modell.
Welche Daten werden verwendet?
Die Arbeit nennt als Beispiel die Anzahl der Softwarefirmen in Indien (558 im Jahr 1998, ca. 1000 im Jahr 2000) und den Umsatz (ca. 6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2000) sowie die jährliche Wachstumsrate von über 50 Prozent. Weitere Daten werden in der Arbeit wahrscheinlich detaillierter dargestellt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, Kapiteln zu den drei Handelstheorien (mit Unterkapiteln zur Anwendung auf die indische Softwareindustrie), einem Kapitel zum Vergleich der Theorien und wahrscheinlich einer Schlussfolgerung (nicht explizit im Inhaltsverzeichnis genannt).
- Citar trabajo
- Sinja Müller (Autor), 2004, Das Modell des komparativen Vorteils (Ricardo), das Heckscher-Ohlin-Modell und das Modell des nationalen Wettbewerbsvorteils (Porter): Eine Analyse der Indischen Software-Industrie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33287