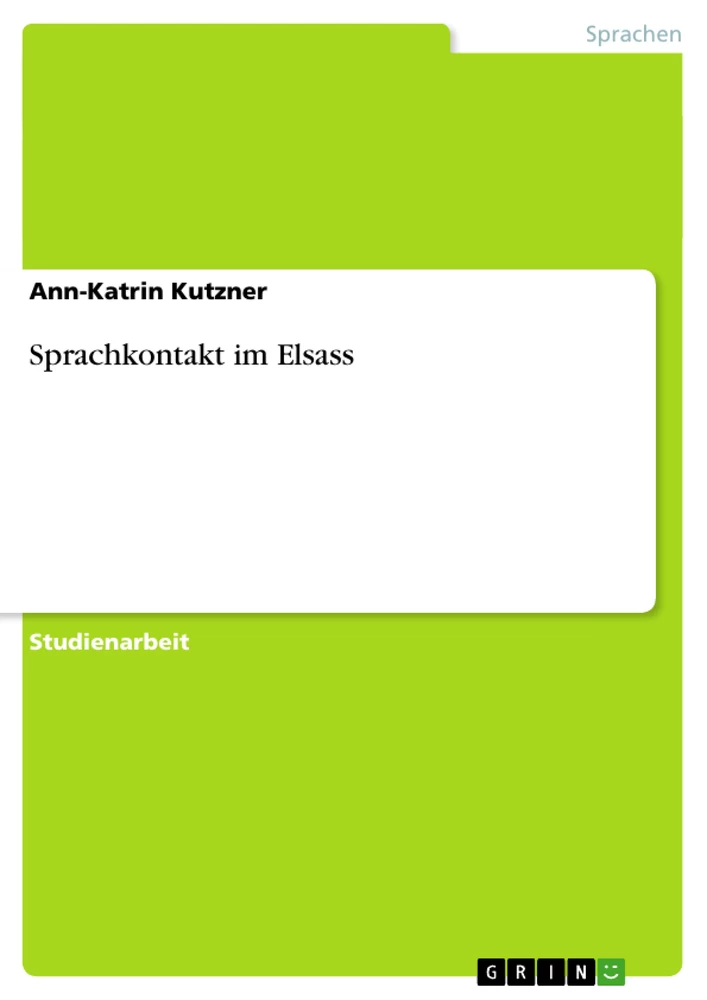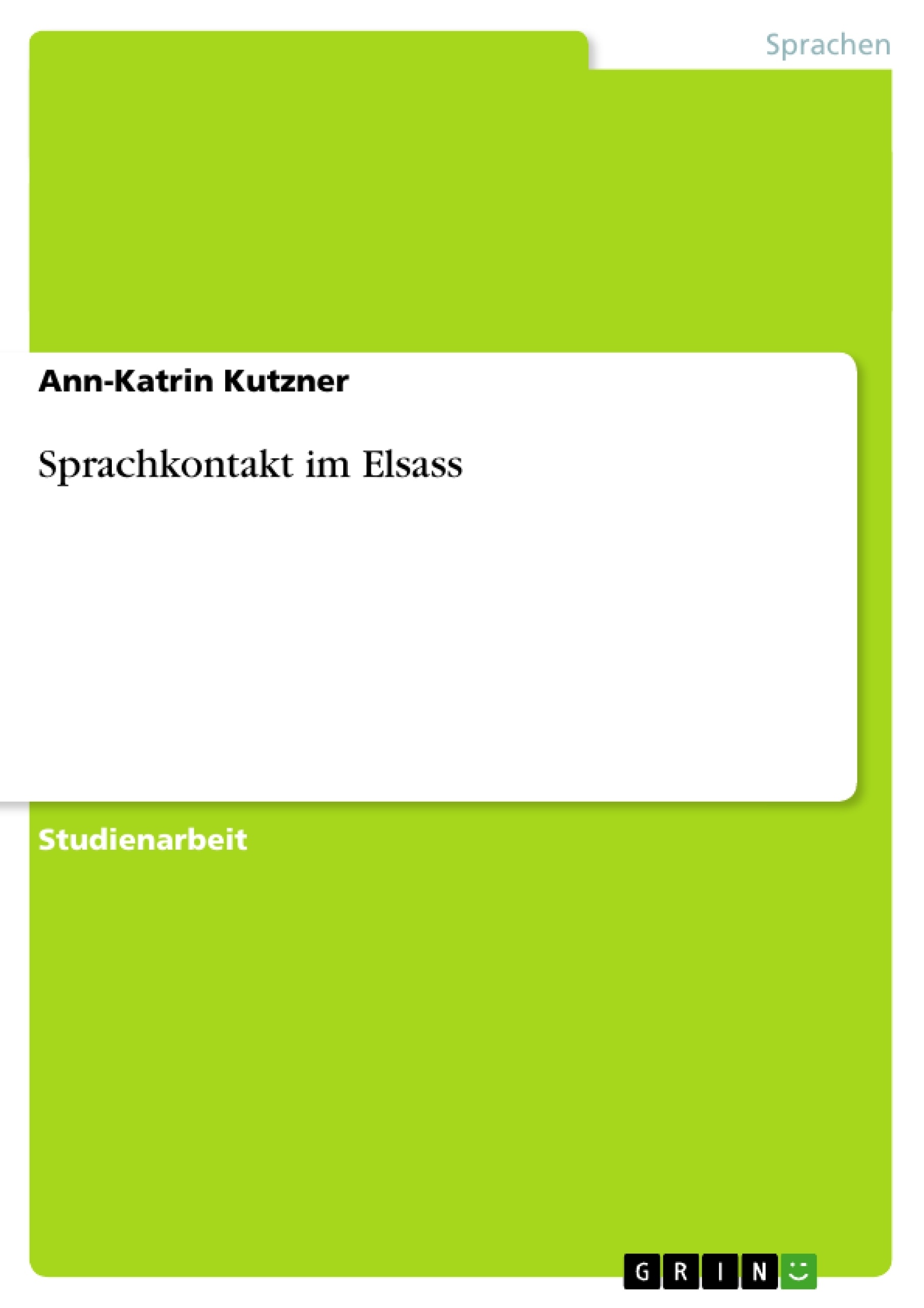In der vorliegenden Arbeit soll die sprachliche Situation der Region des Elsass untersucht werden. Dies erfolgt in erster Linie in Anlehnung an die Untersuchungen und Ausführungen Johanna Maurers in ihrer 2002 veröffentlichten Dissertation „Elsässisch und Französisch. Die Funktion ihrer Alternanz im Diskurs“. Im Elsass stehen sich laut Wolfgang Ladin zwei Sprachen, aber drei Sprachformen gegenüber: Französisch, Deutsch und der elsässische Dialekt, der eine deutsche Mundart ist.1 Hartweg formuliert dasselbe so: Der Elsässer sitzt noch immer zwischen drei Stühlen. Da aber das Hochdeutsche so gut wie wegfällt, „befinden wir uns in Wirklichkeit in einer asymmetrischen Diglossie - Situation, die eine expansive Komponente, das Französische, und eine in die Defensive gedrängte, die Mundart, aufweist, die noch für viele primäre Sprache bleibt, in der die Sozialisierungserfahrung geschieht.“2 Da das Hochdeutsche keine tragende Rolle mehr im Elsass spielt, handelt es sich bei dem zu untersuchenden Sprachkontakt im folegenden um das Französische oder genauer die französische Umgangssprache in Bezug auf den elsässischen Dialekt im alltäglichen mündlichen Sprachgebrauch und umgekehrt.
Inhaltsverzeichnis
- 2.1. Einleitung
- 2. Hintergründe
- 2.1. Geographie
- 2.2. Geschichte
- 2.2.1. Exkurs - Ländervergleich
- 3. Dialekt Elsässisch vs. Nationalsprache Französisch
- 4. Alternierender Sprachgebrauch
- 4.1 Code-Switching
- 4.1.1. Code-Mixing
- 4.2 Transfer
- 4.3 Interferenz
- 4.3.1. Feste Integrate
- 4.4 Entlehnungen
- 4.5 Redundanz
- 5. Wahl der Sprachform
- 6. Dialekt Elsässisch vs. Ursprungssprache Deutsch
- 6.1 Exkurs - Sprache und Identität
- 7. Schlussbetrachtung
- 7.1. Vorhandensein einer Mischsprache?
- 7.2. Gefahr der Verdrängung des Dialekts?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die sprachliche Situation im Elsass, insbesondere den Sprachkontakt zwischen Elsässisch und Französisch. Sie basiert auf der Dissertation von Johanna Maurer (2002) und analysiert die Funktion der Sprachalternanz im alltäglichen Diskurs. Der Fokus liegt auf der Beschreibung des Sprachzustands und der Untersuchung einer möglichen hybriden Sprachform.
- Sprachkontakt zwischen Elsässisch und Französisch
- Analyse der Sprachalternanz und Code-Switching
- Untersuchung möglicher hybrider Sprachformen
- Die Rolle der Sprache in der elsässischen Identität
- Der Einfluss der Geschichte und Geographie auf die Sprachsituation
Zusammenfassung der Kapitel
2.1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit: die Untersuchung der sprachlichen Situation im Elsass anhand der Studie von Johanna Maurer. Es wird der Fokus auf den Sprachkontakt zwischen Elsässisch und Französisch gelegt, wobei die Frage nach einer möglichen hybriden Sprachform im Mittelpunkt steht. Die Arbeit analysiert die Regelmäßigkeiten und die Verselbstständigung einer solchen Mischsprache und betrachtet die Rolle der Sprache in der elsässischen Identität. Die methodische Vorgehensweise, die auf empirischen Untersuchungen basiert, wird ebenfalls erläutert, inklusive der Herausforderungen bei der Datenerhebung.
2. Hintergründe: Dieses Kapitel beleuchtet die geographischen und historischen Hintergründe des Elsass als zweisprachiges Gebiet. Die geographische Lage an einem wichtigen europäischen Verkehrsknotenpunkt und die komplexe Geschichte, geprägt von französischer und deutscher Zugehörigkeit, werden als entscheidende Faktoren für die sprachliche Situation beschrieben. Der Einfluss der Geschichte auf die sprachliche Identität der Elsässer wird hervorgehoben, mit dem Fokus auf die Entwicklung und den Einfluss von Alemannisch und der Rolle der französischen Sprache im heutigen Kontext.
3. Dialekt Elsässisch vs. Nationalsprache Französisch: Dieses Kapitel fehlt im Auszug und kann daher nicht zusammengefasst werden.
4. Alternierender Sprachgebrauch: Dieses Kapitel (welches im Auszug nur fragmentarisch vorhanden ist) befasst sich mit verschiedenen Aspekten des alternierenden Sprachgebrauchs im Elsass. Es umfasst Code-Switching, Code-Mixing, Transfer, Interferenz, Entlehnungen und Redundanz. Es analysiert, wie diese Phänomene im alltäglichen Sprachgebrauch zwischen Elsässisch und Französisch auftreten und welche Rolle sie in der sprachlichen Entwicklung spielen. Die detaillierte Analyse der verschiedenen linguistischen Phänomene dient dazu, ein umfassendes Bild des Sprachkontakts zwischen den beiden Sprachen zu zeichnen.
5. Wahl der Sprachform: Dieses Kapitel fehlt im Auszug und kann daher nicht zusammengefasst werden.
6. Dialekt Elsässisch vs. Ursprungssprache Deutsch: Dieses Kapitel (welches im Auszug nur fragmentarisch vorhanden ist), untersucht den Sprachkontakt zwischen dem elsässischen Dialekt und dem Deutschen. Es wird beleuchtet, inwieweit die deutsche Sprache weiterhin eine Rolle in der elsässischen Identität spielt und wie sich der Sprachkontakt zu dieser Ursprungssprache von dem zum Französischen unterscheidet. Ein wichtiger Aspekt wird die Verbindung zwischen Sprache und Identität sein.
Schlüsselwörter
Elsass, Sprachkontakt, Französisch, Elsässisch, Dialekt, Code-Switching, Sprachmischung, Identität, Diglossie, Mehrsprachigkeit, empirische Untersuchung, Sprachgeschichte, Geographie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Sprachkontakt im Elsass
Was ist das Thema des Textes?
Der Text untersucht den Sprachkontakt zwischen Elsässisch und Französisch im Elsass. Ein Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Sprachalternanz und der Frage nach der Entstehung einer möglichen hybriden Sprachform. Die historische und geographische Entwicklung des Elsass wird ebenso berücksichtigt wie die Rolle der Sprache für die elsässische Identität.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text beinhaltet (zumindest teilweise, da einige Kapitel nur fragmentarisch vorhanden sind): eine Einleitung, ein Kapitel zu den geographischen und historischen Hintergründen, ein Kapitel zum Vergleich von Elsässisch und Französisch, ein Kapitel zum alternierenden Sprachgebrauch (Code-Switching, Code-Mixing, Transfer, Interferenz, Entlehnungen, Redundanz), ein Kapitel zur Wahl der Sprachform, ein Kapitel zum Vergleich von Elsässisch und Deutsch und eine Schlussbetrachtung mit Fragen zur Existenz einer Mischsprache und der möglichen Verdrängung des Dialekts.
Welche Methoden werden verwendet?
Der Text basiert auf der Dissertation von Johanna Maurer (2002) und verwendet eine empirische Untersuchungsmethode. Die genauen Methoden der Datenerhebung werden im Auszug jedoch nicht detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselthemen werden behandelt?
Die Schlüsselthemen umfassen Sprachkontakt, Sprachalternanz (Code-Switching), mögliche hybride Sprachformen, die Rolle der Sprache in der elsässischen Identität, den Einfluss von Geschichte und Geographie auf die Sprachsituation, sowie die Analyse von linguistischen Phänomenen wie Code-Mixing, Transfer, Interferenz, Entlehnungen und Redundanz.
Welche Sprachen werden verglichen?
Der Text vergleicht den elsässischen Dialekt mit der französischen Nationalsprache und der deutschen Ursprungssprache. Die Untersuchung konzentriert sich hauptsächlich auf den Sprachkontakt zwischen Elsässisch und Französisch.
Was ist die Zielsetzung des Textes?
Die Zielsetzung ist die Untersuchung der sprachlichen Situation im Elsass, insbesondere den Sprachkontakt zwischen Elsässisch und Französisch, die Analyse der Sprachalternanz im alltäglichen Diskurs und die Untersuchung einer möglichen hybriden Sprachform. Die Rolle der Sprache in der elsässischen Identität wird ebenfalls beleuchtet.
Welche Fragen werden in der Schlussbetrachtung gestellt?
Die Schlussbetrachtung stellt die Fragen nach dem Vorhandensein einer Mischsprache aus Elsässisch und Französisch und nach der Gefahr der Verdrängung des elsässischen Dialekts.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Relevante Schlüsselwörter sind: Elsass, Sprachkontakt, Französisch, Elsässisch, Dialekt, Code-Switching, Sprachmischung, Identität, Diglossie, Mehrsprachigkeit, empirische Untersuchung, Sprachgeschichte, Geographie.
- Quote paper
- Ann-Katrin Kutzner (Author), 2004, Sprachkontakt im Elsass, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33277