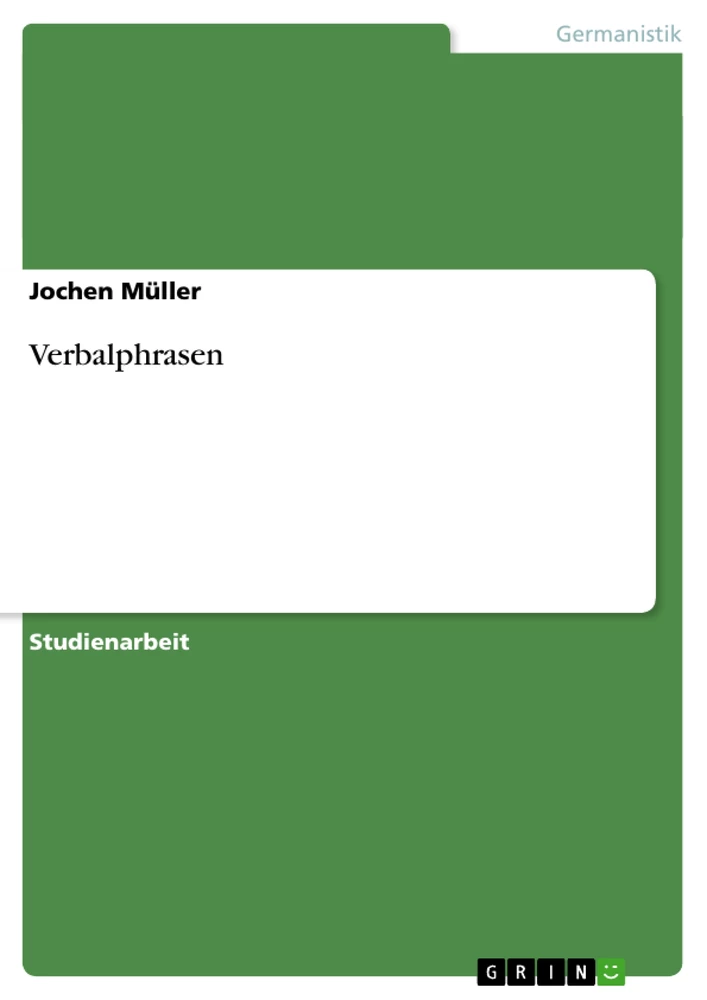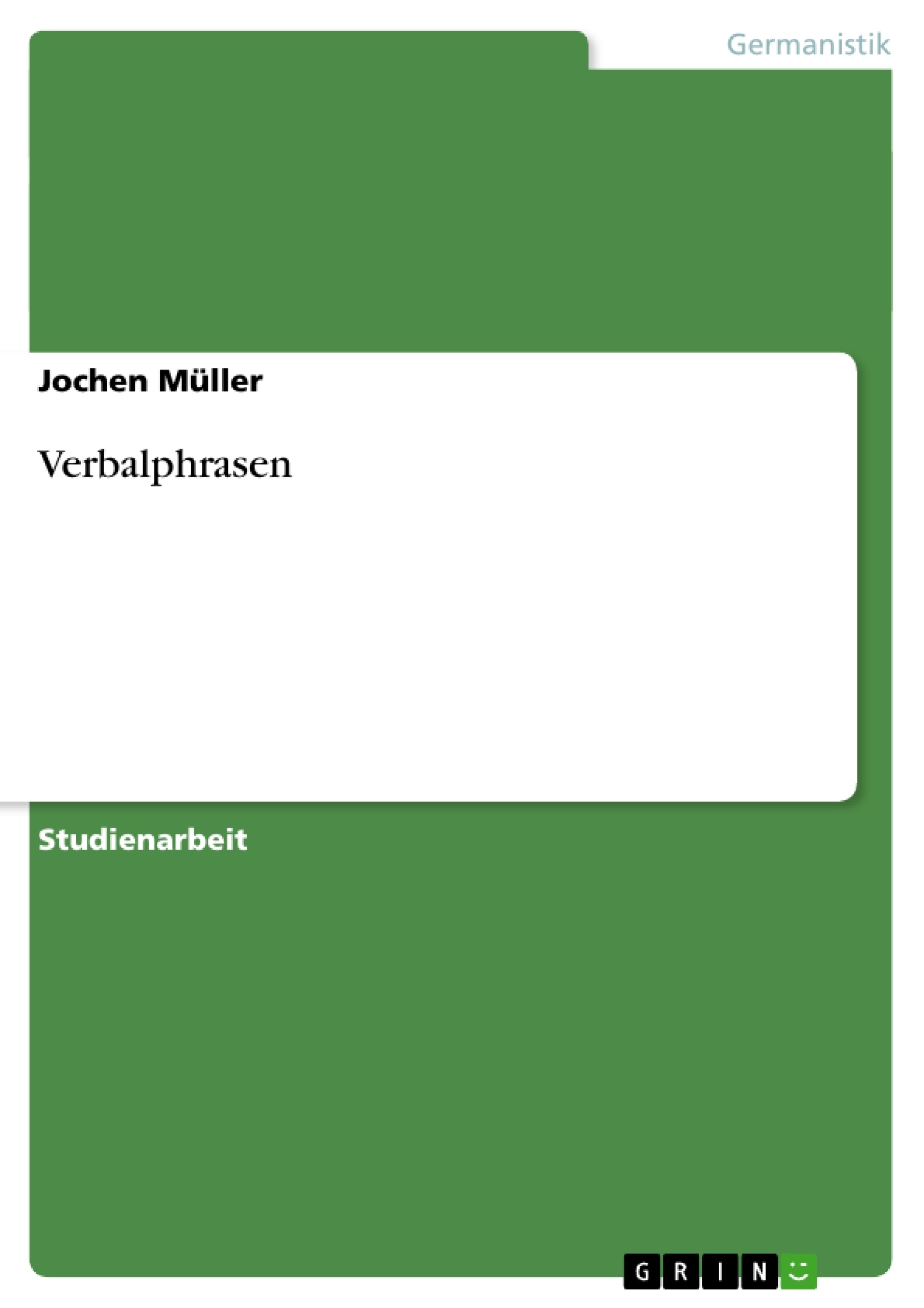Die Generative Transformationsgrammatik (GTG), wie sie von Noam Chomsky in den 60er und 70er Jahren entwickelt wurde, bemüht sich um die Entwicklung eines Regelapparates, der die Sprachfähigkeit eines durchschnittlichen Muttersprachlers nachkonstruiert. Gegenstand ist die Frage nach den kognitiven grammatischen Fähigkeiten, die den Erwerb einer Sprache und ihrer Grammatik erlauben, und die Frage, wie die zugrunde liegenden Regelsysteme gebaut sein müssen, damit der Erwerb dieser Regeln und ihre Anwendung zu grammatisch korrekt geformten Sätzen führt. Sie ist damit eine deskriptive Grammatik, keine historisch vergleichende und auch keine präskriptive (Schul-) Grammatik; die grammatische Kompetenz, nicht die Performanz bildet ihren Untersuchungsgegenstand. Anstoß und Prüfstein der Theoriebildung war dabei der Spracherwerb. Die GTG geht von einer jedem Menschen gegebenen Universalgrammatik aus, so daß Spracherwerb nicht mehr als reine Imitation erscheint, sondern als Konkretisierung von angeborenen, abstrakten Prinzipien. Es handelt sich dabei nicht um eine induktive Regelfindung, sondern eine deduktive Regelableitung, und zwar eine Ableitung aus vorgegebenen Prinzipien und Parametern. Deshalb beschäftigt sich die GTG mit formalen Repräsentationsmechanismen und versucht Regeln aufzudecken, die die Erzeugung (Generierung) beliebiger grammatisch korrekter Satzmuster ermöglicht. Das Interesse an Sprachuniversalien und einer "Universalgrammatik" führt zur Untersuchung von universal gültigen Prinzipien, die dann in Einzeluntersuchungen für die verschiedenen Sprachen verfeinert, bestätigt oder verworfen wurden. Prämisse ist dabei, daß es tatsächlich ein System angeborener universeller Prinzipien gibt, die den Erwerb einer Sprache bzw. deren Grammatik erklären sowie die Fähigkeit eines Sprechers, Satzstrukturen in andere umzuwandeln, also zu transformieren.
Inhaltsverzeichnis
- 1. GRUNDLAGEN DER GTG
- 2. DIE VERBALPHRASE
- 2.1 Die Verbalphrase als Konstituente
- 2.2 Die Bestandteile der Verbalphrase
- 2.3 Probleme der Verbstellung
- 3. DIE "INFLECTION"
- 3.1 Finitive Verben und die Kategorie INFL
- 3.2 Verbalkomplexe
- 4. DIE ERKLÄRUNGSADÄQUATHEIT DER GTG
- 5. VERZEICHNIS DER MATERIALIEN UND QUELLEN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Analyse der Verbalphrase im Rahmen der Generativen Transformationsgrammatik (GTG). Das Ziel ist es, die strukturellen Eigenschaften und Funktionen der Verbalphrase im Deutschen zu beschreiben und zu erklären, indem die theoretischen Konzepte und Prinzipien der GTG angewandt werden.
- Die Verbalphrase als Konstituente und ihre Bestandteile
- Das Problem der Verbstellung und die Rolle der "Inflection" (Flexion)
- Die Erklärungsadäquatheit der GTG im Hinblick auf die Verbalphrase
- Die Bedeutung von Transformationsregeln für die Analyse von Verbalphrasen
- Die Anwendung von Strukturbäumen und syntaktischen Tests zur Ermittlung von Konstituenten
Zusammenfassung der Kapitel
1. GRUNDLAGEN DER GTG
Dieses Kapitel liefert eine Einführung in die Generative Transformationsgrammatik (GTG) als ein Grammatikmodell, das die Sprachfähigkeit eines durchschnittlichen Muttersprachlers nachkonstruieren soll. Es werden die zentralen Ziele und Annahmen der GTG erläutert, insbesondere die Universalgrammatik, die deduktive Regelableitung und die Erzeugung beliebiger grammatisch korrekter Satzmuster. Das Kapitel behandelt auch die Bedeutung von Transformationsregeln und die Unterscheidung zwischen Tiefenstruktur und Oberflächenstruktur von Sätzen.
2. DIE VERBALPHRASE
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Analyse der Verbalphrase als Konstituente im Deutschen. Es werden die Bestandteile der Verbalphrase und die Problematik der Verbstellung untersucht. Die Rolle der "Inflection" (Flexion) bei der Bildung von finiten Verben und der Aufbau von Verbalkomplexen werden erörtert.
3. DIE "INFLECTION"
Dieses Kapitel befasst sich mit der Kategorie "Inflection" (Flexion) und ihrer Bedeutung für die Verbalphrase. Es werden finitive Verben und die morphologischen Merkmale von INFL (Flexionsmerkmalen) untersucht. Die Kapitel befasst sich auch mit dem Aufbau von Verbalkomplexen und ihren strukturellen Eigenschaften.
4. DIE ERKLÄRUNGSADÄQUATHEIT DER GTG
Dieses Kapitel bewertet die Erklärungsadäquatheit der GTG im Hinblick auf die Analyse der Verbalphrase. Es werden die Stärken und Schwächen des Modells im Vergleich zu anderen Grammatiktheorien diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Seminararbeit verwendet zentrale Begriffe wie Generative Transformationsgrammatik (GTG), Verbalphrase, Konstituente, Verbstellung, "Inflection" (Flexion), Transformationsregeln, Tiefenstruktur, Oberflächenstruktur, Strukturbäume, Phrasenstrukturprinzip, Satz-Grundkonstituenz und Universalgrammatik. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Beschreibung und Erklärung der Struktur und Funktion der Verbalphrase im Deutschen, indem sie die theoretischen Konzepte und Prinzipien der GTG einsetzt.
- Quote paper
- Jochen Müller (Author), 1997, Verbalphrasen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33221