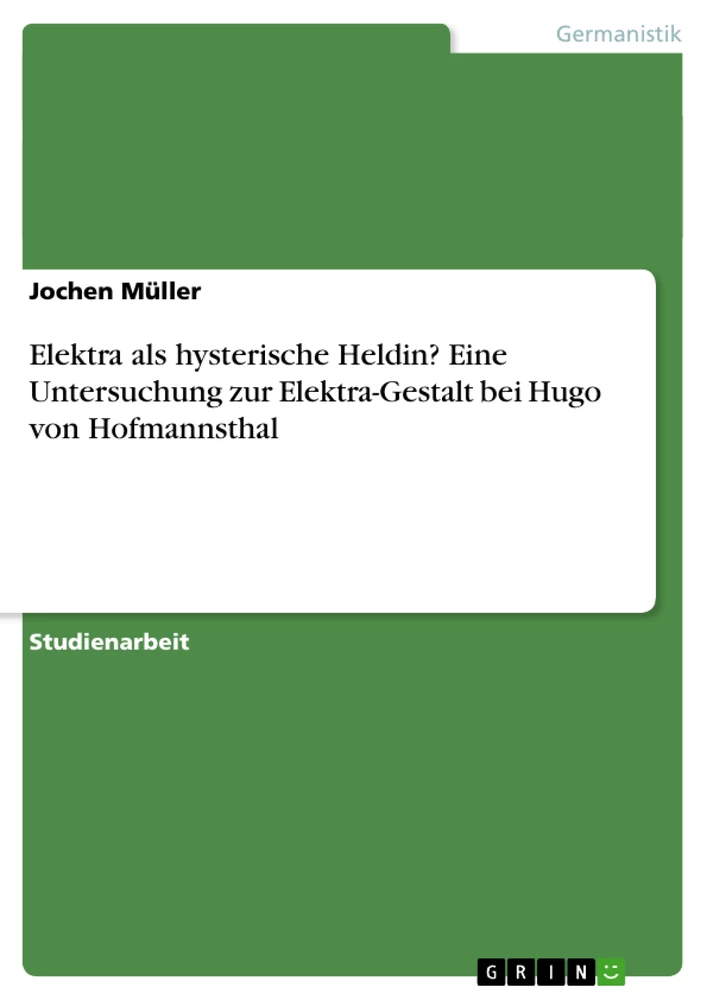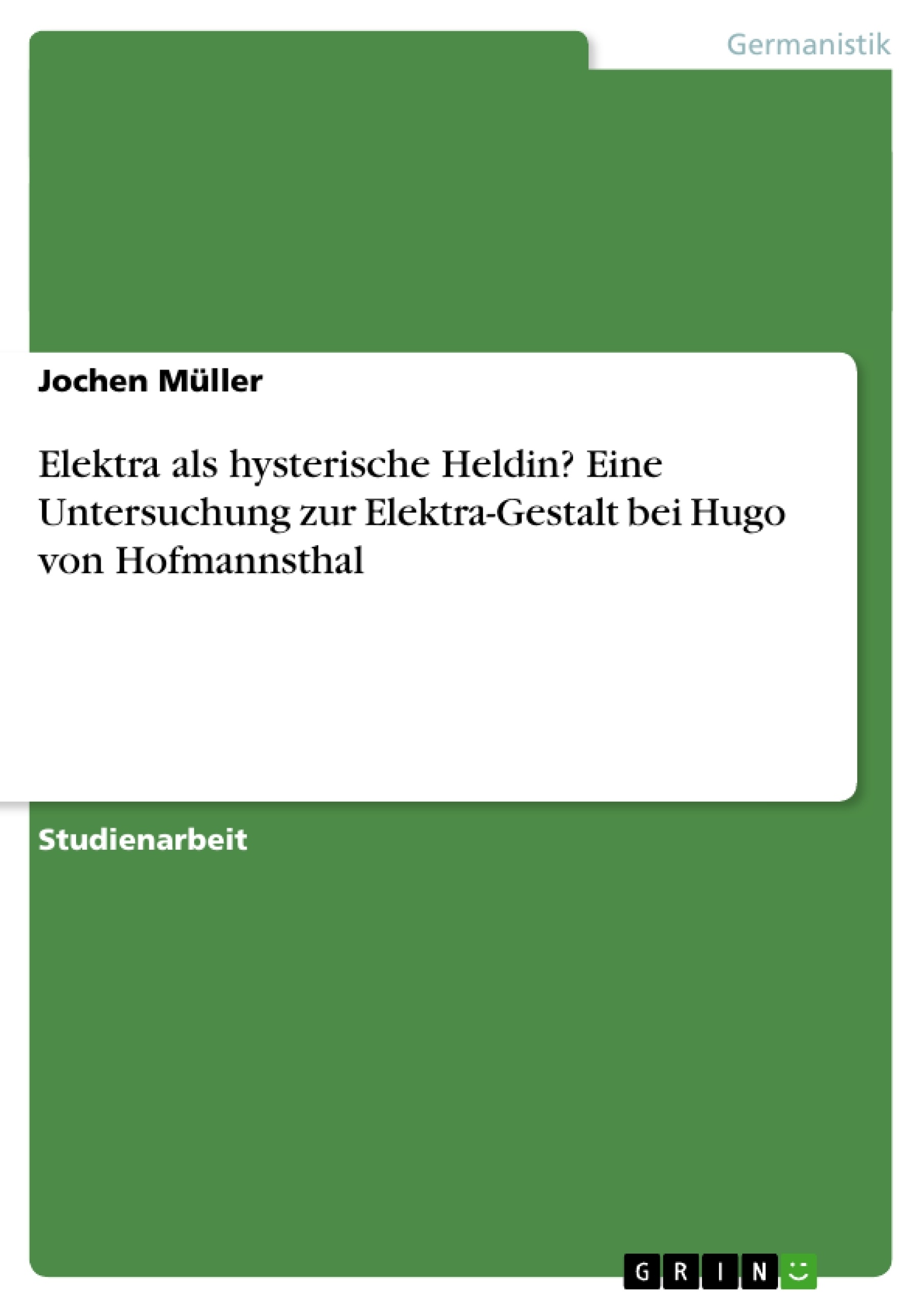Als Hugo von Hofmannsthals Einakter "Elektra" 1903 uraufgeführt wurde, war die Ablehnung der Kritiker nahezu einhellig: das Stück, das Richard Strauß als Libretto für seine Oper verwendete und dessen Wirkung durch eine am Rande der Tonalität schwebende Vertonung noch steigerte, sei ein greuliches Gemisch von viehischer Sinnlichkeit, Perversität, Verrücktheit und Rachedurst, so die einen; für die anderen, wie Paul Goldmann, war es nur "die Verirrung eines Talents". Hofmannsthal habe "die griechische Tragödie nicht nur total verändert, sondern auch alle poetischen Schönheiten aus ihr entfernt, ohne eine neue Poesie an Stelle der alten zu setzen"; für ihn war das Stück hybrid, ein literarisches Unding, das das Herz eigentümlich kalt lasse und, statt das Gemüt der Zuschauer zu bewegen, schockiere und abstoße: Hofmannsthal schildert den Mord, ohne erst viel mit den Gründen des Mordes sich abzugeben. Gewiß, es wird gesagt, daß Elektra ihre Mutter haßt. Aber das alles wird nur kurz angedeutet; man hört es kaum in dem Lärm, der das Drama erfüllt. Vom Augenblick an, da das Stück anfängt, beginnt Elektra zu schreien, und sie schreit unentwegt bis zum Schluß. Elektra, deren Klagen bei Sophokles mit dem Sange der Nachtigall verglichen werden, ist bei Hofmannsthal ein keifendes Weib geworden. Und ihre Wut berührt um so abstoßender, als man gar nicht recht begreift, warum sie eigentlich gar so wütend ist. So wird in diesem Drama gehaßt um des Hasses, gemordet um des Mordes willen. Elektra schreit nach Blut, und sie schreit nicht allein aus Haß, sie scheint nach Blut zu schreien, weil sie das Blut liebt. An die Stelle der Psychologie tritt die Perversität. [...] Und diese Kollektion widerlicher Ausartungen, diese Orgie des Sadismus nennt sich eine Nachdichtung nach Sophokles!
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Eingrenzung und Symptomatik der Besessenheit Elektras
- Die Forschung zur Elektra-Figur
- Die idealistische Interpretationsrichtung
- William H. Rey - "Elektra" als Weltversöhnung
- Nehring - Die Tatproblematik
- Wittmann - Wort und Tat
- Die psychoanalytische Interpretationsrichtung
- M. Worbs - Die Geburt der "Elektra" aus dem Geist der Psychopathologie
- Die idealistische Interpretationsrichtung
- Elektra - Ästhetik und Faszination der Besessenheit
- Die Erotik der Gewalt und die Lust am Irrsinn - mit Foucault gegen Freud
- Elektra und die schwarze Romantik - eine motivgeschichtliche Betrachtung
- Elektra und das Motiv der Medusa
- Elektra und das Motiv der "femme fatale"
- Elektra als Zeitphänomen
- Verzeichnis der Quellen und Materialien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Figur der Elektra in Hugo von Hofmannsthals Einakter "Elektra" und beleuchtet die Besessenheit der Titelheldin mit Rache und Gewalt. Die Arbeit setzt sich mit unterschiedlichen Deutungsansätzen auseinander, sowohl aus der idealistischen als auch aus der psychoanalytischen Perspektive.
- Elektra als hysterische Heldin: Die Darstellung von Elektras Besessenheit und ihre literarische Funktion
- Die Rolle von Gewalt und Rache im Drama
- Interpretationen der Figur aus unterschiedlichen Perspektiven
- Der Einfluss des "Fin de Siècle" auf die Gestaltung der Elektra-Figur
- Die ästhetische Funktion von Elektras Wahnsinn und ihre Faszination
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die ablehnende Reaktion der Kritiker auf die Uraufführung von "Elektra" im Jahr 1903 und stellt die Kontroverse um die künstlerische Qualität des Stücks dar. Das erste Kapitel grenzt die Besessenheit Elektras ein und beleuchtet die psychopathologischen Aspekte ihrer Persönlichkeit.
Das zweite Kapitel untersucht die unterschiedlichen Interpretationsrichtungen, die sich mit der Figur der Elektra auseinandersetzen. Es werden sowohl idealistische Ansätze, die Elektra als Symbol für Weltversöhnung oder als Ausdruck des Strebens nach Gerechtigkeit interpretieren, als auch psychoanalytische Ansätze vorgestellt, die Elektra als hysterische Persönlichkeit betrachten.
Im dritten Kapitel wird Elektra als ästhetisches Phänomen untersucht. Es werden die Erotik der Gewalt, der Einfluss der schwarzen Romantik und die Rezeption des Motivs der "femme fatale" in Verbindung mit der Figur der Elektra beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Hugo von Hofmannsthal, Elektra, Rache, Gewalt, Hysterie, "Fin de Siècle", schwarze Romantik, "femme fatale", psychoanalytische Interpretation, idealistische Interpretation.
- Quote paper
- Jochen Müller (Author), 1995, Elektra als hysterische Heldin? Eine Untersuchung zur Elektra-Gestalt bei Hugo von Hofmannsthal, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33220