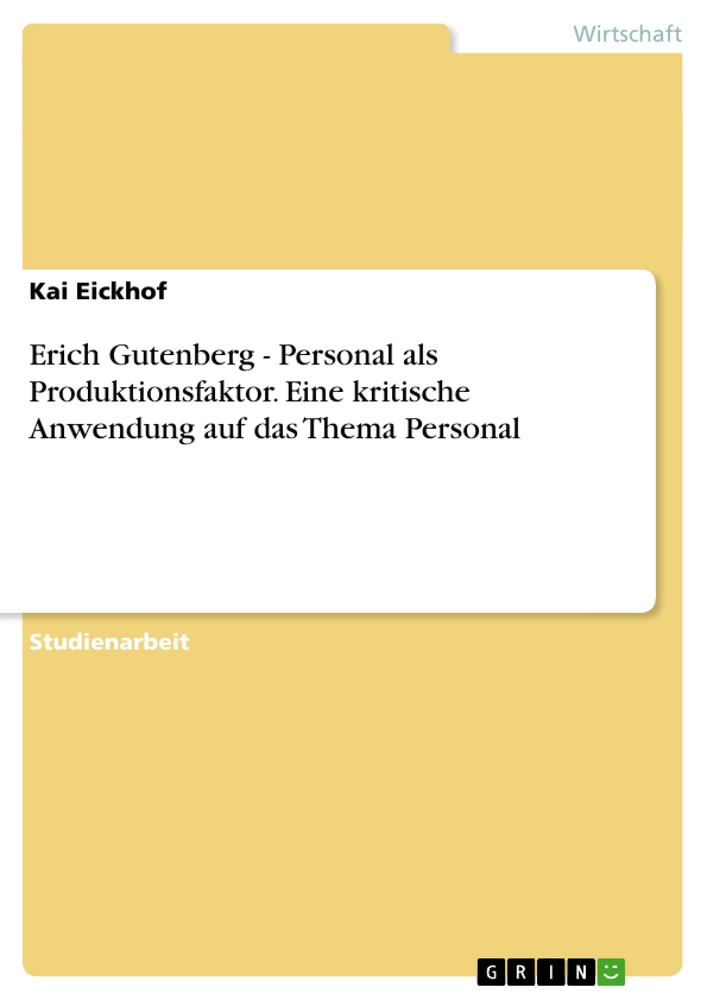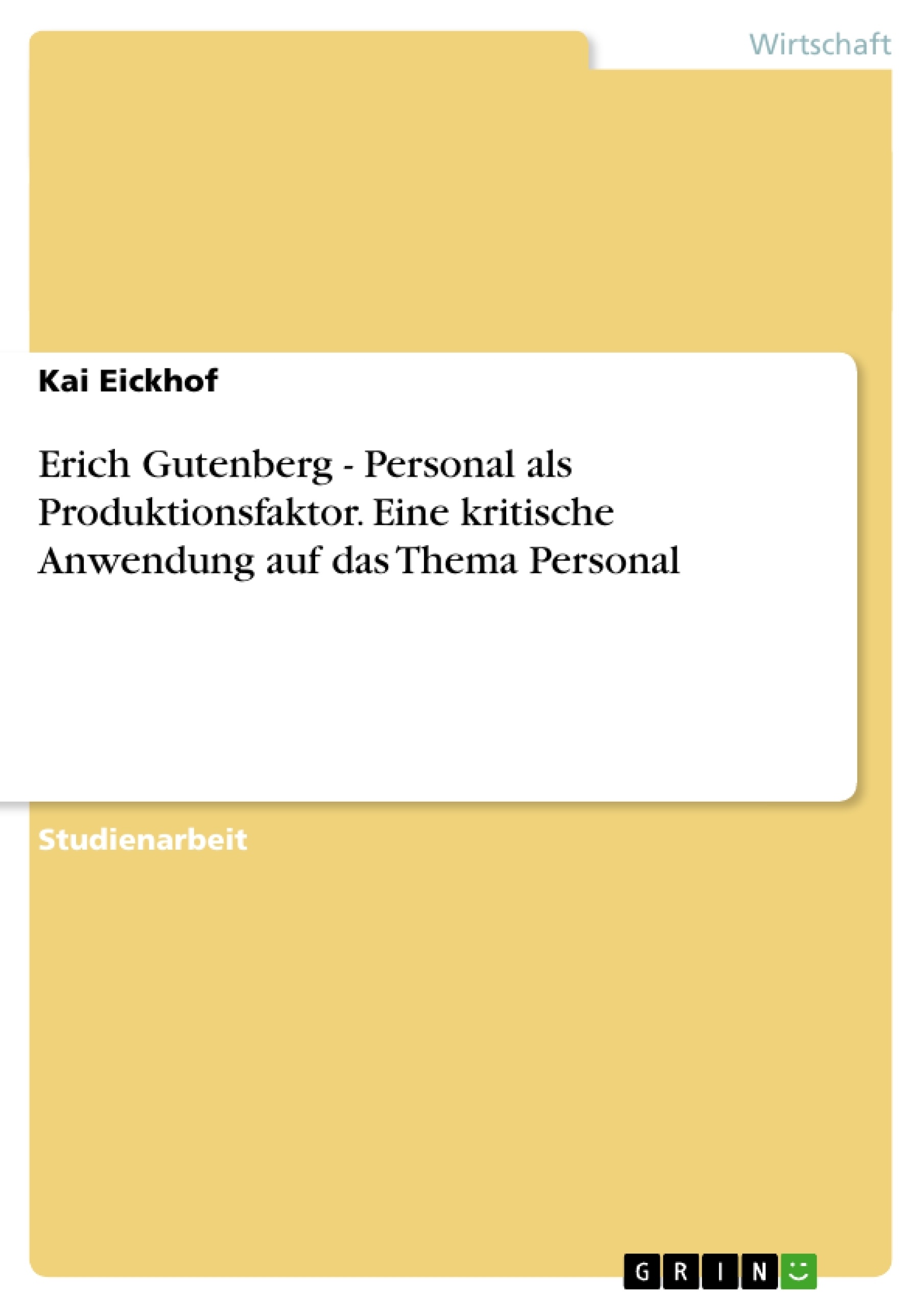In den zwanziger Jahren bildet das Rechnungswesen die Domäne der deutschen Betriebswirtschaft. Erich Gutenberg überspitzt die vorliegende Situation damit, dass er diese Disziplin in den ersten Jahrzehnten als eine „Betriebswirtschaftslehre der Wirtschaftsprüfer“ bezeichnet. Dort wurden die wissenschaftlich relevanten Leistungen erbracht. Eine einheitliche Betriebswirtschaftslehre gab es nicht, sie lag zerstückelt in vielen kleinen Einzeldisziplinen vor. Zu dieser Zeit standen sich grundsätzlich zwei Lager gegenüber. Eine Richtung die sich als Kunstlehre verstand, praxis- und anwendungsorientiert arbeitete und sich als Verfechter der Gemeinwirtschaft ansah und eine entgegengesetzte Richtung, die konsequent theoretisch und einkommensorientiert wissenschaftlichen Charakter besaß. Zunächst setzte sich die erste Richtung mit seinem Vertreter Eugen Schmalenbach durch.
Bereits zu dieser Zeit, in der sich die Betriebswirtschaftslehre noch am Anfang ihrer zweiten Entwicklungsphase befand, wählte Erich Gutenberg als Thema seiner Habilitationsschrift „Die Unternehmung als Gegenstand betriebswirtschaftlicher Theorie “. Erich Gutenberg wurde von der Idee geleitet die betrieblichen Teilbereiche Produktion, Absatz und Finanzierung in einen Gesamtzusammenhang zu bringen. Gutenberg schreibt 1929: „So gesehen kann man die Unternehmung als einen Komplex von Quantitäten bezeichnen, die in gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnissen zueinander stehen (funktional verbunden sind) (...) “. In den 1951 folgenden „Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre“ steht die Produktivitätsbeziehung zwischen Faktoreinsatz und Faktorertrag im Mittelpunkt. Die Verbindung erfolgt mikroökonomisch unter Ausschaltung des Irrationalen mit Hilfe einer Produktionsfunktion. Das Werk löste absolute Zustimmung wie auch strikte Ablehnung aus. Mit Hilfe seines Gesamtwerks, bestehend aus Band 1 Produktion, Band 2 Absatz und Band 3 Finanzierung, gelang es Erich Gutenberg, ein geschlossenes Einflussgrößensystem zu etablieren. Das Erscheinen der „Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre“ kann durchaus als das bedeutsamste Ereignis für die Entwicklung der betriebswirtschaftlichen Theorie angesehen werden und hat damit den theoretischen Grundstein für die allgemeine Betriebswirtschaft gelegt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gutenbergs Theorie
- Vorgehensweise
- System der Unternehmung
- Bedingungen der menschlichen Arbeitsleistung
- Kritische Anwendung auf das Thema Personal
- Der ökonomische Kern des Personalwesens
- Leerstellen der Theorie Gutenbergs
- Erweiterter Bezugsrahmen der Personalwirtschaftslehre
- Übertragbarkeit der Theorie auf die heutige Praxis
- Generelle Kritik
- Zweiter Methodenstreit
- Vollkommene Information
- Vorgehensweise
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Erich Gutenbergs Theorie des Personals als Produktionsfaktor und untersucht dessen Anwendbarkeit auf das Personalwesen. Sie beleuchtet die grundlegenden Elemente seiner Theorie, untersucht kritisch deren Übertragbarkeit auf die heutige Praxis und diskutiert generelle Kritikpunkte an seinem Ansatz.
- Gutenbergs Systematik der Produktionsfaktoren
- Die Bedingungen der menschlichen Arbeitsleistung
- Die ökonomische Sichtweise auf das Personalwesen
- Grenzen der Übertragbarkeit von Gutenbergs Theorie auf die heutige Praxis
- Kritikpunkte an Gutenbergs Ansatz
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die Situation der Betriebswirtschaftslehre in den zwanziger Jahren beleuchtet und Gutenbergs Beitrag zur Entwicklung der Theorie in diesem Kontext dargestellt.
Kapitel zwei erläutert Gutenbergs Theorie vom Personal als Produktionsfaktor. Es wird dabei auf seine methodische Vorgehensweise, das System der Produktionsfaktoren und die Bedingungen der menschlichen Arbeitsleistung eingegangen.
Das dritte Kapitel wendet Gutenbergs Theorie auf das Personalwesen an. Es analysiert die Stärken und Schwächen seiner Sichtweise und untersucht die Übertragbarkeit auf die heutige Praxis.
Kapitel vier diskutiert generelle Kritikpunkte an Gutenbergs Theorie, darunter der zweite Methodenstreit, das Konzept der vollkommenen Information und die methodische Vorgehensweise.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Personalwirtschaftslehre, Produktionsfaktoren, Arbeitsleistung, Wirtschaftlichkeitsprinzip, Methodenstreit, Theoriegeschichte, Erich Gutenberg.
- Quote paper
- Kai Eickhof (Author), 2004, Erich Gutenberg - Personal als Produktionsfaktor. Eine kritische Anwendung auf das Thema Personal, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33063