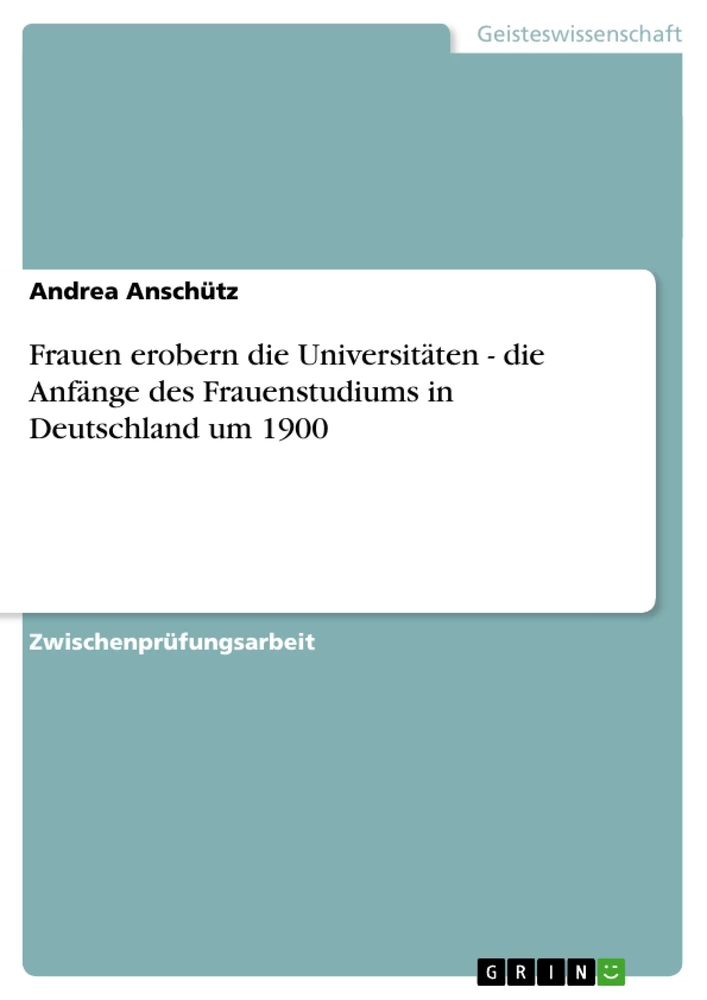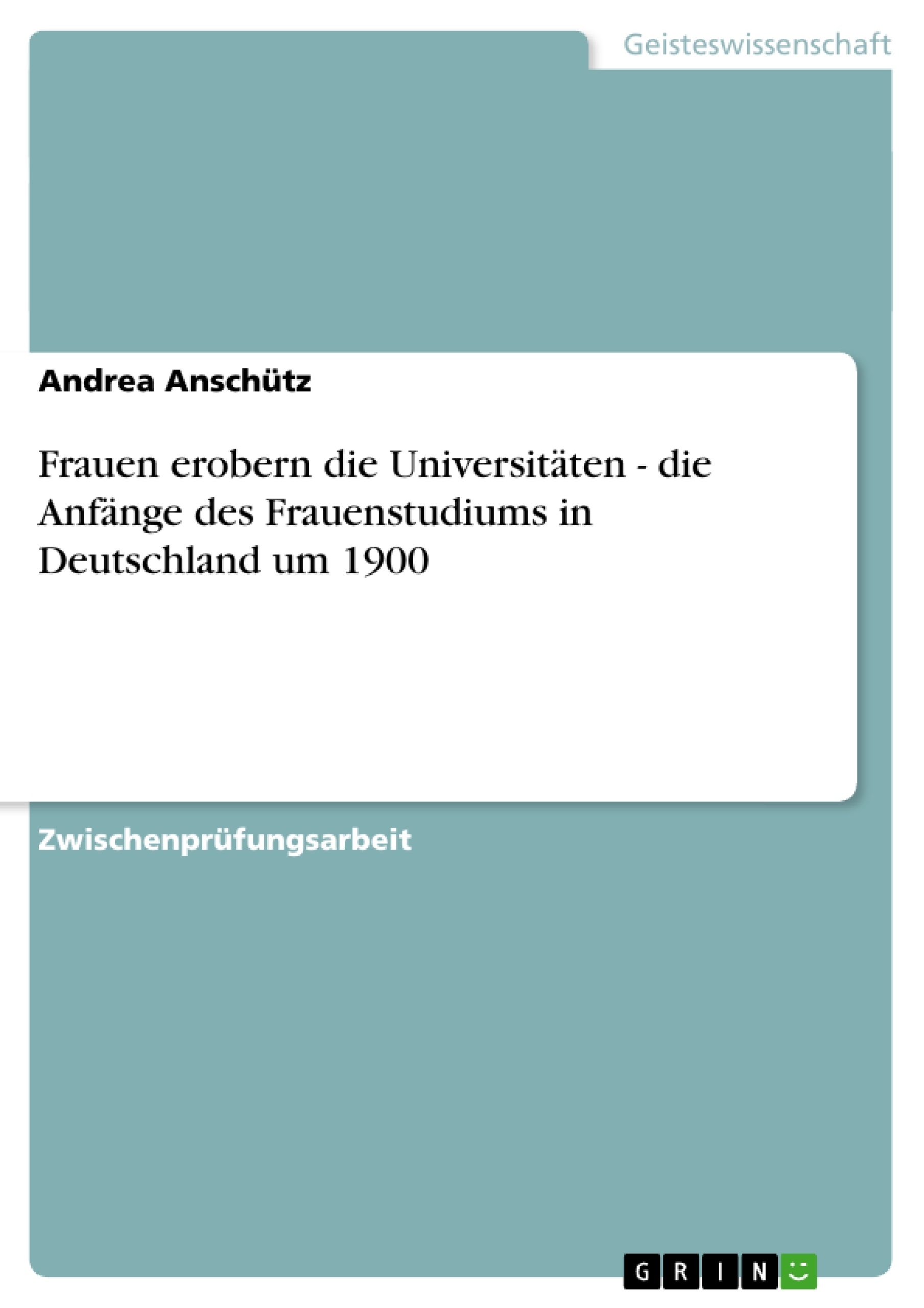„Es ist kein Rock noch Kleid, das einer Frau oder Jungfrauen übeler anstehet, als wenn sie klug will sein.“ (Martin Luther)
Die Geschichte der Frauenbildung reicht nach neueren Forschungserkenntnissen bis in die Antike zurück. Auch in den mittelalterlichen Klöstern unterrichteten gebildete Nonnen, in der italienischen Renaissance sind vereinzelt Professorinnen der Rechtswissenschaften zu finden. Dass sich „weibliches Wissen“ jedoch erst im 19. Jahrhundert einen festen Platz an den Universitäten in Europa sichern konnte, deutet auf den Verdrängungsprozess hin, in dem den Frauen wiederholt errungene Gebiete streitig gemacht wurden. Deutlich wir dies an einzelnen weiblichen Ausnahmen wie Christiane Marianne Ziegeler, Anna Maria Balthasar und Dorothea Schlözer. Besonders hervorzuheben ist Dorothea Christiane Erxleben, die in ihrem Buch „Gründliche Untersuchung der Ursachen, die das weibliche Geschlecht vom Studieren abhalten“ anderen Frauen Mut zum Studium. „Als Wunder des Jahrhunderts angestaunt, jedoch damit auch durchaus als Ausnahme empfunden“ gingen sie einen ersten Schritt in Richtung wissenschaftlicher Bildung. Der geregelte Weg in die Universitäten für Frauen musste erst noch erkämpft werden.
Auf diesen Prozess, den Kampf um das Frauenstudium, wird im ersten Abschnitt näher eingegangen. Dabei stehen vor allem die Kritiker mit ihren Vorurteilen im Mittelpunkt. Aber auch die Frauenbewegung und erste Erfolge werden zur Sprache kommen. Im zweiten Teil wird ein Blick auf die ersten Gasthörerinnen an deutschen Universitäten geworfen. Hier geht es um die Frage der sozialen Herkunft, sowie der Religionszugehörigkeit und der Studienfachwahl. Außerdem werden anhand des Studienalltags die bestehenden Probleme und Einschränkungen der Gasthörerinnen verdeutlicht. Unter ähnlichen Gesichtspunkten wird danach das ordentliche Studium von Frauen erläutert. Dabei werden Besonderheiten in der sozialen Herkunft, aber auch in der Studienfachwahl und damit verbunden die Konfessionszugehörigkeit, näher beleuchtet. Die Beziehungen zwischen männlichen und weiblichen Kommilitonen und die finanzielle Belastung der Studentinnen werden unter dem Gesichtspunkt des Studienalltages behandelt. Mit einem kurzen Exkurs in den Bereich der Studentinnenvereine werden das ordentliche Frauenstudium und seine Entwicklung abgeschlossen. Im letzten Teil wird die jetzige Situation der Studentinnen an Universitäten beschrieben und noch immer bestehende Auffälligkeiten hervorgehoben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Kampf um das Studium
- Erste Gasthörerinnen
- Soziale Herkunft, Religionszugehörigkeit und Studienfachwahl
- Studienalltag
- Das ordentliche Studium
- Soziale Herkunft
- Studienfachwahl und Religionszugehörigkeit
- Studienalltag
- Studentische Vereinigungen
- Die Situation heute und Fazit
- Abbildungen und Graphiken
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Anfänge des Frauenstudiums in Deutschland um 1900. Ziel ist es, den Kampf um den Zugang zu universitärer Bildung für Frauen zu beleuchten und die Situation der ersten Studentinnen zu beschreiben. Die Arbeit analysiert die sozialen, religiösen und akademischen Aspekte des Frauenstudiums in dieser Epoche.
- Der Kampf der Frauen um Zugang zum Studium und die Widerstände dagegen
- Die soziale Herkunft, Religionszugehörigkeit und Studienfachwahl der ersten Studentinnen
- Der Studienalltag der Gasthörerinnen und ordentlichen Studentinnen
- Die Rolle studentischer Vereinigungen
- Vergleich der Situation der Studentinnen um 1900 mit der heutigen Situation.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung skizziert die lange Geschichte der Frauenbildung, von der Antike bis ins 19. Jahrhundert, und betont den Prozess der wiederholten Verdrängung von Frauen aus der Wissenschaft. Sie führt in die Thematik ein und kündigt die Schwerpunkte der Arbeit an, insbesondere den Kampf um das Frauenstudium und die Situation der ersten Studentinnen an deutschen Universitäten.
Der Kampf um das Studium: Dieses Kapitel beleuchtet die gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzungen um das Frauenstudium in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Es analysiert die Rolle der Frauenbewegung und die Bedeutung von Frauenvereinen für die Durchsetzung von Frauenrechten in der Bildung. Die zunehmende Industrialisierung und die damit verbundene Veränderung der Rolle der Frau im Haushalt werden als wichtige Faktoren für die Forderungen nach gleichen Bildungschancen diskutiert. Das Kapitel hebt auch die Herausforderungen hervor, die durch das unzureichende höhere Mädchenschulwesen und den fehlenden Zugang zum Abitur bestanden.
Erste Gasthörerinnen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die ersten Frauen, die als Gasthörerinnen an deutschen Universitäten zugelassen wurden. Es untersucht ihre soziale Herkunft, religiöse Zugehörigkeit und die Wahl ihrer Studienfächer. Der Fokus liegt auf den Problemen und Einschränkungen, mit denen diese Frauen im Studienalltag konfrontiert waren, die aus der damaligen gesellschaftlichen Situation resultierten. Der Text verdeutlicht die Hürden, die trotz erster Erfolge weiterhin bestanden.
Das ordentliche Studium: Dieses Kapitel beschreibt die Situation der Frauen, die ein reguläres Studium absolvierten. Es beleuchtet Aspekte wie die soziale Herkunft der Studentinnen, die Wahl ihrer Studienfächer und den Einfluss ihrer Konfessionszugehörigkeit. Der Studienalltag mit den Beziehungen zu männlichen Kommilitonen und den damit verbundenen finanziellen Belastungen wird analysiert. Ein Exkurs zu studentischen Vereinigungen rundet das Kapitel ab, indem er die Entwicklung des ordentlichen Frauenstudiums in den Kontext der damaligen Zeit einbettet.
Schlüsselwörter
Frauenstudium, Deutschland, 1900, Frauenbewegung, Gasthörerinnen, Hochschulzugang, soziale Herkunft, Religionszugehörigkeit, Studienfachwahl, Studienalltag, Studentinnenvereine, Bildungschancen, Geschlechterrollen, gesellschaftliche Veränderungen, Industrialisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text: Anfänge des Frauenstudiums in Deutschland um 1900
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Anfänge des Frauenstudiums in Deutschland um 1900. Sie beleuchtet den Kampf um den Zugang zu universitärer Bildung für Frauen und beschreibt die Situation der ersten Studentinnen. Analysiert werden soziale, religiöse und akademische Aspekte des Frauenstudiums dieser Epoche.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf den Kampf der Frauen um Zugang zum Studium und die Widerstände dagegen, die soziale Herkunft, Religionszugehörigkeit und Studienfachwahl der ersten Studentinnen, den Studienalltag von Gasthörerinnen und ordentlichen Studentinnen, die Rolle studentischer Vereinigungen und einen Vergleich der Situation um 1900 mit der heutigen Situation.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Der Kampf um das Studium, Erste Gasthörerinnen (mit den Unterkapiteln Soziale Herkunft, Religionszugehörigkeit und Studienfachwahl sowie Studienalltag), Das ordentliche Studium (mit den Unterkapiteln Soziale Herkunft, Studienfachwahl und Religionszugehörigkeit, Studienalltag und Studentische Vereinigungen), Die Situation heute und Fazit, Abbildungen und Graphiken und Literaturverzeichnis.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung skizziert die lange Geschichte der Frauenbildung von der Antike bis ins 19. Jahrhundert, betont die wiederholte Verdrängung von Frauen aus der Wissenschaft, führt in die Thematik ein und kündigt die Schwerpunkte der Arbeit an.
Worüber handelt das Kapitel "Der Kampf um das Studium"?
Dieses Kapitel beleuchtet die gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzungen um das Frauenstudium Mitte des 19. Jahrhunderts. Es analysiert die Rolle der Frauenbewegung, die Bedeutung von Frauenvereinen und die Auswirkungen der Industrialisierung auf die Forderungen nach gleichen Bildungschancen. Auch die Herausforderungen durch unzureichende Mädchenschulen und den fehlenden Zugang zum Abitur werden diskutiert.
Was ist der Fokus des Kapitels "Erste Gasthörerinnen"?
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die ersten Frauen als Gasthörerinnen an deutschen Universitäten. Es untersucht ihre soziale Herkunft, religiöse Zugehörigkeit und Studienfachwahl sowie die Probleme und Einschränkungen im Studienalltag aufgrund der damaligen gesellschaftlichen Situation.
Worum geht es im Kapitel "Das ordentliche Studium"?
Dieses Kapitel beschreibt die Situation der Frauen, die ein reguläres Studium absolvierten. Es beleuchtet Aspekte wie soziale Herkunft, Studienfachwahl, Konfessionszugehörigkeit, den Studienalltag, Beziehungen zu Kommilitonen, finanzielle Belastungen und die Rolle studentischer Vereinigungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Frauenstudium, Deutschland, 1900, Frauenbewegung, Gasthörerinnen, Hochschulzugang, soziale Herkunft, Religionszugehörigkeit, Studienfachwahl, Studienalltag, Studentinnenvereine, Bildungschancen, Geschlechterrollen, gesellschaftliche Veränderungen, Industrialisierung.
Gibt es einen Fazit?
Ja, die Arbeit enthält ein Fazit im Kapitel "Die Situation heute und Fazit", welches die Erkenntnisse zusammenfasst und möglicherweise einen Vergleich zur heutigen Situation zieht.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Die Arbeit ist für akademische Zwecke bestimmt und dient der Analyse von Themen im Kontext des Frauenstudiums in Deutschland um 1900.
- Quote paper
- Andrea Anschütz (Author), 2004, Frauen erobern die Universitäten - die Anfänge des Frauenstudiums in Deutschland um 1900, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33031