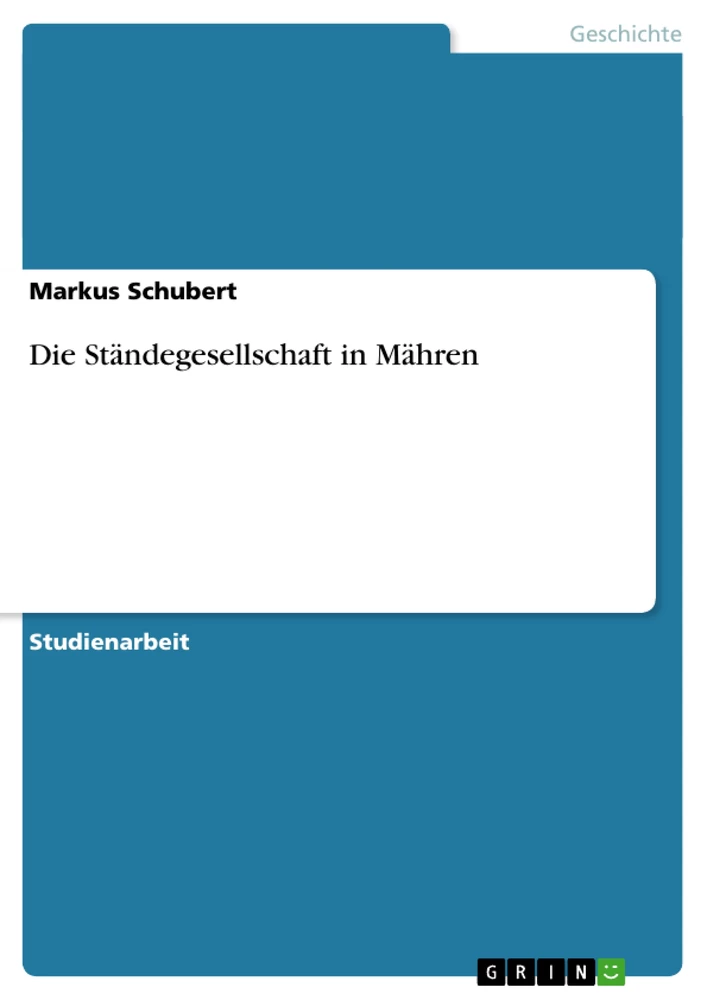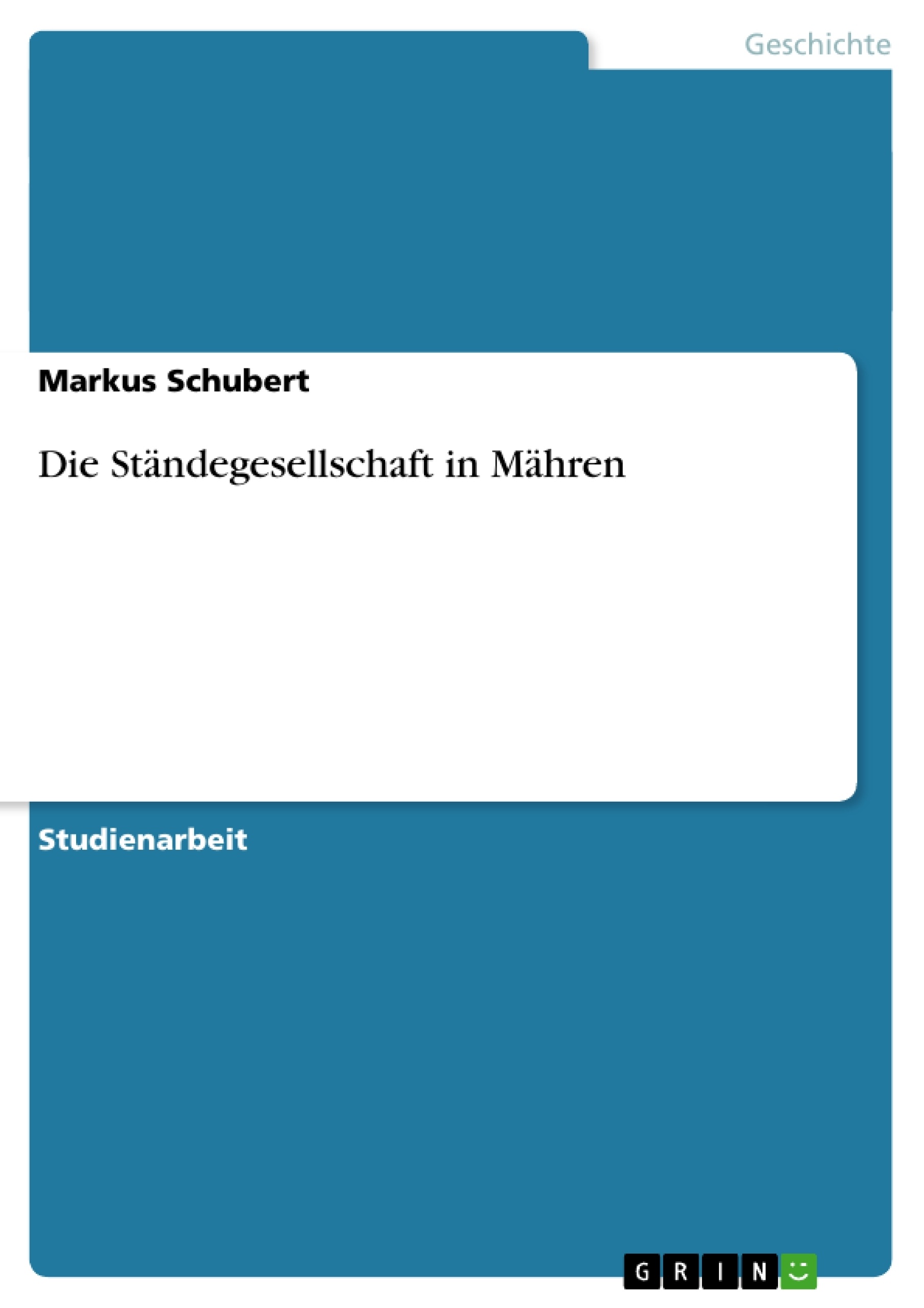Was sind die Gründe für die Kontinuität der Adelsmacht in den habsburgischen Ländern in der Frühen Neuzeit? Diese Fragestellung umfasst Probleme wie die sozialen Verhältnisse und den Staatsaufbau der habsburgischen Herrschaft. 1
Das Verhältnis zwischen Adel und Herrscher
Der absolutistische Machtstaat der Habsburger war eine Voraussetzung und ein Modell für den Verfassungs- und Nationalstaat im 19. Jahrhundert. Dieser war ein Staat, der seine eigenen sozialen und politischen Grundlagen nicht rational darlegte, sondern propaga ndistisch überhöhte. „In einer gesamteuropäischen Perspektive wird diese Form des absolutistischen Staates als „Normalfall“ einer Modernisierungstendenz in der Frühen Neuzeit angesehen, der zum erfolgreichen Staatsaufbau führt.“ 2 Die Entwicklung im habsbur gischen Machtbereich beispielsweise durch die Verneuerte Landesordnung von 1627 kann in diesem Sinn als Schritt zu einem absolutistischen Staat angesehen werden.
Die Konflikte zwischen Adel und Herrscher
Eine bedeutende Richtung innerhalb der Geschichtswissenschaft betont den Machtkampf, der im 16. Jahrhundert zwischen den Habsburgern und den vom Hochadel dominierten Landständen um politische Ansprüche bestand. Dieser Machtkampf wurde noch verstärkt durch die konfessionelle Spaltung und verlagert auf die symbolische Ebene. Besonders um die Konfessionalisierungsfrage entzündeten sich die Konflikte zwischen Adel und Herrscher, die letztlich ihren Höhepunkt in der Erhebung der Stände von 1620 ihren Höhepunkt fanden. 3 Gab es eine Alternative zum absolutistischen Staat habsburgischer Prägung? Was die Landstände angeht, so stellte der landständische Adel immer nur den kleineren Teil des gesamten Adels. Im 16. Jahrhundert mobilisierte die Türkengefahr ebenso wie die Reformation die organisatorischen Aktivitäten der Stände. Diese Aktivitäten führten aber schließlich nur zu dem, was als so genannter „Dualismus“ in der Verwaltung bezeichnet wird. Dieser Begriff bezeichnete eben die Alternative zum absolutistischen Machtstaat. Was war die Konfliktlinie zwischen den Ständen und dem Herrscher?
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Landespatriotismus und Loyalität
- Die Regierung Ferdinands I. (1526-1564)
- Die Erbfolge Ferdinands
- Die Regierungsgrundsätze Ferdinands I.
- Die Schlacht von Mohacs und deren Folgen
- Die ständische Oppositionsbildung in Mähren
- Rudolf II. und der Weg zur Gegenreformation
- Die Erbfolge Rudolfs II
- Auf dem Weg zur Gegenreformation unter Rudolf II.
- Der „Bruderzwist“ im Hause Habsburg
- Gegenreformation und Ständeaufstand in Böhmen und Mähren
- Die katholische Glaubenserneuerung und Gegenreformation
- Aufstand und Gegenreformation unter Ferdinand II.
- Die „Politiques“: Konfessionelle Orientierung und politische Landesinteressen in Böhmen und Mähren
- Die „Verneuerte Landesordnung“ für Böhmen und Mähren
- Fazit und abschließende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Ständegesellschaft in Mähren im Kontext der frühen Neuzeit und analysiert die Beziehungen zwischen den Ständen und den Habsburger Herrschern. Sie beleuchtet die politischen und sozialen Spannungen, die zwischen den Ständen und dem Herrscherhaus entstanden sind, und untersucht die Gründe für die Kontinuität der Adelsmacht in den habsburgischen Ländern.
- Die Entwicklung des Ständewesens in Mähren im 16. und 17. Jahrhundert
- Die Rolle der Konfessionalisierung und Gegenreformation in der Beziehung zwischen Ständen und Herrscher
- Die Konflikte zwischen Adel und Herrscher um Macht und Einfluss
- Die Entstehung und Bedeutung der "Verneuerten Landesordnung" für Böhmen und Mähren
- Die Rolle des Adels in der habsburgischen Herrschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einführung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor und beleuchtet den historischen Kontext der Beziehungen zwischen Adel und Herrscher in den habsburgischen Ländern. Das erste Kapitel untersucht den Landespatriotismus und die Loyalitätsbeziehungen zwischen den Ständen und dem Herrscher. Kapitel 2 analysiert die Regierung Ferdinands I. und die Entstehung der ständigen Oppositionsbildung in Mähren. Kapitel 3 befasst sich mit der Regierungszeit Rudolfs II. und dem Weg zur Gegenreformation, während Kapitel 4 die Konflikte zwischen Ständen und Herrscher in Böhmen und Mähren im Kontext der Gegenreformation beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die folgenden Themen: Ständegesellschaft, Mähren, Habsburger, Frühe Neuzeit, Landespatriotismus, Loyalität, Konfessionalisierung, Gegenreformation, Ständeaufstand, Politiques, "Verneuerte Landesordnung", Adel, Macht, Einfluss, soziale Verhältnisse, Staatsaufbau.
- Quote paper
- Markus Schubert (Author), 2004, Die Ständegesellschaft in Mähren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32785