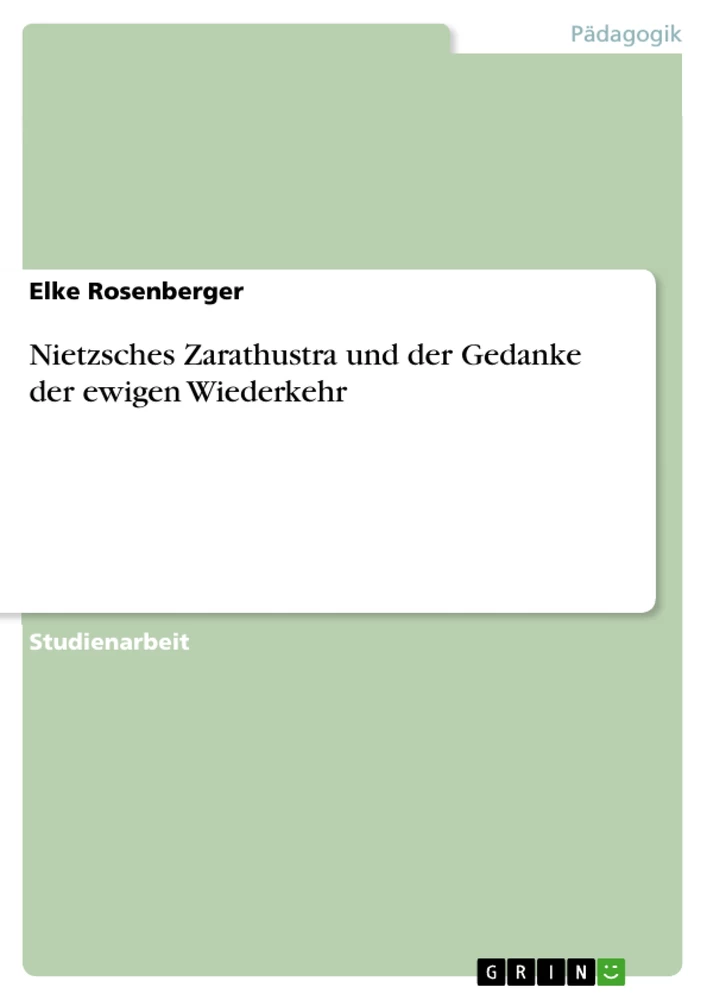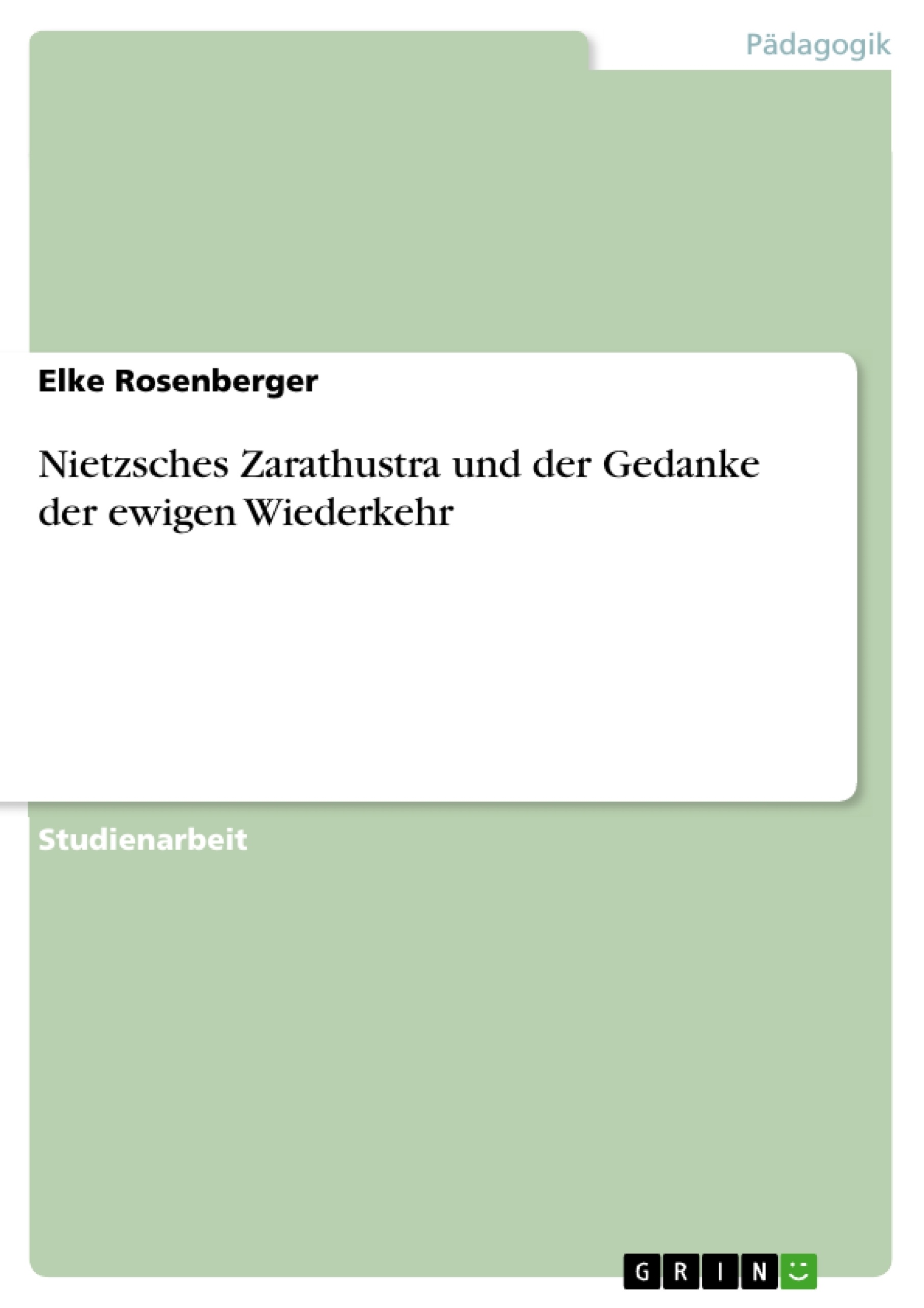1 Einleitung
Nietzsche läßt Zarathustra sich vom Lehrer des Übermenschen weiter entwickeln und darüber hinaus zum Verkünder der ewigen Wiederkehr werden. Diesem Wiederkehrgedanken gibt Nietzsche eine zentrale Bedeutung. Er setzt ihn als grundlegende Annahme für ein freieres Leben; wobei er Freiheit als Absolutum ausschließt. Er glaubt eher in Anlehnung zu dem Begriff Wahrscheinlichkeit, statt Wahrheit, an „Freischein-lichkeit“ („ Menschliches Allzumenschliches“ Bd. 2, 1, S. 167), statt Freiheit.
In „Der Wille zur Macht“ gilt ihm der Wiederkehrgedanke als Gedanke der Abrechnung. Er sieht ihn, sobald er eine Realität erfahren würde, als schweren Gedanken für die Menschheit. Historisch bezeichnet er ihn als Mitte, und weltgestaltend als Pendant zum Christentum. Erst durch dessen Realisation hält Nietzsche jedoch eine menschenwürdigere, besser „lebenswürdigere“, Weiterentwicklung der Menschheit für möglich. Obwohl er seine These der ewigen Wiederkehr nicht zureichend wissenschaftlich begründen kann, gibt er sie nicht auf.
Als klassischer Philologe hat er sich mit dem vorsokratischen Verständnis des Leben als zyklische Kreisbewegung befaßt und war schon in dieser Zeit fasziniert von dessen Wirkung auf die damaligen Menschen. Das platonische und christliche Weltbild erscheint ihm dagegen als lebensfeindlich. Die altgriechischen Daseinsauffassungen haben ihn sein ganzes Schaffen hindurch beeinflußt, so daß er schließlich in „Zarathustra“ seine Visionen lebendig werden läßt.
In der Auseinandersetzung mit Nietzsches „Zarathustra“ faszinierte mich die existentielle Bedeutung des Wiederkehrgedankens und die Vorbedingungen, diesen Gedanken letztlich schöpferisch leben zu können. Die Vorstellung, daß alles identisch wiederkehrt, verführt zu der Annahme, daß dann auch nichts neu entstehen kann. Zarathustra betont jedoch das schöpferische Über-Sich-Hinausschaffen. So stellte sich mir die Frage, wie es möglich sein kann, dies miteinander zu vereinbaren.
Zarathustras Entwicklung und weitere Ausführungen in Nietzsches Gesamtwerk ließen mich eine Erklärung finden. Deshalb stellt meine Seminararbeit eine Betrachtung besonders des dritten und vierten Teils von „Also sprach Zarathustra“ dar, die der Frage nach geht, wie und warum Zarathustra zum Verkünder der ewigen Wiederkehr wird.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Stimme der stillsten Stunde
- Konfrontation mit dem Geist der Schwere im Gesicht und Rätsel
- Resümee in der Einsamkeit
- Neue Lebensprinzipien
- Reformation des Gedankens der ewigen Wiederkehr
- Zarathustras Erlösung
- Zarathustras „Letzte Versuchung“
- Zarathustras Gastmahl
- Letzte Vorbereitungen zum „Großen Mittag“
- Abschließende Betrachtung des Themas
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht Nietzsches "Zarathustra" und den darin zentralen Gedanken der ewigen Wiederkehr. Ziel ist es, Zarathustras Entwicklung zum Verkünder dieser Idee nachzuvollziehen und zu analysieren, wie und warum er zu dieser Position gelangt. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf dem dritten und vierten Teil des Werkes.
- Zarathustras Entwicklung zum Verkünder der ewigen Wiederkehr
- Die Kritik an der linearen Zeitauffassung und dem daraus resultierenden Leid
- Der "Wille zur Macht" als schöpferischer Lebenswille
- Die Bedeutung des "Übermenschen"-Gedankens
- Die Überwindung der selbst gesetzten Grenzen des Willens
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die zentrale Bedeutung des Wiederkehrgedankens in Nietzsches Werk. Sie erläutert die Forschungsfrage, wie Zarathustra zum Verkünder der ewigen Wiederkehr wird, und skizziert den Fokus der Arbeit auf den dritten und vierten Teil von "Also sprach Zarathustra". Die Faszination der Autorin für die existentielle Bedeutung des Wiederkehrgedankens und die Frage nach der Vereinbarkeit von Wiederkehr und schöpferischem Über-Sich-Hinauswachsen werden hervorgehoben.
Die Stimme der stillsten Stunde: Dieses Kapitel beschreibt Zarathustras anfängliche Gefangenschaft in metaphysisch gesetzten Werten und Daseinsauffassungen. Nietzsche kritisiert die lineare Zeitauffassung als Quelle des Leids, da sie das menschliche Dasein als unvollkommen und vergänglich darstellt. Zarathustra erkennt die selbstgeschaffenen Fesseln des Willens und die daraus resultierende Leidenserfahrung. Der Wille zur Macht wird als schöpferischer Lebenswille vorgestellt, der sich jedoch in der linearen Zeitauffassung gefangen fühlt.
Schlüsselwörter
Nietzsche, Zarathustra, Ewige Wiederkehr, Wille zur Macht, Übermensch, Lineare Zeitauffassung, Leid, Selbstüberwindung, Schöpferischer Wille.
Häufig gestellte Fragen zu Nietzsche's "Also sprach Zarathustra" - Seminararbeit
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert Friedrich Nietzsches "Also sprach Zarathustra" mit einem Schwerpunkt auf dem Gedanken der ewigen Wiederkehr. Sie verfolgt Zarathustras Entwicklung zum Verkünder dieser Idee und untersucht die Gründe für seine Position. Der Fokus liegt dabei besonders auf dem dritten und vierten Teil des Werkes. Die Arbeit enthält eine Einleitung, Kapitelzusammenfassungen, eine Beschreibung der Zielsetzung und der wichtigsten Themen, sowie ein Stichwortverzeichnis.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die zentralen Themen sind Zarathustras Entwicklung zum Verkünder der ewigen Wiederkehr, die Kritik an der linearen Zeitauffassung und dem daraus resultierenden Leid, der "Wille zur Macht" als schöpferischer Lebenswille, die Bedeutung des "Übermenschen"-Gedankens und die Überwindung der selbst gesetzten Grenzen des Willens. Die Arbeit beleuchtet auch die Faszination der Autorin für die existentielle Bedeutung des Wiederkehrgedankens und die Frage nach der Vereinbarkeit von Wiederkehr und schöpferischem Über-Sich-Hinauswachsen.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit ist gegliedert in folgende Kapitel: Einleitung, Die Stimme der stillsten Stunde, Konfrontation mit dem Geist der Schwere im Gesicht und Rätsel, Resümee in der Einsamkeit, Neue Lebensprinzipien, Reformation des Gedankens der ewigen Wiederkehr, Zarathustras Erlösung, Zarathustras „Letzte Versuchung“, Zarathustras Gastmahl, Letzte Vorbereitungen zum „Großen Mittag“, Abschließende Betrachtung des Themas.
Was ist die zentrale Forschungsfrage der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage ist, wie Zarathustra zum Verkünder der ewigen Wiederkehr wird.
Auf welchen Teil von "Also sprach Zarathustra" konzentriert sich die Arbeit?
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf dem dritten und vierten Teil von "Also sprach Zarathustra".
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Nietzsche, Zarathustra, Ewige Wiederkehr, Wille zur Macht, Übermensch, Lineare Zeitauffassung, Leid, Selbstüberwindung, Schöpferischer Wille.
Wie wird die lineare Zeitauffassung in der Arbeit betrachtet?
Die lineare Zeitauffassung wird als Quelle des Leids kritisiert, da sie das menschliche Dasein als unvollkommen und vergänglich darstellt. Zarathustra erkennt die selbstgeschaffenen Fesseln des Willens, die aus dieser Auffassung resultieren.
Welche Rolle spielt der "Wille zur Macht" in der Arbeit?
Der "Wille zur Macht" wird als schöpferischer Lebenswille beschrieben, der sich jedoch in der linearen Zeitauffassung gefangen fühlt.
- Quote paper
- Elke Rosenberger (Author), 1998, Nietzsches Zarathustra und der Gedanke der ewigen Wiederkehr, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3277