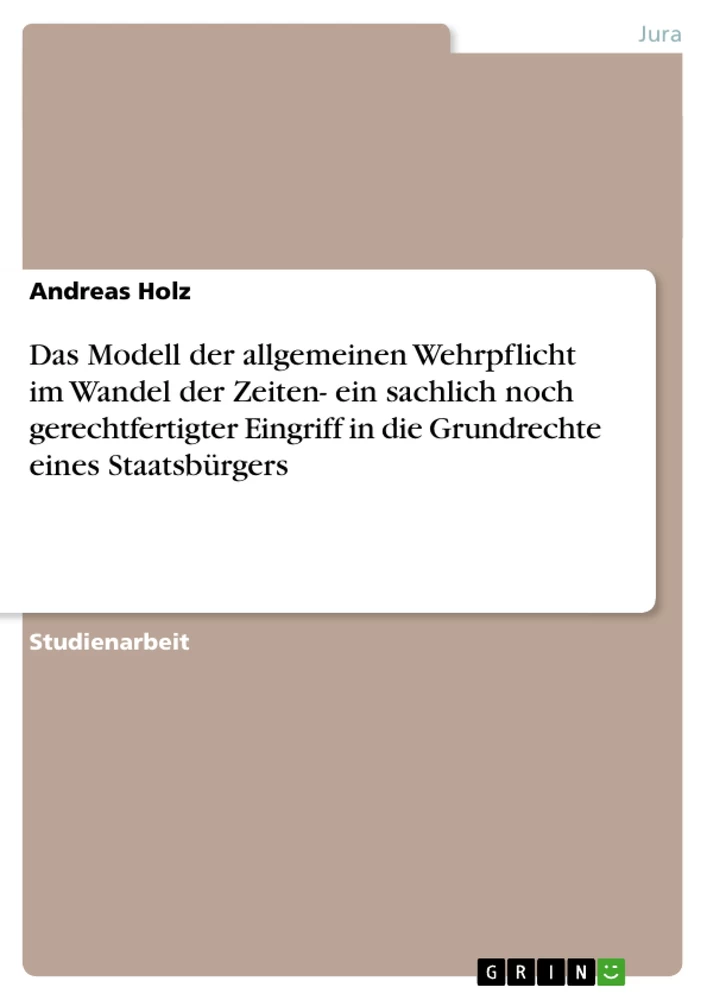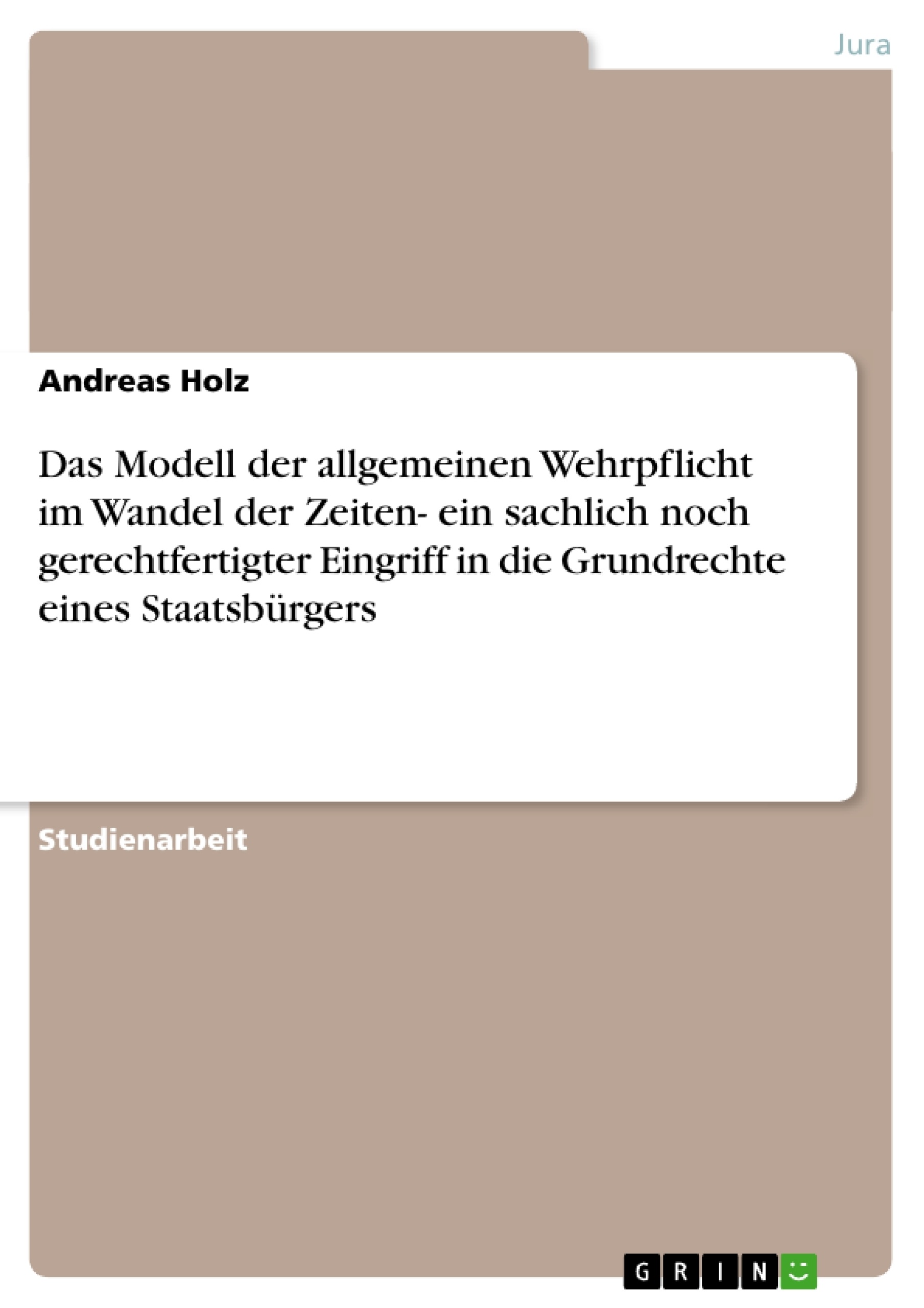Durch die zunehmende Anzahl von Kriegsdienstverweigerern und die veränderte sicherheitspolitische
Lage kam es in letzter Zeit zu einer heftigen Diskussion um die
allgemeine Wehrpflicht in Deutschland. Nicht zuletzt durch die Entscheidung des französischen
Staatspräsidenten Chirac, seine Streitkräfte in eine Berufsarmee
umzuwandeln, wird die Wehrpflicht auch von der deutschen Bevölkerung zunehmend
in Frage gestellt.
Das Ziel dieser Hausarbeit besteht vordergründig in der Untersuchung, inwieweit das
Bestehen der allgemeinen Wehrpflicht in der heutigen Zeit noch sachlich gerechtfertigt
werden kann. Im allgemeinen Teil der Arbeit soll erläutert werden, welche verfassungsrechtlichen
Grundlagen hierfür eine Rolle spielen und inwiefern durch diese Pflicht ein
Eingriff in die Grundrechte des Staatsbürgers stattfindet. Als ein sehr wichtiger Aspekt
für die sachliche Rechtfertigung der Wehrpflicht stellt sich das Gebot der Wehrgerechtigkeit
heraus. Einen großen Schwerpunkt dieser Arbeit bildet daher die Überprüfung,
inwiefern dieses von allen Seiten der Gesellschaft geforderte Gebot heute noch eingehalten
wird. Zu diesem Zweck sollen die beiden Gruppen der dienenden und
nichtdienenden Wehrpflichtigen unter der Berücksichtigung aller bestehenden Wehrdienstausnahmen
miteinander verglichen werden. Das Zahlenmaterial in der Anlage
der Arbeit stellt eine wichtige Grundlage für diesen Vergleich dar.
Der letzte Teil der Arbeit beschäftigt sich mit den Argumenten, die für die sachliche
Rechtfertigung der Wehrpflicht eine besondere Rolle spielen. Diese Argumente sollen
kritisch betrachtet und sorgfältig gegeneinander abgewogen werden.
Außerdem soll im Verlaufe der Behandlung dieser Thematik eine Stellungnahme zu
den in der Literatur veröffentlichten Ansichten und zu den Auffassungen der höchstrichterlichen
Rechtsprechung abgegeben werden. Die rechtlichen Grundlagen für die
Ausarbeitung des Themas bilden insbesondere das Grundgesetz und das Wehrpflichtgesetz.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeines zur Wehrpflicht
- Definition
- Sicherheits- und außenpolitische Ausgangslage
- Zweck der Einführung einer allgemeinen Wehrpflicht
- Grundrechtseinschränkungen durch die Wehrpflicht
- Recht auf Kriegsdienstverweigerung
- Gebot der Wehrgerechtigkeit
- Vergleich der zum Dienst herangezogenen und nicht zu einem Dienst herangezogenen Gruppen
- Vergleichsgruppe der nicht zu einem Dienst herangezogenen Wehrpflichtigen
- Wehrdienstunfähigkeit
- Ausschluss vom Wehrdienst
- Befreiung
- Zurückstellung vom Wehrdienst
- Unabkömmlichkeitsstellung
- Zivil- oder Katastrophenschutz
- Vollzugsdienste der Polizei und des BGS
- Entwicklungsdienst
- Weitere Ursachen für die Nichtheranziehung zu einem Dienst
- Administrative Wehrdienstausnahmen
- Vergleichsgruppe der dienstleistenden Wehrpflichtigen
- Zivildienstleistende
- Wehrdienstleistende
- Unterschiede zwischen Wehrdienst und Zivildienst
- Vergleichsbilanz
- Verhältnismäßigkeit und sachliche Rechtfertigung
- Verteidigungs- und sicherheitspolitische Gründe
- Bündnispolitische Aspekte
- Gesellschaftspolitische Argumente
- Wirtschafts- und finanzpolitische Argumente
- Ergebnis
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Sachgerechtigkeit der allgemeinen Wehrpflicht in Deutschland im Kontext der aktuellen Sicherheitslage und der zunehmenden Zahl von Kriegsdienstverweigerern. Sie analysiert die verfassungsrechtlichen Grundlagen und den Eingriff in die Grundrechte durch die Wehrpflicht. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Gebot der Wehrgerechtigkeit und dem Vergleich der dienenden und nichtdienenden Wehrpflichtigen unter Berücksichtigung aller Wehrdienstausnahmen.
- Verfassungsmässige Grundlagen der Wehrpflicht
- Eingriff in die Grundrechte durch die Wehrpflicht
- Gebot der Wehrgerechtigkeit
- Argumente für und gegen die sachliche Rechtfertigung der Wehrpflicht
- Aktuelle sicherheitspolitische Lage
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert den Hintergrund der Arbeit und stellt die Zielsetzung sowie den Aufbau dar. Das zweite Kapitel definiert die allgemeine Wehrpflicht, betrachtet die Sicherheits- und außenpolitische Lage und beleuchtet den Zweck der Einführung sowie die Grundrechtseinschränkungen durch die Wehrpflicht. Weiterhin wird das Recht auf Kriegsdienstverweigerung thematisiert.
Kapitel drei befasst sich mit dem Gebot der Wehrgerechtigkeit und vergleicht die Gruppen der dienenden und nichtdienenden Wehrpflichtigen unter Berücksichtigung aller Wehrdienstausnahmen. Die Unterschiede zwischen Wehrdienst und Zivildienst werden ebenfalls analysiert. Das vierte Kapitel betrachtet die Argumente für die sachliche Rechtfertigung der Wehrpflicht, unterteilt in verteidigungs-, bündnis-, gesellschafts-, wirtschafts- und finanzpolitische Aspekte. Die Argumente werden kritisch beleuchtet und gegeneinander abgewogen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind die allgemeine Wehrpflicht, Grundrechte, Wehrgerechtigkeit, Sicherheitspolitik, Verteidigung, Kriegsdienstverweigerung, Zivildienst, Bündnispolitik, Gesellschaftspolitik, Wirtschaft und Finanzen.
- Quote paper
- Andreas Holz (Author), 2004, Das Modell der allgemeinen Wehrpflicht im Wandel der Zeiten- ein sachlich noch gerechtfertigter Eingriff in die Grundrechte eines Staatsbürgers, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32695