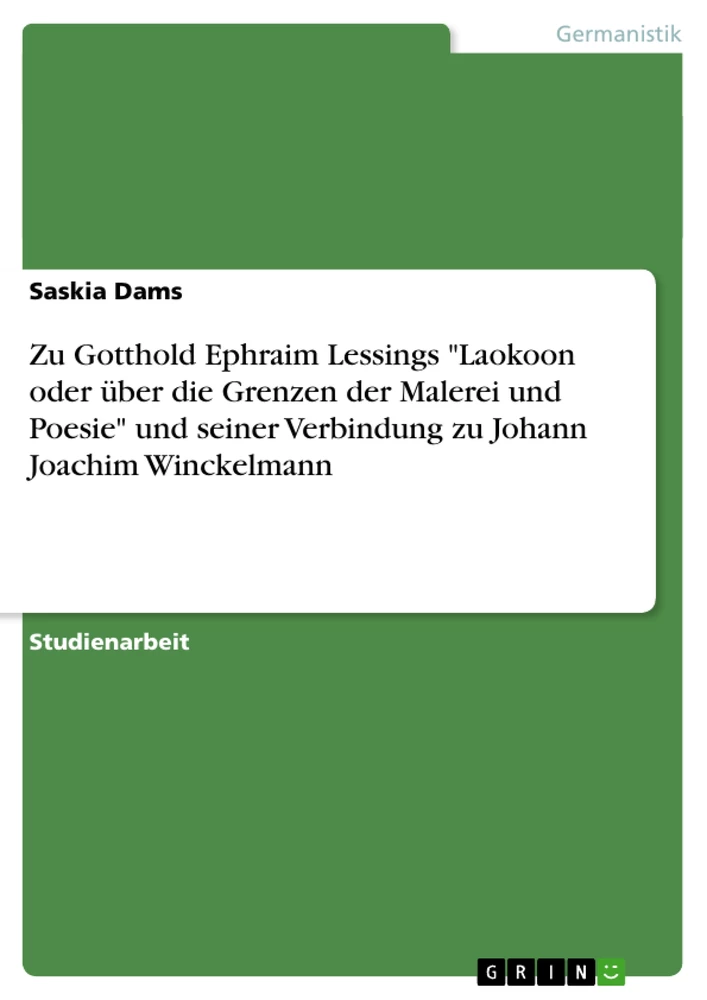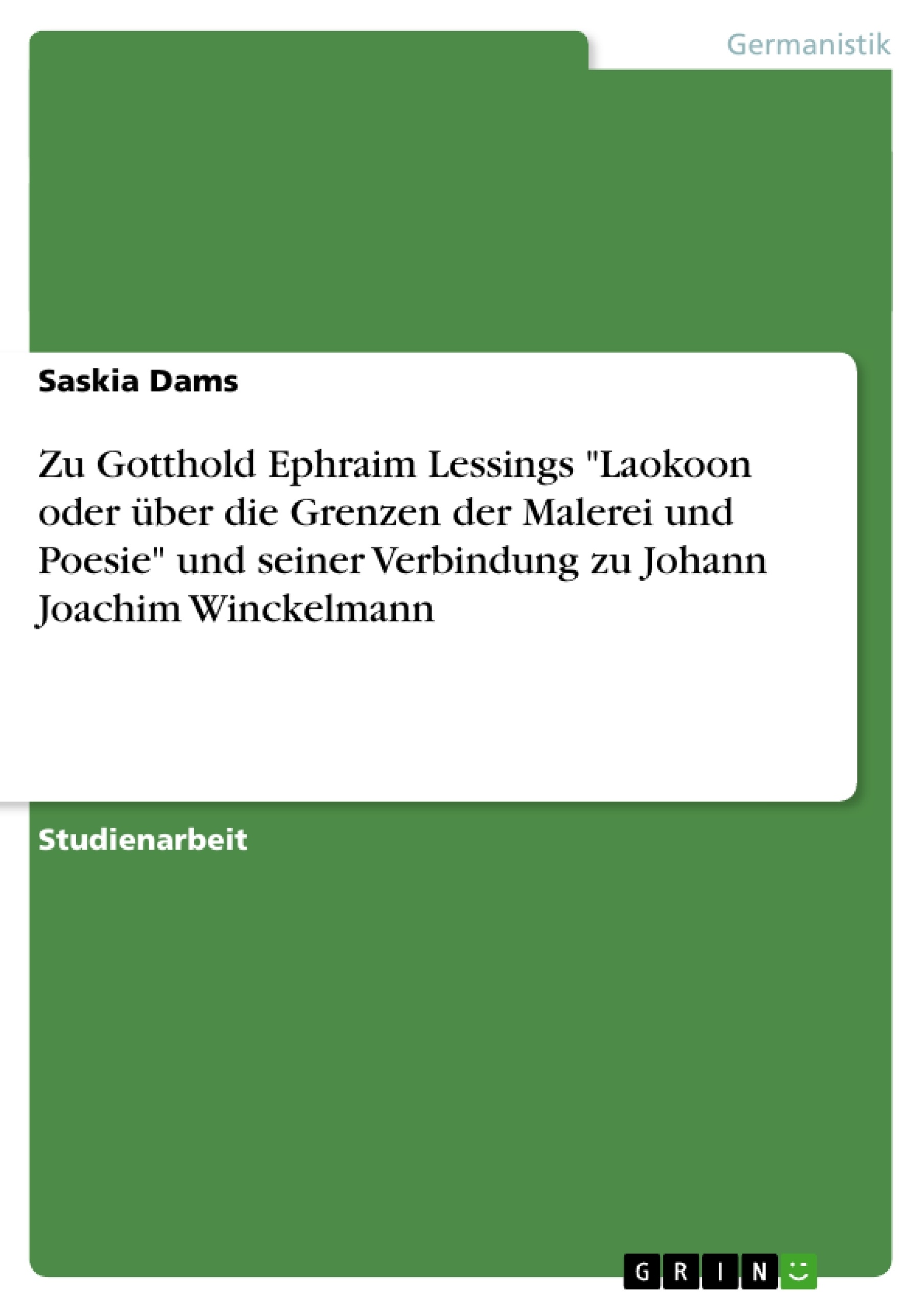Die späthellenistische Plastik, in der „barocke“ Ausdruckskraft und ein klassizistisches Epigonentum ineinanderwirken, galt als Musterbeispiel klassischer griechischer Skulptur und wurde zum Ausgangspunkt für die klassizistische Ästhetik. Ausschlaggebender Antrieb hierfür war auch Lessings „Laokoon“, der, als polemische Reaktion auf Winckelmanns „Gedanken“ von 1755 angelegt, auch im Nachhinein für eine Kette von Schriften sorgte. Das behandelte Grundproblem der Schrift, die Grenzbestimmung der Künste, wird schon seit der Antike versucht und auch direkt vor Lessing haben sich zahlreiche Kritiker wie Shaftesbury, Harris, Richardson, Burke, Dubos und Diderot mit ihm auseinandergesetzt.
Als Kritiker bezweckt Lessing zweierlei. Zum einen möchte er die Malerei von allem Barocken, Allegorischen und Emblematischen befreit sehen und die zum anderen die Dichtung gegen die modische Beschreibungspoesie verteidigen. 1 Die Dichtkunst sollte dann als kritische Waffe der Aufklärung dienen können. 2
In seiner Schrift geht es ihm darum, im Zusammenhang mit seiner Frage nach den Grenzen zwischen Poesie und Malerei die Unterschiede in der Darstellung des gleichen Motivs herauszufinden, die sich durch die Verschiedenheit der Mittel in den beiden Künsten ergeben. Die stringente Grenzziehung zwischen den Künsten aufgrund ihrer materialen Beschaffenheit und des Zeitbegriffes wurden von Lessing erstmals anhand ihrer eigenen Strukturgesetze abgeleitet.
Nach einem Rückblick auf die Tradition der Problematik und einigen Notizen zur Laokoongruppe selbst, sollen vielmehr die einschlägigen Textstellen dazu genutzt werden, den komplexen Gedankengang Lessings nachvollziehbar zu machen. Außerdem soll versucht werden, die im „Laokoon“ angesprochenen ästhetischen Schlüsselbegriffe Lessings denen Winckelmanns gegenüber zu stellen und zu vergleichen. Interessant wird hierbei zu beobachten sein, welche Meinung diese beiden herausragenden Männer voneinander hatten.
1 Vgl. STIERLE, , Karlheinz: Das bequeme Verhältnis. Lessings Laokoon und die Entdeckung des ästhetischen Mediums, in: Gebauer, Gunter (Hrsg.): Das Laokoon-Projekt. Pläne einer semiotischen Ästhetik, Stuttgart 1984 (= Studien zur allgemeinen und vergleichenden Literaturwissenschaft, Band 25), S. 38.
2 Vgl. BARTSCH, Gerhard: Laokoon oder Lessings Kritik am französisch-preußischen Akademismus, in: Lessing Yearbook XVI, 1984, S. 29.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Vorläufer der Problematik
- Die Laokoongruppe
- Die Antike aus der Sicht Winckelmanns
- Laokoon aus der Sicht Lessings
- Die Entstehung des „Laokoon“
- Die Frage der Nachahmung
- Der fruchtbare Augenblick
- Die Datierung der Skulpturengruppe
- Unterschiede und Gemeinsamkeiten
- Grenzen von Dichtung und bildender Kunst
- Beschreibende Poesie und Allegorie
- Schönheit
- Leidenschaften
- Mitleid
- Hässlichkeit und Ekel
- Auswirkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Gotthold Ephraim Lessings „Laokoon oder über die Grenzen der Malerei und Poesie" und dessen Verbindung zu Johann Joachim Winckelmann. Die Arbeit analysiert Lessings Kritik an der Malerei und der Dichtkunst und untersucht, wie er die beiden Kunstformen voneinander abgrenzt und die spezifischen Möglichkeiten und Grenzen der jeweiligen Kunstform definiert. Zudem wird die Verbindung Lessings zu Winckelmann untersucht, um die jeweiligen Positionen und den Einfluss der beiden Denker im Kontext der ästhetischen Debatte der Aufklärung herauszuarbeiten.
- Die Grenzen von Dichtung und bildender Kunst
- Die Rolle der Nachahmung in der Kunst
- Die Darstellung von Leidenschaften in der Kunst
- Der „fruchtbare Augenblick" in der bildenden Kunst
- Die ästhetischen Ideale der Antike
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des „Laokoon“ ein und stellt Lessings Kritik an der barocken Malerei und der modischen Beschreibungspoesie dar. Das zweite Kapitel beleuchtet die Vorläufer der Problematik, die sich mit der Grenzziehung zwischen Malerei und Poesie befasst haben. Es werden die Positionen verschiedener Denker wie Aristoteles, Horaz, Dio Chrysostomus, Ludovico Dolce, Joseph Spence, Graf Shaftesbury, Jonathan Richardson, Abbé Jean Baptiste Dubos, Denis Diderot, James Harris, Johann Joseph Breitinger, Johann Jacob Bodmer, Alexander Gottlieb Baumgarten, Christian Friedrich von Hagedorn und Moses Mendelssohn vorgestellt. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Laokoongruppe und stellt die Bedeutung der späthellenistischen Plastik als Musterbeispiel klassischer griechischer Skulptur dar. Das vierte Kapitel widmet sich Winckelmanns Sicht auf die Antike und untersucht seine ästhetischen Ideale.
Das fünfte Kapitel behandelt Lessings Sicht auf den Laokoon und untersucht die Entstehung seines Werkes, die Frage der Nachahmung, den „fruchtbaren Augenblick“ und die Datierung der Skulpturengruppe. Im sechsten Kapitel werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Lessings und Winckelmanns Positionen beleuchtet, wobei die Grenzen von Dichtung und bildender Kunst, die beschreibende Poesie und Allegorie, Schönheit, Leidenschaften, Mitleid, Hässlichkeit und Ekel thematisiert werden.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der Ästhetik der Aufklärung, wie der Grenzziehung zwischen Dichtung und bildender Kunst, der Rolle der Nachahmung, der Darstellung von Leidenschaften, dem „fruchtbaren Augenblick“, der Antike und den ästhetischen Idealen von Gotthold Ephraim Lessing und Johann Joachim Winckelmann.
- Quote paper
- M.A. Saskia Dams (Author), 2004, Zu Gotthold Ephraim Lessings "Laokoon oder über die Grenzen der Malerei und Poesie" und seiner Verbindung zu Johann Joachim Winckelmann, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32613