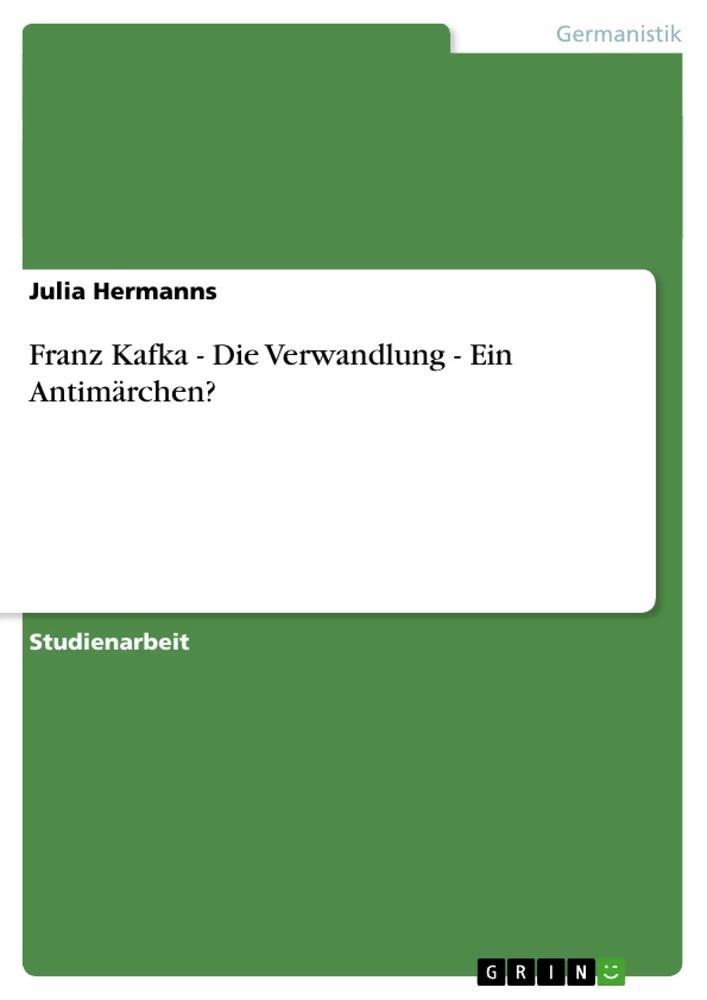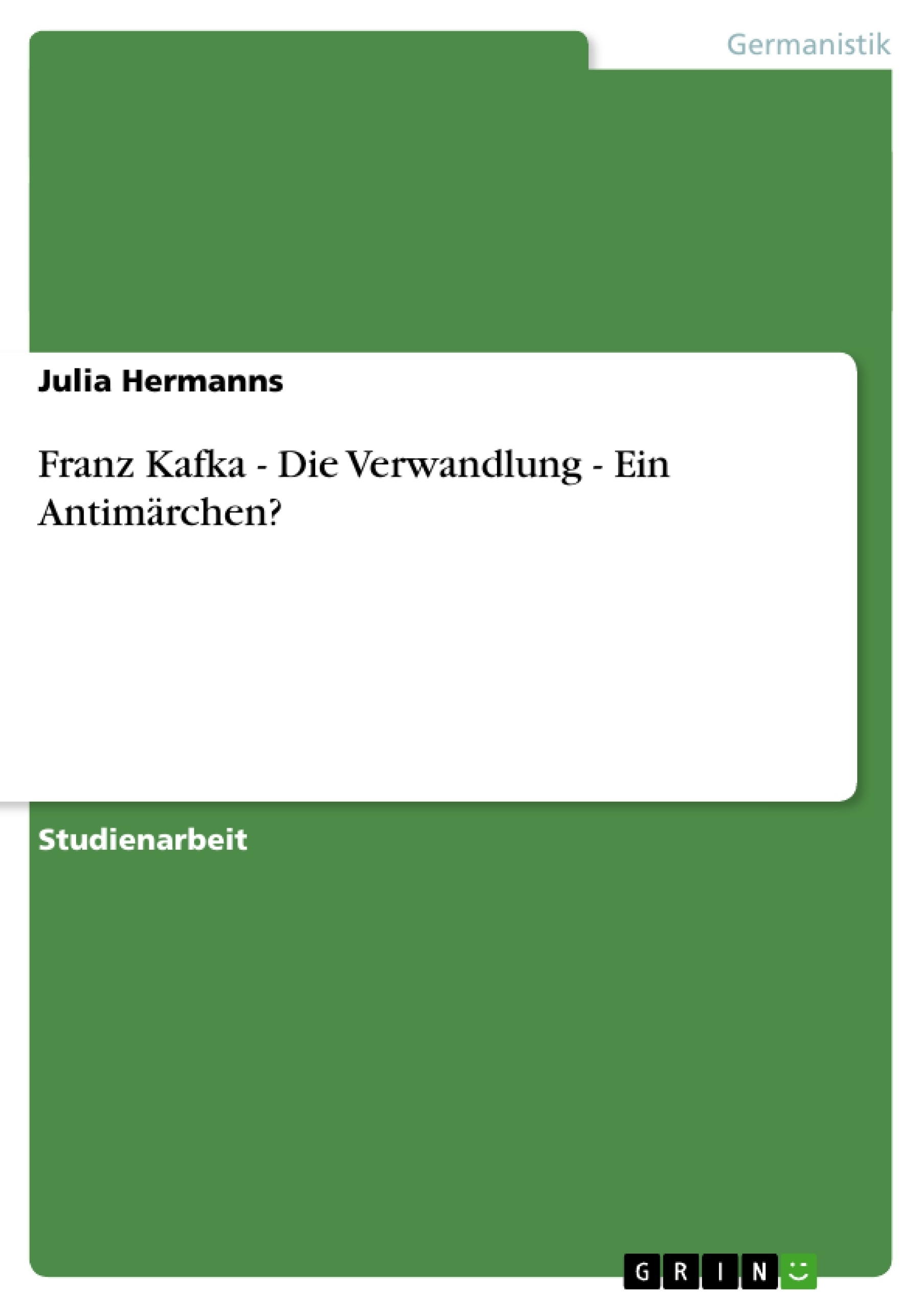„Das Groteske entwickelt sich in Kafkas Umformungen zu dem eigentlichen Pendant des Märchenhaften. Aufgebaut aus der gleichen Mischung von Realem und Phantastischen, erzählt aus der gleichen Einsinnigkeit der Perspektive, bedient es sich der Harmonie jener Erzählgattung, um den Leser aus der Illusion einer im Kunstwerk erstellten, heilen Welt zu reißen, ihm den `Boden unter den Füßen` wankend zu machen und das Gefühl der Unsicherheit gegenüber der bekannten Weltordnung hervorzurufen.“
Kafkas Erzählungen und Romane stimmen nicht mit der Welt überein, die wird durch unsere Sinne wahrnehmen. In seinen Werken treten sprechende und sich verwandelnde Tiere in Erscheinung. Diese Tierverwandlungen sind häufige Märchenmotive und auch Kafkas Erzählungen erscheinen in manchen Zügen fast wie ein Märchen. In der Sorge des Hausvaters erinnert Odradek z.B. an die Gestalt des Zwergs in manchen deutschen Märchen und auch die Erzählung Ein Landarzt enthält märchenhafte Züge. Denn Kafka hat in seinen Werken Figuren entwickelt, die aus dem Reich der Menschen, Tiere und Dinge entstammen. Er entstellt mit dieser Figurenkonzeption das Vertraute und macht das Fremde für uns unheimlich. Daher ist sehr verständlich, dass seine Texte immer wieder als Märchen eingeordnet werden und manchen Deuter dazu verleiten, dem rätselhaften Vorgang auf die Spur kommen zu wollen. Folglich gibt es über die motivlichen und strukturellen Parallelen zwischen dem Märchen und den Erzählungen Kafkas sehr verschiedene Untersuchungen, die sich aber oft ins allzu Fragliche und Abstrakte verlieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1) Die Gattung des Märchens
- 2) Der märchenhaft anmutende Vorgang der Verwandlung
- 2.1) Der Erzählanfang
- 2.2) Gregors Degradation ins Tierische
- 2.3) Die Schwester als Sinnbild für Gregors Erlösungssehnsucht
- Ausblick
- Literatur
- 1) Primärliteratur
- 2) Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Franz Kafkas "Die Verwandlung" auf ihre Beziehung zum Märchen. Ziel ist es, die strukturellen Parallelen und Unterschiede zwischen der Erzählung und der traditionellen Märchenform zu analysieren und die Frage zu beantworten, ob Kafka bewusst die Gattung des Märchens nutzt und ob die märchenhafte Gestaltung ein "Antimärchen" impliziert.
- Die Gattung des Märchens und ihre Strukturmerkmale
- Das Motiv der Verwandlung in Märchen und in Kafkas Erzählung
- Der Vergleich der "Verwandlung" mit traditionellen Märchenmotiven und -strukturen
- Die Rolle der Schwester als mögliches Sinnbild für Gregors unerfüllte Erlösungssehnsucht
- Die Frage nach dem "Antimärchen" und seiner Bedeutung im Kontext der Erzählung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor: die Beziehung von Kafkas "Die Verwandlung" zur Gattung des Märchens und die mögliche Interpretation als "Antimärchen". Sie führt in die Thematik ein, indem sie Kafkas Groteskes als Pendant zum Märchenhaften beschreibt und die unterschiedlichen Interpretationsansätze bezüglich der märchenhaften Elemente in Kafkas Werken beleuchtet. Die Einleitung betont die Diskrepanz zwischen Kafkas Erzählungen und der von den Sinnen wahrgenommenen Welt, und verweist auf die bereits bestehende, aber oft zu abstrakte Debatte über die motivlichen und strukturellen Parallelen zwischen Märchen und Kafkas Erzählungen.
1) Die Gattung des Märchens: Dieses Kapitel beschreibt die etablierte Form des Märchens nach Jolles und hebt die "naive Moral" des Märchens hervor, die sich in Kafkas Erzählungen nicht wiederfindet. Es wird betont, dass in Kafkas Werken eine erlösende Rückverwandlung des Protagonisten ausbleibt und die Erwartungen des Lesers an eine gerechte Welt gemäß der Märchenstruktur nicht erfüllt werden. Dieser Gegensatz wird als zentrales Merkmal von Kafkas "Antimärchen" dargestellt, welches die unmoralische Wirklichkeit der Welt als charakteristisches Strukturelement einbezieht.
2) Der märchenhaft anmutende Vorgang der Verwandlung: Dieses Kapitel analysiert das Motiv der Verwandlung in Märchen und in Kafkas "Die Verwandlung". Es vergleicht die Verwandlung in Kafkas Erzählung mit der Bestrafungsverwandlung in der Antike und in traditionellen Märchen, wobei die anonyme, undurchsichtige Macht hinter der Verwandlung hervorgehoben wird. Das Kapitel diskutiert die Rolle der Rückverwandlung in Märchen und deren Fehlen in Kafkas Erzählung. Es beleuchtet Kafkas Kenntnis der Grimmschen Märchen und anderer Quellen für seine phantastischen Elemente, wie z.B. Ovids Metamorphosen, und verweist auf seine ambivalente Haltung zum Märchen.
Schlüsselwörter
Franz Kafka, Die Verwandlung, Märchen, Antimärchen, Verwandlungsmotiv, Groteske, Erlösung, Realität, Moral, Grimmsche Märchen, Interpretation, literarische Gattung.
Häufig gestellte Fragen zu Franz Kafkas "Die Verwandlung" - Eine Märchenanalyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Franz Kafkas "Die Verwandlung" im Hinblick auf ihre Beziehung zur Gattung des Märchens. Es wird untersucht, ob Kafka bewusst märchenhafte Elemente einsetzt und ob die Erzählung als "Antimärchen" interpretiert werden kann. Die Analyse konzentriert sich auf strukturelle Parallelen und Unterschiede zwischen Kafkas Erzählung und traditionellen Märchen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Die Gattung des Märchens und ihre Strukturmerkmale, das Motiv der Verwandlung in Märchen und in Kafkas Erzählung, ein Vergleich der "Verwandlung" mit traditionellen Märchenmotiven und -strukturen, die Rolle der Schwester als mögliches Sinnbild für Gregors unerfüllte Erlösungssehnsucht und die Frage nach dem "Antimärchen" und seiner Bedeutung im Kontext der Erzählung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über die Gattung des Märchens, ein Kapitel über das Motiv der Verwandlung und einen Ausblick. Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung vor und führt in die Thematik ein. Kapitel 1 beschreibt die Merkmale des traditionellen Märchens und kontrastiert diese mit Kafkas Erzählung. Kapitel 2 analysiert das Motiv der Verwandlung in beiden Kontexten. Der Ausblick fasst die Ergebnisse zusammen und deutet mögliche weitere Forschungsansätze an. Zusätzlich enthält die Arbeit ein Literaturverzeichnis.
Wie wird die Verwandlung in der Arbeit analysiert?
Das Motiv der Verwandlung wird im Kontext von traditionellen Märchen und der Antike untersucht. Es wird der Vergleich angestellt zwischen Bestrafungsverwandlungen in Märchen und der Transformation Gregors. Die Arbeit beleuchtet das Fehlen einer erlösenden Rückverwandlung in Kafkas Erzählung und diskutiert die ambivalente Haltung Kafkas zum Märchen.
Welche Rolle spielt die Schwester in der Analyse?
Die Rolle der Schwester wird im Kontext von Gregors möglicher Erlösungssehnsucht analysiert. Sie wird als ein mögliches Sinnbild für diese Sehnsucht betrachtet, ohne jedoch eine definitive Interpretation vorwegzunehmen.
Was ist ein "Antimärchen" im Kontext dieser Arbeit?
Ein "Antimärchen" wird in dieser Arbeit als eine Erzählung verstanden, die die Struktur und Motive des Märchens aufgreift, jedoch deren implizite Moral und die Erwartung einer erlösenden Gerechtigkeit subvertiert. Kafkas "Verwandlung" wird unter diesem Aspekt betrachtet, da sie die unmoralische Wirklichkeit der Welt als charakteristisches Strukturelement einbezieht.
Welche Quellen werden in der Arbeit herangezogen?
Die Arbeit bezieht sich auf Primärliteratur (Franz Kafkas "Die Verwandlung") und Sekundärliteratur, unter anderem auf die Märchenforschung und Interpretationen von Kafkas Werk. Es wird explizit auf die Grimmschen Märchen und Ovids Metamorphosen verwiesen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Franz Kafka, Die Verwandlung, Märchen, Antimärchen, Verwandlungsmotiv, Groteske, Erlösung, Realität, Moral, Grimmsche Märchen, Interpretation, literarische Gattung.
- Quote paper
- Julia Hermanns (Author), 2004, Franz Kafka - Die Verwandlung - Ein Antimärchen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32497