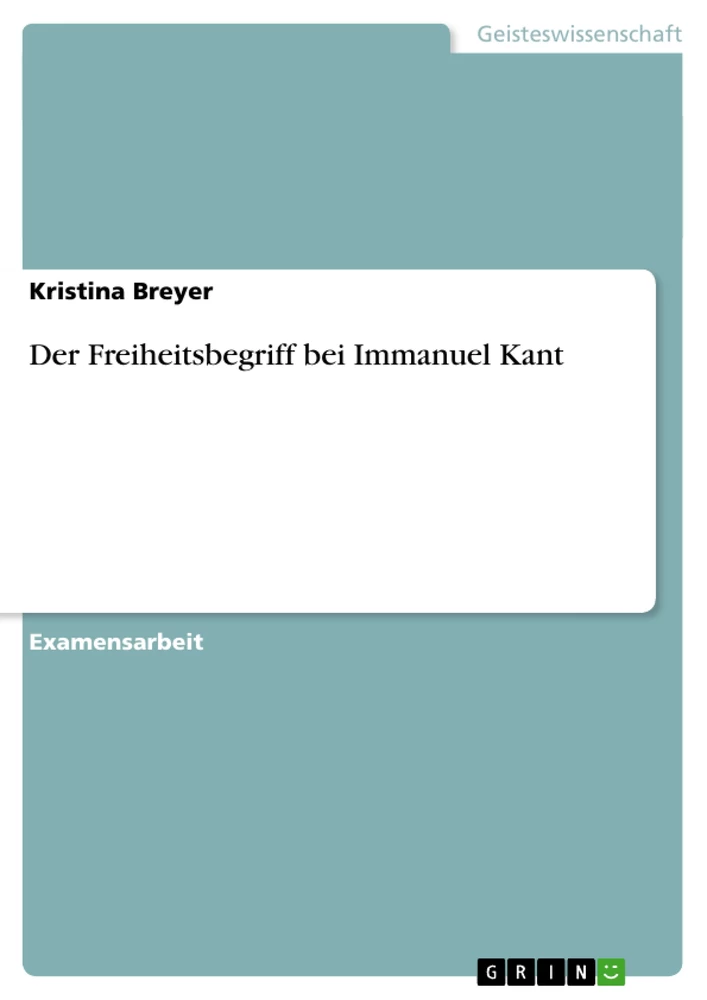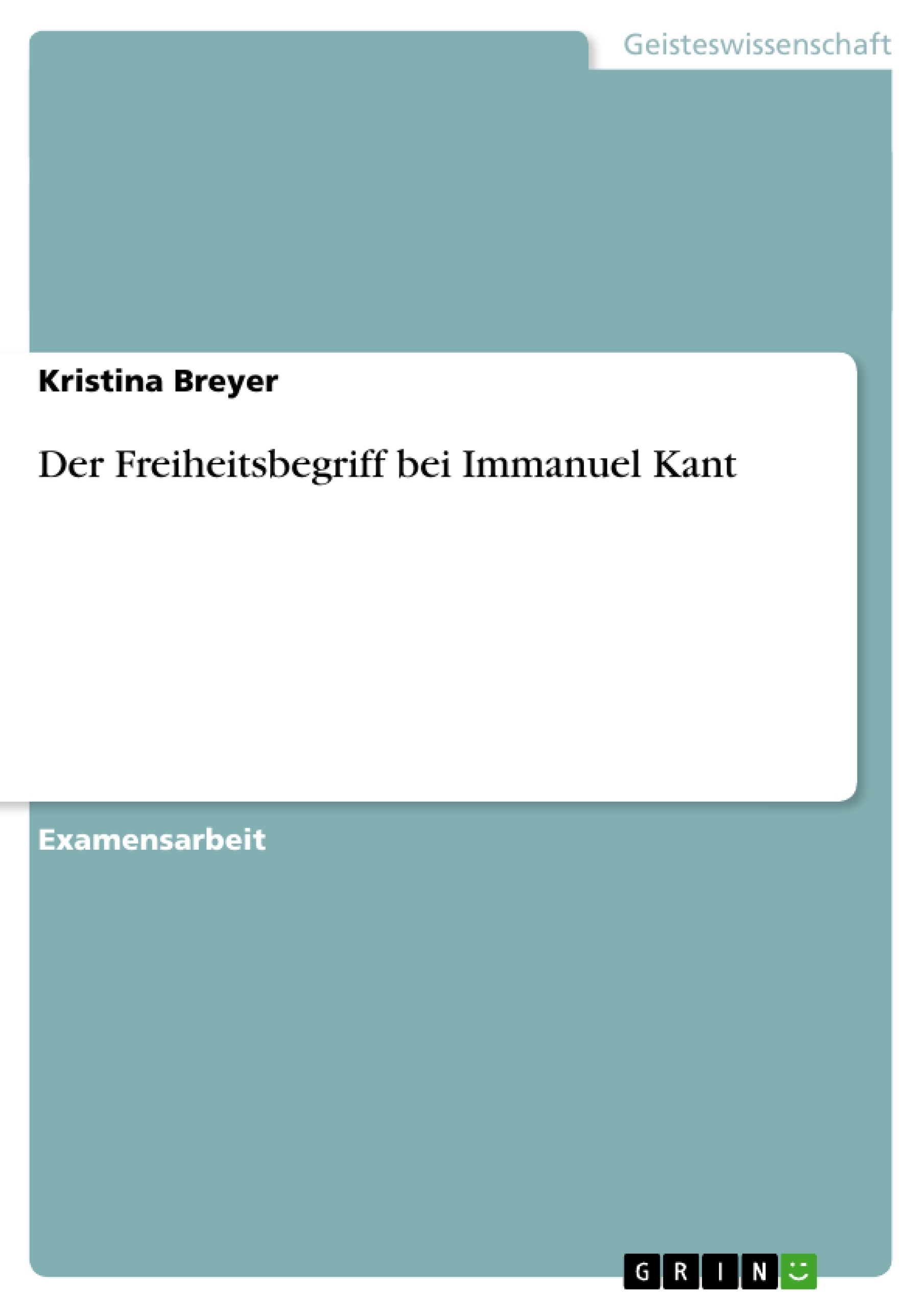Jeder Mensch geht davon aus, dass er selbstbestimmt handelt und denkt – jeder fühlt sich frei. Wie könnte man sonst auch behaupten „Ich handle“? An diesem Satz ist entweder das „Ich“ falsch, oder ich bin in meinem Handeln frei von bestimmenden Ursachen. Ohne die Annahme, in unseren Überlegungen und Entscheidungen frei zu sein, gäbe es gar keine Berechtigung, von sich selbst in der 1. Person Singular zu sprechen. Vielmehr müsste man dann davon sprechen, dass „Es“ handelt, in dem Sinne, dass „mein“ Handeln und Denken stets von Ursachen bestimmt wird, die sich jenseits meines Kontrollbereiches befinden. Die totale Determination durch heteronome Bestimmungsgründe würden das „Ich“ aufheben – und dem Selbstbild der Menschen als eines frei Handelnden entgegenstehen.
So deutlich die Freiheit des Willens erfahren wird, so schwer ist sie zu begründen. Denn sie steht im Gegensatz zur Bedingung aller Naturerkenntnis, nämlich der notwendigen Verknüpfung von Ursachen und Wirkungen. Unter den Naturerscheinungen gibt es keine, die ohne Ursache gedacht werden kann. Hier ist jede Erscheinung in einer Kausalkette verortet. Wieso sollte da ausgerechnet der Mensch, der ja auch Naturerscheinung ist, frei handeln können? Die für das Selbstverständnis der Menschen essenzielle Annahme seiner Freiheit bedarf also einer plausiblen Begründung, um sich gegen die umfassende Kausalität der Natur zu behaupten. Für Kant ist es die
„unnachlaßliche Aufgabe der spekulativen Philosophie: wenigstens zu zeigen, daß ihre Täuschungen wegen des Widerspruchs [zwischen Freiheit und Naturkausalität] darin beruhe, daß wir den Menschen in einem anderen Sinne und Verhältnisse denken, wenn wir ihn frei nennen, als wenn wir ihn, als Stück Natur, dieser ihren Gesetzen für unterworfen halten, und daß beide nicht allein gar wohl beisammen stehen können, sondern auch, als notwendig vereinigt, in demselben Subjekt gedacht werden müssen [...]“ (GMS 116).
Mir geht es in der vorliegenden Arbeit darum, die Bedeutung aufzuzeigen, die der Freiheitsidee in der Kritik der reinen Vernunft sowie in den beiden moralphilosophischen Hauptschriften Kants, der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten und der Kritik der praktischen Vernunft zukommt. Die Arbeit untergliedert sich in zwei Teile. Das Ziel des ersten Teils liegt darin, den Weg nachzuvollziehen, auf dem Kant Freiheit und Kausalität als „notwendig vereinigt in demselben Subjekt“ denkbar macht. Als Textgrundlage dient dazu die Kritik der reinen Vernunft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die transzendentale Freiheit in der „Kritik der reinen Vernunft“
- Die Revolution der Denkart
- Das transzendentale Subjekt.
- Die Antinomie der Vernunft
- Die dritte Antinomie.
- Thesis......
- Antithesis..
- Auflösung...
- Die Idee der transzendentale Freiheit als absolute Spontaneität.
- Der Perspektivwechsel der Vernunft – eine menschliche Hybris?
- Die Freiheit im praktischen Verstande
- Die kritische Ethik..
- Die transzendentale Willensfreiheit.
- Kants Ziel: Eine reine Moralphilosophie.......
- Das Sittengesetz
- Der kategorische Imperativ
- Der Wille als Vermögen der Handlungsbestimmung
- Subjektive Maximen und objektives Gesetz.
- Der Wille als freie Kausalität..
- Das Faktum der Vernunft
- Die Einheit von Sollen und Wollen
- Die Autonomie des Willens
- Das Gefühl der Achtung..
- Von der Wichtigkeit moralischer Gesetze
- Die intellektuelle Selbstzufriedenheit
- Der Mensch als Zweck an sich selbst....
- Ist Kants Freiheitsbegriff heute noch aktuell?
- Die Verbindung von Freiheit und Kausalität in Kants Philosophie
- Die Rolle der transzendentalen Freiheit in der „Kritik der reinen Vernunft“
- Die Begründung einer reinen Moralphilosophie durch Kant
- Der kategorische Imperativ als Ausdruck der Autonomie des Willens
- Die Relevanz des kantischen Freiheitsbegriffs für das Selbstverständnis des Menschen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert Kants Freiheitsbegriff im Kontext seiner kritischen Philosophie. Sie zielt darauf ab, die Bedeutung der Freiheitsidee in Kants Hauptwerken, insbesondere der „Kritik der reinen Vernunft“, der „Grundlegung zur Metaphysik der Sitten“ und der „Kritik der praktischen Vernunft“ aufzuzeigen. Dabei werden sowohl die transzendentale Freiheit als auch die moralische Autonomie beleuchtet.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Freiheit im Selbstverständnis des Menschen ein und beleuchtet die Problematik, die aus der scheinbaren Unvereinbarkeit von Freiheit und Naturkausalität resultiert.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der transzendentalen Freiheit in der „Kritik der reinen Vernunft“. Hier wird Kants revolutionäre Denkart, das transzendentale Subjekt und die Antinomie der Vernunft näher beleuchtet.
Das dritte Kapitel widmet sich der Freiheit im praktischen Verstand. Es analysiert die kritische Ethik, die transzendentale Willensfreiheit und Kants Ziel einer reinen Moralphilosophie.
Das vierte Kapitel untersucht das Sittengesetz und den kategorischen Imperativ als Ausdruck der moralischen Autonomie des Willens.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen der kantischen Philosophie, darunter Freiheit, Kausalität, transzendentale Freiheit, moralische Autonomie, Kategorischer Imperativ, Willensfreiheit und das Selbstverständnis des Menschen.
- Citation du texte
- Kristina Breyer (Auteur), 2002, Der Freiheitsbegriff bei Immanuel Kant, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32464