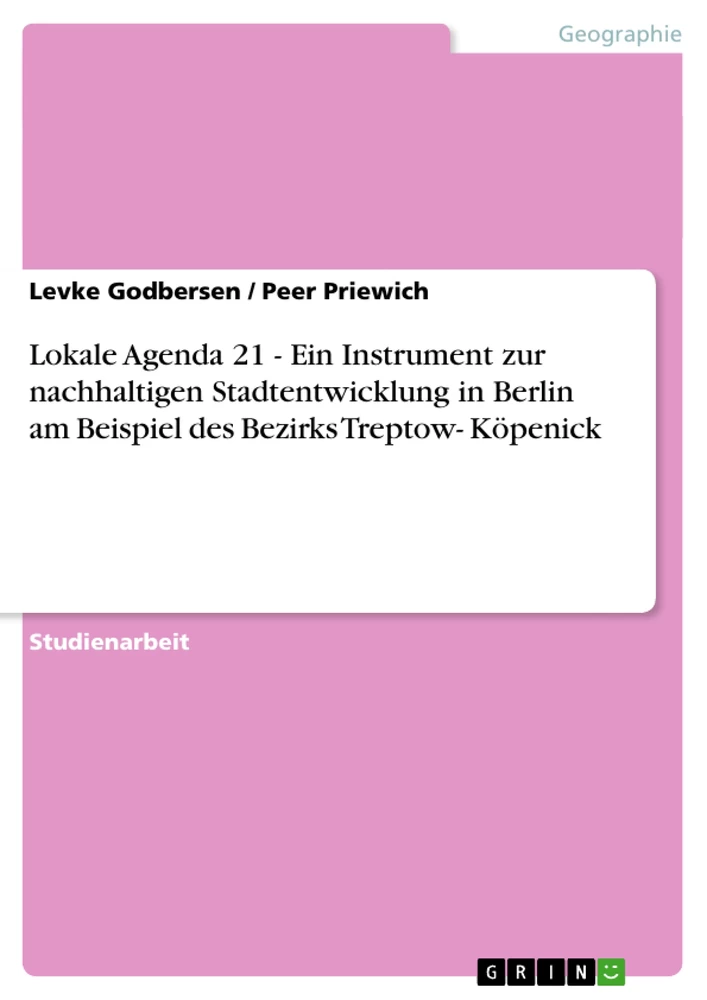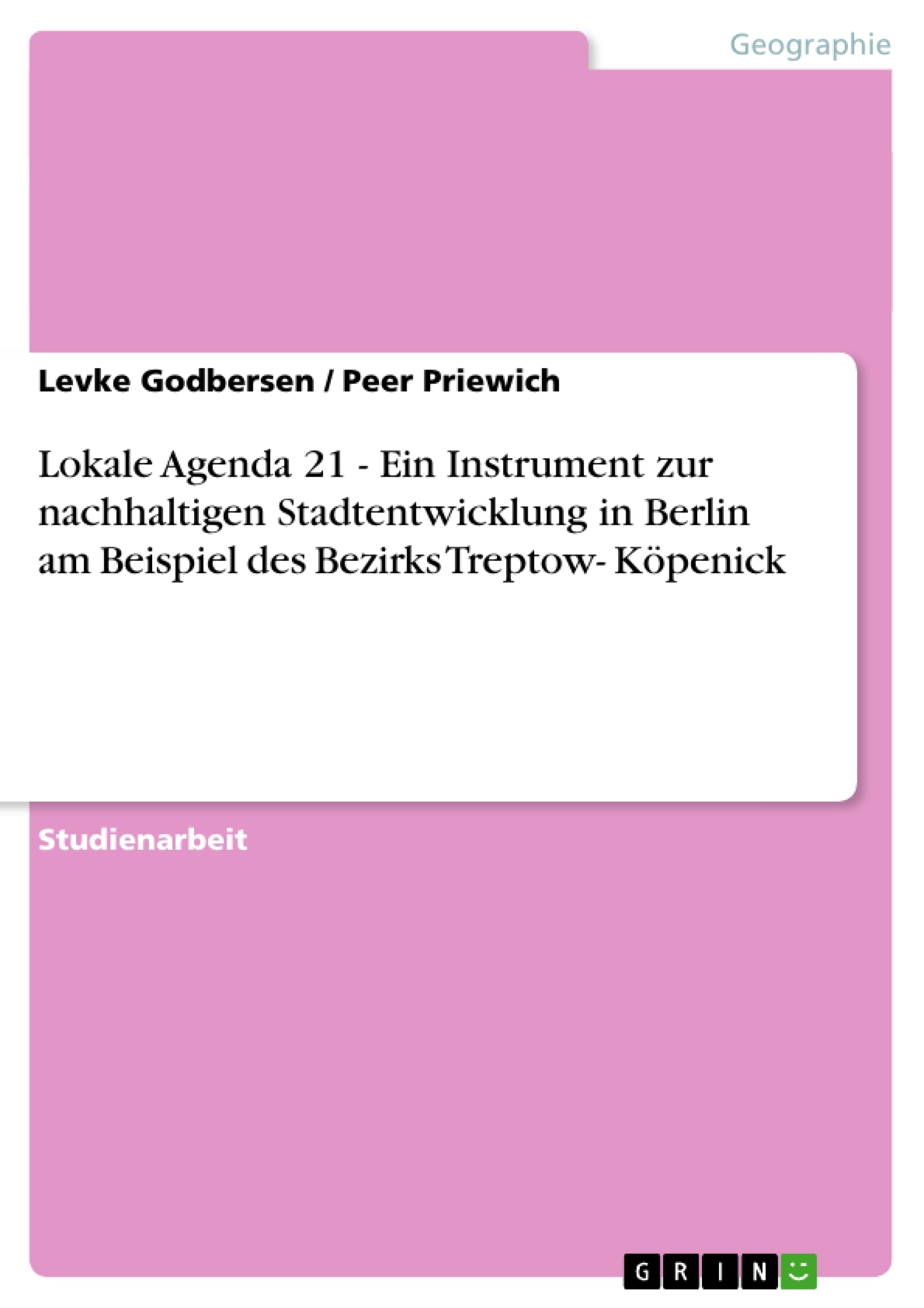Am Beginn eines jeden Buches oder Artikels, der lokale Agenden 21 zum Thema hat, wird der innovative, ganzheitliche und zukunftsfähige Charakter der lokalen Agenden 21 auf dem Weg zu einer nachhaltigen Nutzung der Erde gelobt. Quasi ein Allheilmittel für die Krankheiten der Welt. Ganzheitlich meint hier die Einbeziehung sowohl ökologischer, ökonomischer als auch sozialer Aspekte und die Berücksichtigung der Interessen aller gesellschaftlichen Gruppen in jedem Planungsbereich. Über die Bedeutung der Begriffe Nachhaltigkeit oder Zukunftsfähigkeit, die vom englischen Begriff „sustainability” abgeleitet wurden, gab es in der jüngeren Vergangenheit viele Interpretationsversuche, weshalb im Rahmen dieser Arbeit auf eine weitreichende Interpretation verzichtet werden soll. Nur eine kurze Definition, um klar zu machen was gemeint ist: Nachhaltigkeit hat die Bewahrung der Leistungsfähigkeit vorhandener Potentiale oder die Erschließung neuer Potentiale mit gleicher Leistungsfähigkeit zur dauerhaften Sicherung natürlicher Grundlagen und der Existenz der Menschheit zum Ziel.1 In den Begriffen „Ganzheitlich“ und „Nachhaltigkeit“ stellt sich auch schon das Problem der Agenda 21, ob sie in dem geforderten Maße umsetzbar ist, oder ob es von den Kommunen nicht zu viel verlangt ist, zwar in kleinem Maßstab, die Krankheiten der Welt zu heilen.
Diese Arbeit soll einen Einblick in die lokalen Agenda 21 Prozesse geben. Voraussetzung hierfür ist das Wissen, was die Agenda 21 ist, weswegen im nachfolgenden Kapitel eine Einführung in die Agenda 21 gegeben wird. Hier werden die UNCED2 in Rio de Janeiro und ihre Dokumente, im Speziellen die Agenda 21, vorgestellt. Der Artikel 28, der die Rolle der Kommunen hervorhebt und die Aufstellung einer lokalen Agenda 21 in jeder Kommune fordert, wird genauer erläutert. Im darauf folgenden Kapitel wird der lokale Agenda- Prozess in Deutschland sowie die Akteure der Lokalen Agenda 21 in Berlin vorgestellt. Im Anschluss werden die zur Überprüfung der Qualität einer lokalen Agenda notwendigen Indikatoren und Ansätze zur Indikatorenfindung vorgestellt. Am Beispiel Treptow- Köpenick wird dann ein Umsetzungsbeispiel gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Einführung in die Agenda 21
- 2.1. UNCED in Rio de Janeiro 1992
- 2.2. Die Agenda 21
- 2.3. Der Artikel 28
- 3. Lokale Agenda 21 in Deutschland an Beispielen aus Berlin
- 3.1. Lokale Agenda Prozesse
- 3.1.1. Dialog
- 3.1.2. Handlungsprogramm und Leitbilder
- 3.1.3. Die Systematische Umsetzung der Ziele
- 3.2. Akteure der Lokale Agenda 21 in Berlin
- 4. Indikatoren
- 4.1. Entwicklungsstand und Funktionen von Indikatoren-systemen
- 4.2. Bildung von Indikatoren
- 4.3. Bildung einer lokalen Agenda21
- 5. Lokale Agenda21 Treptow Köpenick
- 5.1. Der Bezirk Treptow-Köpenick
- 5.1.1. Das politische Mandat
- 5.1.2. Erarbeitung der lokalen Agenda21
- 5.1.3. Fertigstellung der lokalen Agenda21
- 5.2. Akteure der Agenda21 in Treptow-Köpenick
- 5.3. Die Themenfelder der lokaler Agenda
- 5.4. Die Leitbilder der lokalen Agenda des Bezirks
- 5.5. Indikatoren der lokalen Agenda
- 5.5.1. Ansatz für das Lokale Indikatoren-system
- 5.5.2. Berechnung des Nachhaltigkeitsindex
- 5.6. Agendaprojekte
- 5.7. Fortführung der Agenda
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Konzept der lokalen Agenda 21 und untersucht dessen Umsetzung am Beispiel des Bezirks Treptow-Köpenick in Berlin. Die Arbeit zielt darauf ab, die Bedeutung der lokalen Agenda 21 als Instrument für eine nachhaltige Stadtentwicklung zu beleuchten und deren konkrete Anwendung in einem Berliner Bezirk aufzuzeigen.
- Die Agenda 21 als globales Konzept und ihre Relevanz für die lokale Ebene
- Der Prozess der lokalen Agenda 21-Entwicklung und -Umsetzung
- Die Rolle von Akteuren und Beteiligten in der lokalen Agenda 21
- Die Bedeutung von Indikatoren für die Erfolgsmessung und Weiterentwicklung
- Das Beispiel Treptow-Köpenick als Fallstudie für die Umsetzung der lokalen Agenda 21
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird der innovative und zukunftsfähige Charakter der lokalen Agenda 21 im Kontext der nachhaltigen Entwicklung beleuchtet. Der Begriff „Nachhaltigkeit“ wird definiert, wobei die Bewahrung und Erschließung von Potentialen zur Sicherung der natürlichen Grundlagen im Vordergrund steht. Das Kapitel unterstreicht auch die Herausforderungen bei der Umsetzung der Agenda 21 auf kommunaler Ebene.
Kapitel 2 bietet eine Einführung in die Agenda 21, die aus der UNCED in Rio de Janeiro 1992 resultierte. Die Konferenz und ihre fünf Dokumente, darunter die Agenda 21 als Aktionsprogramm für nachhaltige Entwicklung, werden vorgestellt. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Artikel 28, der die Rolle der Kommunen in der Umsetzung der Agenda 21 hervorhebt.
Das dritte Kapitel betrachtet die Umsetzung der lokalen Agenda 21 in Deutschland, insbesondere am Beispiel Berlins. Es werden die Prozesse der lokalen Agenda 21, die beteiligten Akteure und die systematische Umsetzung der Ziele beleuchtet.
Kapitel 4 befasst sich mit Indikatoren, die für die Überprüfung der Qualität einer lokalen Agenda unerlässlich sind. Die Funktionen von Indikatoren-systemen, die Bildung von Indikatoren und deren Rolle bei der Gestaltung einer lokalen Agenda 21 werden erläutert.
Im fünften Kapitel wird die lokale Agenda 21 im Bezirk Treptow-Köpenick vorgestellt. Der Bezirk selbst, die Chronik der lokalen Agenda 21-Entwicklung und die beteiligten Akteure werden beschrieben. Darüber hinaus werden die Themenfelder, Leitbilder, Indikatoren und Agendaprojekte des Bezirks beleuchtet.
Schlüsselwörter
Lokale Agenda 21, nachhaltige Stadtentwicklung, Umwelt und Entwicklung, UNCED, Rio de Janeiro, Artikel 28, Indikatoren, Treptow-Köpenick, Berlin, Akteure, Themenfelder, Leitbilder, Agendaprojekte, Nachhaltigkeit.
- Quote paper
- Levke Godbersen (Author), Peer Priewich (Author), 2004, Lokale Agenda 21 - Ein Instrument zur nachhaltigen Stadtentwicklung in Berlin am Beispiel des Bezirks Treptow- Köpenick, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32455