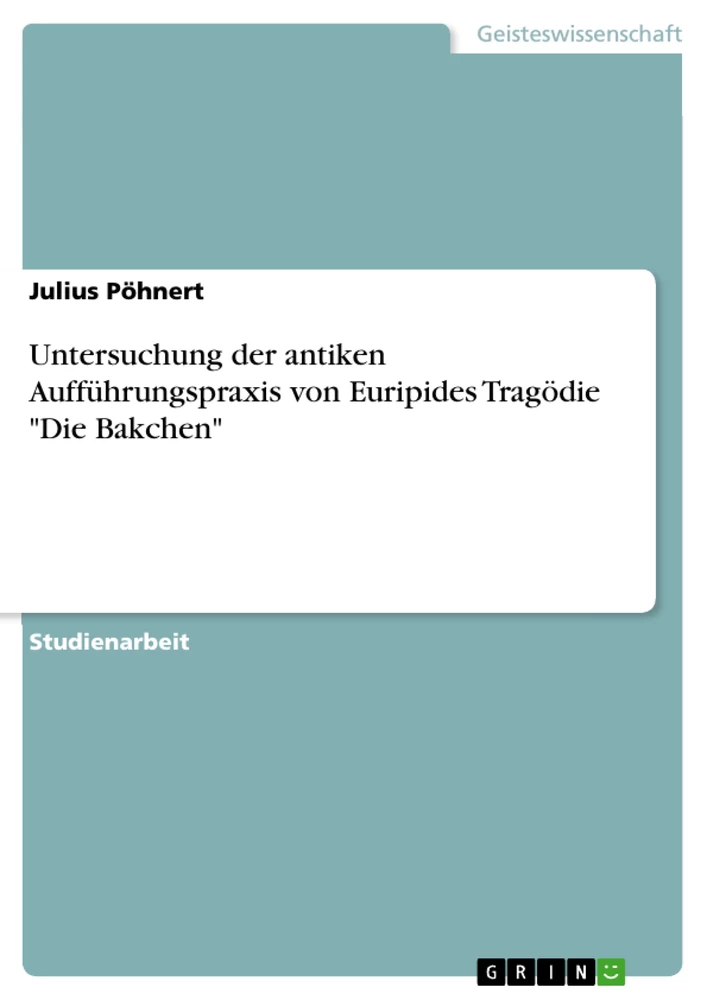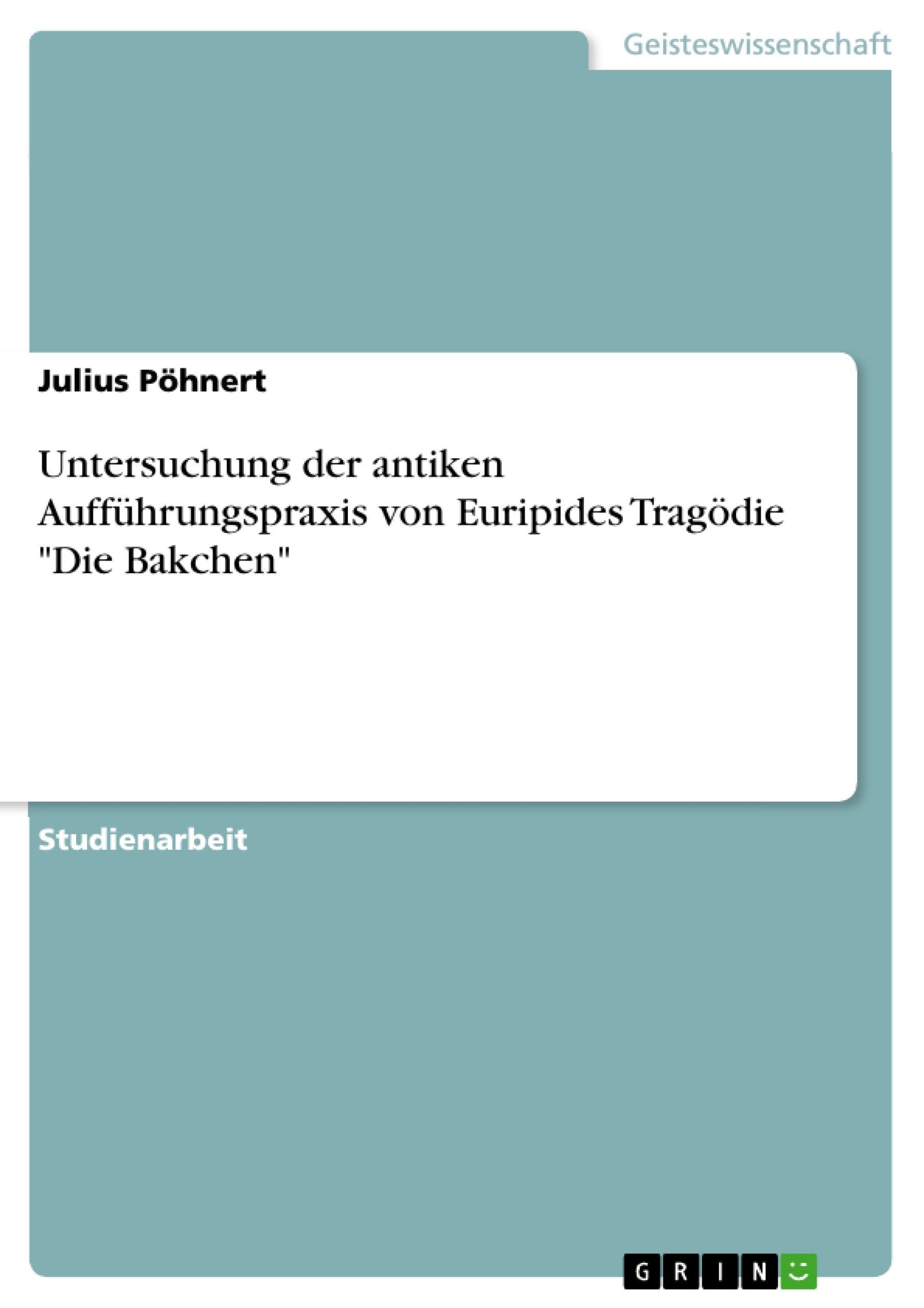Mit den „Backchen“ gewann Euripides kurz nach seinem Tod den ersten Preis auf den Dionysien 406 v. Chr.. Diese Ehrung mag einerseits eine Anerkennung Euripides’ Lebenswerk darstellen, da zu Lebzeiten seine Stücke verhältnismäßig selten – nur fünf mal – als Sieger aus den Wettbewerben hervorgingen. Dennoch zeigt der Erfolg des Stückes, dass es sich großer Beliebtheit erfreute und den Zeitgeist des Publikums traf. Neben der nie geklärten inhaltlichen Diskussion, ob sich Euripides in den „Bakchen“ pro oder contra Dionysos stellt, kommt die Frage nach der zeitgenössischen inszenatorischen Praxis des Stückes auf, die zumal Aufschlüsse über Euripides’ Weltbild geben kann.
Euripides’ Ableben vor der Aufführung der „Bakchen“ sowie seine Abwesenheit von Athen und sein Aufenthalt in Makedonien seit 408 v. Chr. belegen, dass Euripides selbst kaum eine Kontrolle über die Inszenierung seiner letzten Tragödie haben konnte. Dennoch stellt dies für das Ziel dieser Arbeit, der Spektakularität der antiken „Bakchen“-Aufführung nachzuspüren und Besonderheiten in der Inszenierung festzustellen, kaum ein Problem dar. Eine wesentliche Quelle bietet der heute vorliegende Text der „Bakchen“ in der deutschen Übersetzung von Oskar Werner. Die hier vorhandenen Hinweise auf die Inszenierungstechniken lassen bedeutende Rückschlüsse zu. Weiterhin sind unter Zuhilfenahme der – dem gegenwärtigen Forschungsstand bekannten – Theatersituation Ende des fünften Jahrhunderts v. Chr. und deren nachweisbaren Praktiken zahlreiche grundlegende Hinweise über die Theaterpraxis der Antike entnehmbar. Besondere Bedeutung kommt hier den Analyseergebnissen Peter D. Arnotts zu, der in seinem Buch auf viele bedeutende Details der antiken Theaterpraxis hinweist. Auch die Nachforschungen von Siegfried Melchinger und die Recherchen von Bernhard Zimmermann geben eine erhebliche Hilfestellung.
Somit lässt sich auf die historischen Möglichkeiten schließen, die der Inszenierung der „Bakchen“ gegeben waren. Welche gesellschaftsrezeptorische und theatergeschichtliche Bedeutung aufgrund dessen den „Bakchen“ zukommt, soll in einer abschließenden Analyse festgestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die antiken Aufführungsbedingungen zur Zeit Euripides'
- Das Potenzial der „Bakchen“
- Die Darsteller
- Der Chor
- Die Zuschauer
- Sozialer, kultureller und politischer Kontext
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Aufführungspraxis von Euripides' Tragödie „Die Bakchen“ im antiken Athen. Ziel ist es, die Inszenierungstechniken und Besonderheiten der Aufführung im Kontext der damaligen gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Bedingungen zu rekonstruieren und deren Bedeutung für das Verständnis des Stücks zu analysieren.
- Rekonstruktion der Aufführungsbedingungen im Dionysostheater
- Analyse der Inszenierungstechniken im Hinblick auf den Text
- Bedeutung der Bühnenbildgestaltung für die Wirkung des Stücks
- Der Einfluss des sozialen und politischen Kontextes auf die Inszenierung
- Die Rezeption der „Bakchen“ im antiken Athen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert die Bedeutung der „Bakchen“ als siegreiches Stück von Euripides kurz vor seinem Tod. Sie skizziert die Forschungsfrage nach der Inszenierungspraxis und benennt die wichtigsten Quellen für die Untersuchung: den Text der „Bakchen“, Forschungsergebnisse von Arnott, Melchinger und Zimmermann, sowie den Forschungsstand zur antiken Theaterpraxis. Das Ziel der Arbeit ist die Analyse der Inszenierung und deren gesellschaftsrezeptorische und theatergeschichtliche Bedeutung.
2. Die antiken Aufführungsbedingungen zur Zeit Euripides': Dieses Kapitel beschreibt die Aufführungsbedingungen im Dionysostheater in Athen. Es beleuchtet die räumlichen Gegebenheiten, die Größe des Theaters und der Bühne (Orchestra und Skene), die Zugänge (Parodoi) und die besondere Bedeutung des Ortes der Handlung (vor dem Königspalast von Theben am Grab der Semele). Die Analyse umfasst die Interpretation des Bühnenbildes und die Herausforderungen der Inszenierung, insbesondere im Hinblick auf die Darstellung des einstürzenden Palastes, welcher eher der Phantasie der Zuschauer überlassen wurde, als tatsächlich auf der Bühne dargestellt. Die Diskussion der vorhandenen Quellen und deren Grenzen bezüglich der Rekonstruktion der antiken Aufführungspraxis ist ein wichtiger Bestandteil.
Häufig gestellte Fragen zu: Aufführungspraxis der Bakchen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Aufführungspraxis von Euripides' Tragödie „Die Bakchen“ im antiken Athen. Das Ziel ist die Rekonstruktion der Inszenierungstechniken und Besonderheiten der Aufführung im Kontext der damaligen gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Bedingungen und deren Bedeutung für das Verständnis des Stücks.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rekonstruktion der Aufführungsbedingungen im Dionysostheater, die Analyse der Inszenierungstechniken im Hinblick auf den Text, die Bedeutung der Bühnenbildgestaltung, den Einfluss des sozialen und politischen Kontextes auf die Inszenierung und die Rezeption der „Bakchen“ im antiken Athen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über die antiken Aufführungsbedingungen zur Zeit Euripides', ein Kapitel über das Potenzial der „Bakchen“ (inkl. Darsteller, Chor und Zuschauer), ein Kapitel zum sozialen, kulturellen und politischen Kontext und ein Schlusswort.
Wie werden die Aufführungsbedingungen rekonstruiert?
Die Rekonstruktion der Aufführungsbedingungen im Dionysostheater basiert auf der Analyse des Textes der „Bakchen“, Forschungsergebnissen von Arnott, Melchinger und Zimmermann, sowie dem Forschungsstand zur antiken Theaterpraxis. Es werden die räumlichen Gegebenheiten des Theaters (Orchestra, Skene, Parodoi), die Bedeutung des Ortes der Handlung (vor dem Königspalast von Theben) und die Herausforderungen der Inszenierung, insbesondere im Hinblick auf die Darstellung des einstürzenden Palastes, untersucht.
Welche Quellen werden verwendet?
Die wichtigsten Quellen sind der Text der „Bakchen“ selbst sowie Forschungsergebnisse von Arnott, Melchinger und Zimmermann und der allgemeine Forschungsstand zur antiken Theaterpraxis. Die Arbeit diskutiert auch die Grenzen der verfügbaren Quellen für die Rekonstruktion der antiken Aufführungspraxis.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist die Analyse der Inszenierung der „Bakchen“ und deren gesellschaftsrezeptorische und theatergeschichtliche Bedeutung. Es geht darum, ein umfassendes Bild der Aufführungspraxis im antiken Athen zu zeichnen und deren Einfluss auf das Verständnis des Stücks aufzuzeigen.
Welche Aspekte des Bühnenbilds werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die Bedeutung der Bühnenbildgestaltung für die Wirkung des Stücks und untersucht die Herausforderungen der Inszenierung, insbesondere die Darstellung des einstürzenden Palastes, der eher der Phantasie der Zuschauer überlassen wurde, als tatsächlich auf der Bühne dargestellt zu werden.
Wie wird der soziale, kulturelle und politische Kontext berücksichtigt?
Die Arbeit untersucht den Einfluss des sozialen und politischen Kontextes auf die Inszenierung der „Bakchen“ und berücksichtigt die gesellschaftliche Rezeption des Stücks im antiken Athen.
- Quote paper
- Julius Pöhnert (Author), 2004, Untersuchung der antiken Aufführungspraxis von Euripides Tragödie "Die Bakchen", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32453