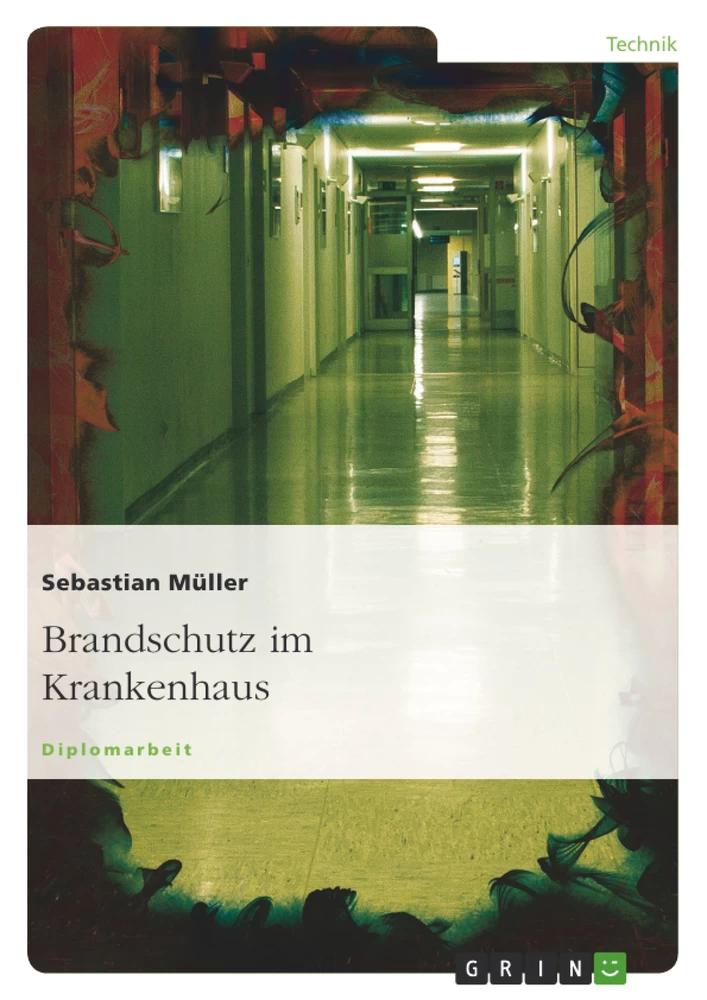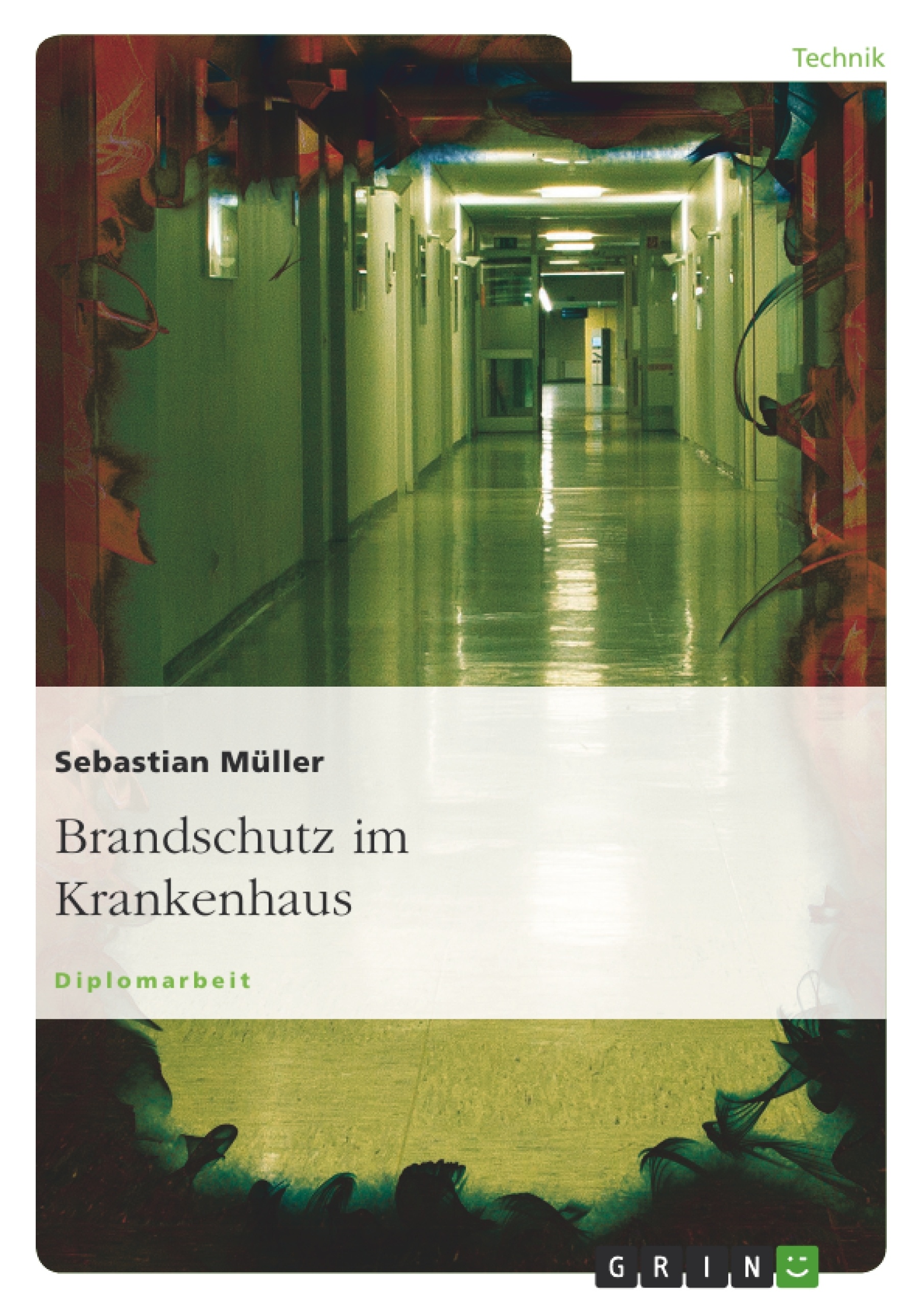Brandschutz im Krankenhaus ist ein besonders sensibles Thema. Im Gegensatz zu sonstigen Gebäuden besteht hier im Brandfall auch beim Verlassen der Anlage für viele Patienten eine Gefahr. Eine eventuell lebensnotwendige Behandlung muss unterbrochen werden bzw. wird verzögert. Hinzu kommt, dass sich in einem Krankenhaus Patienten aufhalten, die in ihrer Wahrnehmung und ihrer Mobilität aufgrund ihrer Krankheit oder einer medikamentösen Behandlung beeinträchtigt sind.
Deshalb kommt dem Personal im Brandfall eine besondere Aufgabe zu. Sie müssen mögliche Brandrisiken beurteilen und Kenntnisse über das Verhalten im Brandfall besitzen.
Der Brandschutz im Krankenhaus ist eine anspruchsvolle Aufgabe, der sich der Krankenhausbetreiber stellen muss. Bereits in der Planungsphase eines Krankenhauses sollten geeignete Brandschutzkonzepte erstellt werden, um eine hohe Wirksamkeit zu garantieren und die Kosten von nachträglichen Brandschutzmaßnahmen zu minimieren.
Besonders zu beachten ist dabei dass in den letzten Jahren zunehmend Kunststoffe als Bau- und Verbrauchsmaterialien im Krankenhaus Verwendung finden, von denen man weiß, dass diese im Brandfall eine hohe Rauchbelastung mit sich bringen.
Aufgrund der unterschiedlichen medizinischen Ausrichtung der Krankenhäuser ist zudem der Brandschutz nicht standardisierbar. Desto wichtiger ist es, Risikoschwerpunkte und Fehlerquellen kenntlich zu machen, um einen optimalen Brandschutz im Hinblick auf Sicherheit und Wirtschaftlichkeit zu realisieren. Ist dies der Fall, lassen sich effektive Möglichkeiten und Maßnahmen ableiten, um den Brandschutz wirtschaftlich zu gestalten.
Inhaltsverzeichnis
- A Einleitung
- 1 Einführung in das Thema
- 2 Brandschutz im Krankenhaus
- 3 Problemstellung
- 3.1 Ergebnisse vorangegangener Studien
- 3.2 Nationale und Internationale Studien
- 4 Gliederung
- 5 Anmerkungen zur Diplomarbeit
- B Bestandsaufnahme
- 1 Objektbeschreibung
- 1.1 Vorhandene Planungsunterlagen
- 1.2 Standort und Abmessungen
- 1.3 Nutzung
- 2 Objektanalyse
- 2.1 Analyse des Gebäudetyps und dessen geltenden Normen
- 2.2 Brandgefährdungsanalyse
- 2.3 Klassifizierung des Gebäudes
- 1 Objektbeschreibung
- C Brandschutzkonzept
- 1 Vorbeugender Baulicher Brandschutz
- 1.1 Baustoffe
- 1.2 Bauteile
- 1.2.1 Wände
- 1.2.1.1 Tragende Wände
- 1.2.1.2 Trennwände
- 1.2.1.3 Nichttragende Nichtraumabschließende Wände
- 1.2.1.4 Brandwände
- 1.2.1.5 Außenwände und Glasfassade
- 1.2.2 Decken
- 1.2.3 Türen und Fenster
- 1.2.1 Wände
- 1.3 Flucht- und Rettungswege
- 1.3.1 Anforderungen an Flucht- und Rettungswege
- 1.3.2 Notwendige Treppen bzw. Treppenräume
- 1.3.3 Aufzugsanlagen
- 1.4 Haustechnik
- 1.4.1 Installationsschächte und –kanäle
- 1.4.2 Unterdecken
- 1.4.3 Lüftungskanäle
- 2 Anlagentechnischer Brandschutz
- 2.1 Brandmeldeanlagen (BMA)
- 2.1.1 Brand- bzw. Rauchmelder
- 2.1.2 Brandmeldezentrale (BMZ)
- 2.1.3 Alarmierungseinrichtung
- 2.1.4 Sicherheitsbeleuchtung, Sicherheitsstromversorgung und Sicherheitsanlagen
- 2.1.5 Übertragungseinrichtungen für Brandmeldungen bzw. Störungen
- 2.1.6 Steuereinrichtungen für Brandschutzeinrichtungen
- 2.1.7 Schutzklassen
- 2.2 Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA)
- 2.3 Brandbekämpfungseinrichtungen
- 2.3.1 Selbsthilfeanlagen
- 2.3.1.1 Feuerlöscher
- 2.3.1.2 Wandhydranten
- 2.3.2 Löschhilfeanlagen
- 2.3.2.1 Sprinkleranlagen
- 2.3.1 Selbsthilfeanlagen
- 2.4 Notstromversorgung
- 2.1 Brandmeldeanlagen (BMA)
- 3 Abwehrender Brandschutz
- 3.1 Flächen für die Feuerwehr
- 3.1.1 Zugänge
- 3.1.2 Zufahrten
- 3.1.3 Aufstellflächen
- 3.1.4 Bewegungsflächen
- 3.2 Abstände zwischen Gebäuden
- 3.3 Löschwasserversorgung
- 3.3.1 Hydranten
- 3.3.2 Steigleitungen
- 3.4 Öffentliche Feuerwehr
- 3.5 Feuerwehrpläne nach DIN 14095
- 3.1 Flächen für die Feuerwehr
- 4 Betrieblicher bzw. organisatorischer Brandschutz
- 4.1 Brandschutzordnung nach DIN 14096 – 1
- 4.1.1 Bradschutzordnung Teil A
- 4.1.2 Bradschutzordnung Teil B
- 4.1.3 Bradschutzordnung Teil C
- 4.2 Flucht- und Rettungswegplan
- 4.1 Brandschutzordnung nach DIN 14096 – 1
- 5 Zusammenfassung und Kompensationsmaßnahmen
- 5.1 Zusammenfassung und Beurteilung
- 5.2 Kompensationsmaßnahmen
- 1 Vorbeugender Baulicher Brandschutz
- D Heiß- und Rauchgasentwicklung
- 1 Gefährdung durch Schadenfeuer
- 1.1 Wärmewirkung
- 1.2 Rauch
- 1.3 Schadstoffe
- 2 Schädigung von Personen
- 3 Ermittlung der Heiß- und Rauchgase
- 3.1 Grundlagen des Programms CFAST
- 3.2 Ansätze zur Festlegung von Brandszenarien
- 3.2.1 Einflüsse auf den zeitlichen Verlauf der Energiefreisetzungsrate
- 3.2.2 Brandlast
- 3.3 Eingaben in das Programm
- 3.3.1 Ergebnisse der Testsimulationen
- 3.4 Entwicklung realer Brandszenarien
- 3.4.1 Brand im Brandabschnitt 10
- 3.4.1.1 Ergebnisse der Berechnung
- 3.4.1.2 Beurteilung der Flucht- und Rettungswege im Brandabschnitt 10
- 3.4.2 Brand im Brandabschnitt 7
- 3.4.2.1 Ergebnisse der Berechnung
- 3.4.2.2 Beurteilungen der Flucht- und Rettungswege im Brandabschnitt 7
- 3.4.3 Brand im Brandabschnitt 2, Büro im Kellergeschoss
- 3.4.3.1 Ergebnisse der Berechnung
- 3.4.3.2 Beurteilungen der Flucht- und Rettungswege im Brandabschnitt 2
- 3.4.4 Brand im Brandabschnitt 4, Reinigung/Sterilisation im Kellergeschoss
- 3.4.4.1 Ergebnisse der Berechnung
- 3.4.4.2 Beurteilungen der Flucht- und Rettungswege im Brandabschnitt 4
- 3.4.5 Zusammenfassung der Flucht- und Rettungswegsituation
- 3.4.1 Brand im Brandabschnitt 10
- 1 Gefährdung durch Schadenfeuer
- E Evakuierungssimulation
- 1 Allgemeines und Angaben aus der Literatur
- 1.1 Verhalten der Menschen in Brandfällen
- 1.2 Allgemeine Verhaltensweise
- 1.3 Gehen durch Rauch
- 2 Das Programm EXODUS
- 3 Eingangsdaten für die Simulation
- 3.1 Eingabe der Raumgeometrien
- 3.2 Eingaben der betroffenen Personen
- 3.2.1 Körperliche Eigenschaften betroffener Personen
- 3.2.2 Geistige Eigenschaften betroffener Personen
- 3.2.3 Verhaltensanweisungen einzelner Personen
- 3.2.4 Zusammenfassung aller personenspezifischen Eingaben
- 3.2.4.1 Brandabschnitt 10; Pflegestation
- 3.2.4.2 Brandabschnitt 7; Intensivstation
- 3.2.4.3 Brandabschnitt 2; Büro im Kellergeschoss
- 3.2.4.4 Brandabschnitt 4; Reinigung im Kellergeschoss
- 3.3 Ergebnisse der EXODUS - Simulationen
- 3.3.1 Ergebnisse der Evakuierung im Brandabschnitt 10
- 3.3.2 Ergebnisse der Evakuierung im Brandabschnitt 7
- 3.3.3 Ergebnisse der Evakuierung im Brandabschnitt 2 (Büro im Keller)
- 3.3.4 Ergebnisse der Evakuierung im Brandabschnitt 4 (Reinigung im Keller)
- 3.4 Zusammenfassung der Evakuierungsergebnisse
- 1 Allgemeines und Angaben aus der Literatur
- F Bewertung der Flucht- und Rettungswegsituation
- 1 Zusammenfassung der Ergebnisse aus CFAST und EXODUS
- 2 Überprüfung der Einhaltung von gesetzlichen Festlegungen
- 3 Bewertung der Flucht- und Rettungswegsituation
- 4 Verbesserungsvorschläge für das betrachtete Krankenhaus
- 5 Handlungsbedarf für die Überarbeitung der Bauordnungen und Richtlinien
- G Zusammenfassung und Beurteilung
- 1 Zusammenfassung
- 2 Beurteilung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Diplomarbeit ist die konzeptionelle und konstruktive brandschutztechnische Bemessung eines großen Krankenhauses unter besonderer Berücksichtigung der Flucht- und Rettungswegesituation. Die Arbeit analysiert die bestehenden Brandschutzmaßnahmen und bewertet deren Effektivität im Hinblick auf den Schutz von Personen und Sachwerten.
- Brandschutzkonzepte in Krankenhäusern
- Analyse von Flucht- und Rettungswegen
- Simulation von Brandausbreitung und Evakuierung
- Bewertung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
- Verbesserungsvorschläge für den Brandschutz
Zusammenfassung der Kapitel
A Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik des Brandschutzes ein, beleuchtet die Bedeutung des Themas vor dem Hintergrund vergangener Brandkatastrophen und stellt die Problematik des uneinheitlichen Brandschutzes in Krankenhäusern in Deutschland dar. Es werden statistische Daten zu Krankenhausbränden präsentiert, um die Notwendigkeit umfassender Brandschutzkonzepte zu unterstreichen. Die Arbeit selbst wird strukturiert und die Methodik erläutert.
B Bestandsaufnahme: Dieses Kapitel beschreibt das untersuchte Krankenhausgebäude detailliert, inklusive seiner Nutzung, Abmessungen und Lage. Es analysiert den Gebäudetyp im Kontext der geltenden niedersächsischen Bauordnungen und Richtlinien und führt eine Brandgefährdungsanalyse durch, welche die verschiedenen Nutzungseinheiten und deren Brandgefährdungsklassen klassifiziert. Das Personenaufkommen zu verschiedenen Tageszeiten wird ebenfalls erfasst.
C Brandschutzkonzept: Hier wird ein Brandschutzkonzept für das Krankenhaus entwickelt, welches die vorbeugenden baulichen Maßnahmen (Baustoffe, Bauteile, Fluchtwege, Haustechnik), anlagentechnischen Maßnahmen (Brandmeldeanlagen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Brandbekämpfungseinrichtungen, Notstromversorgung) und den abwehrenden Brandschutz (Zugänge, Zufahrten, Löschwasserversorgung, Feuerwehrpläne) umfasst. Der betriebliche Brandschutz mit der Brandschutzordnung wird ebenfalls behandelt. Schließlich werden Mängel im bestehenden Konzept identifiziert und Kompensationsmaßnahmen vorgeschlagen.
D Heiß- und Rauchgasentwicklung: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der rechnerischen Untersuchung der Rettungswege mittels des Wärmebilanzmodells CFAST. Es werden verschiedene Brandszenarien in unterschiedlichen Bereichen des Krankenhauses simuliert, um die Entwicklung und Ausbreitung von Heiß- und Rauchgasen zu analysieren und die Auswirkungen auf die Flucht- und Rettungswegsituation zu bewerten. Die Schädigungen durch Wärmewirkung, Rauch und Schadstoffe werden erläutert.
E Evakuierungssimulation: Dieses Kapitel beschreibt die Evakuierungssimulationen mit dem Programm EXODUS, basierend auf den Daten der CFAST-Simulationen. Es werden die Eingangsdaten, wie Raumgeometrien und Personeneigenschaften (körperliche und geistige Eigenschaften, Verhaltensweisen), detailliert erläutert. Die Ergebnisse der Simulationen für verschiedene Bereiche des Krankenhauses (Pflegestation, Intensivstation, Büro- und Reinigungsbereich im Keller) werden analysiert und die Erfolgsaussichten der Evakuierungen unter verschiedenen Bedingungen bewertet.
F Bewertung der Flucht- und Rettungswegsituation: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der CFAST- und EXODUS-Simulationen zusammen und vergleicht sie mit den gesetzlichen Festlegungen in den geltenden Bauordnungen und Richtlinien. Es werden kritische Bewertungen der Flucht- und Rettungswegsituation abgegeben, Verbesserungsvorschläge für das betrachtete Krankenhaus formuliert und der Handlungsbedarf für eine Überarbeitung der Bauordnungen und Richtlinien diskutiert.
Schlüsselwörter
Brandschutz, Krankenhaus, Fluchtwege, Rettungswege, Brandmeldeanlage, Rauchgasentwicklung, Evakuierung, CFAST, EXODUS, Bauordnung, Richtlinie, Simulation, Brandgefährdungsanalyse, Kompensationsmaßnahmen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Brandschutzkonzept eines Krankenhauses
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit befasst sich mit der brandschutztechnischen Bemessung eines großen Krankenhauses, insbesondere der Analyse und Bewertung der Flucht- und Rettungswegsituation. Es werden bestehende Brandschutzmaßnahmen untersucht und deren Effektivität hinsichtlich des Schutzes von Personen und Sachwerten bewertet.
Welche Ziele werden in der Arbeit verfolgt?
Ziel der Arbeit ist die konzeptionelle und konstruktive brandschutztechnische Bemessung des Krankenhauses unter besonderer Berücksichtigung der Flucht- und Rettungswege. Es soll analysiert werden, ob die bestehenden Maßnahmen den gesetzlichen Vorgaben entsprechen und gegebenenfalls Verbesserungsvorschläge erarbeitet werden.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit nutzt verschiedene Methoden, darunter die Analyse vorhandener Planungsunterlagen, eine Brandgefährdungsanalyse, die Entwicklung eines Brandschutzkonzeptes, Simulationen der Brandausbreitung mit dem Programm CFAST und Evakuierungssimulationen mit EXODUS. Die Ergebnisse werden mit den gesetzlichen Vorschriften verglichen und bewertet.
Welche Aspekte des Brandschutzes werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den vorbeugenden baulichen Brandschutz (Baustoffe, Bauteile, Flucht- und Rettungswege, Haustechnik), den anlagentechnischen Brandschutz (Brandmeldeanlagen, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Brandbekämpfungseinrichtungen, Notstromversorgung) und den abwehrenden Brandschutz (Zugänge, Zufahrten, Löschwasserversorgung, Feuerwehrpläne). Der betriebliche Brandschutz mit der Brandschutzordnung wird ebenfalls berücksichtigt.
Welche Software wird für die Simulationen verwendet?
Für die Simulation der Brandausbreitung wird das Wärmebilanzmodell CFAST verwendet, während die Evakuierungssimulationen mit dem Programm EXODUS durchgeführt werden.
Welche Szenarien werden in den Simulationen betrachtet?
Die Simulationen betrachten verschiedene Brandszenarien in unterschiedlichen Bereichen des Krankenhauses (z.B. Pflegestation, Intensivstation, Büro- und Reinigungsbereiche im Keller), um die Entwicklung und Ausbreitung von Heiß- und Rauchgasen und deren Auswirkungen auf die Flucht- und Rettungswege zu analysieren.
Wie werden die Ergebnisse der Simulationen bewertet?
Die Ergebnisse der CFAST- und EXODUS-Simulationen werden zusammenfassend dargestellt und mit den gesetzlichen Festlegungen in den geltenden Bauordnungen und Richtlinien verglichen. Es erfolgt eine kritische Bewertung der Flucht- und Rettungswegsituation, und es werden Verbesserungsvorschläge formuliert.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen zur Effektivität des bestehenden Brandschutzkonzeptes und formuliert Verbesserungsvorschläge für das untersuchte Krankenhaus. Sie diskutiert auch den Handlungsbedarf für eine Überarbeitung der Bauordnungen und Richtlinien.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Brandschutz, Krankenhaus, Fluchtwege, Rettungswege, Brandmeldeanlage, Rauchgasentwicklung, Evakuierung, CFAST, EXODUS, Bauordnung, Richtlinie, Simulation, Brandgefährdungsanalyse, Kompensationsmaßnahmen.
Wo finde ich detaillierte Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Das Inhaltsverzeichnis im Anfang der Arbeit bietet eine detaillierte Übersicht der Kapitel und Unterkapitel mit ihren jeweiligen Inhalten.
- Citation du texte
- Sebastian Müller (Auteur), 2004, Brandschutz im Krankenhaus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32388