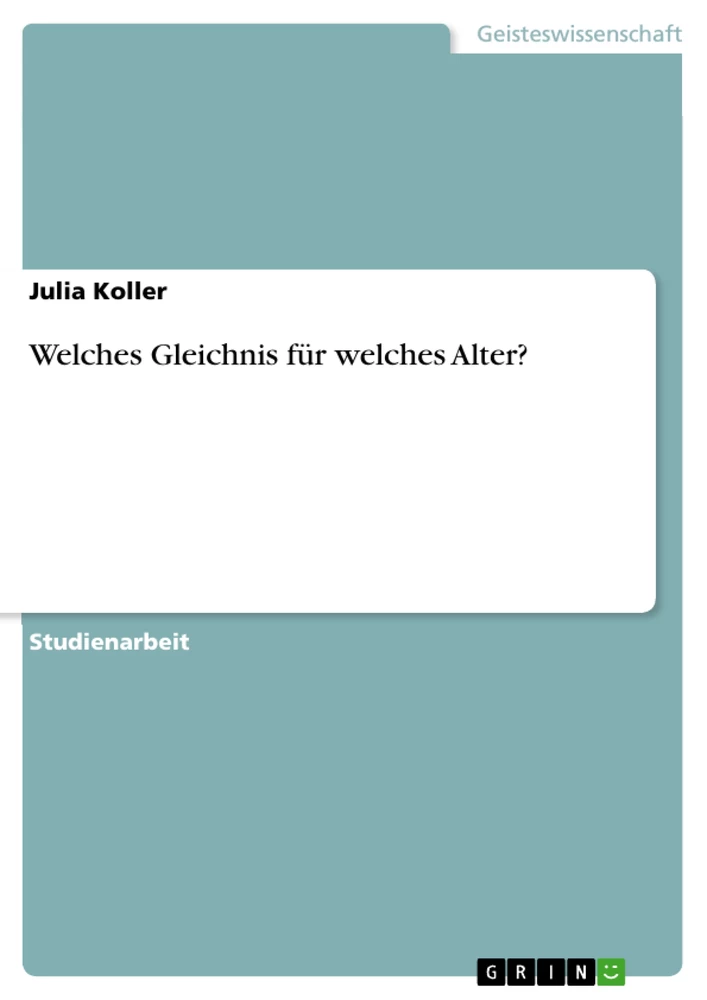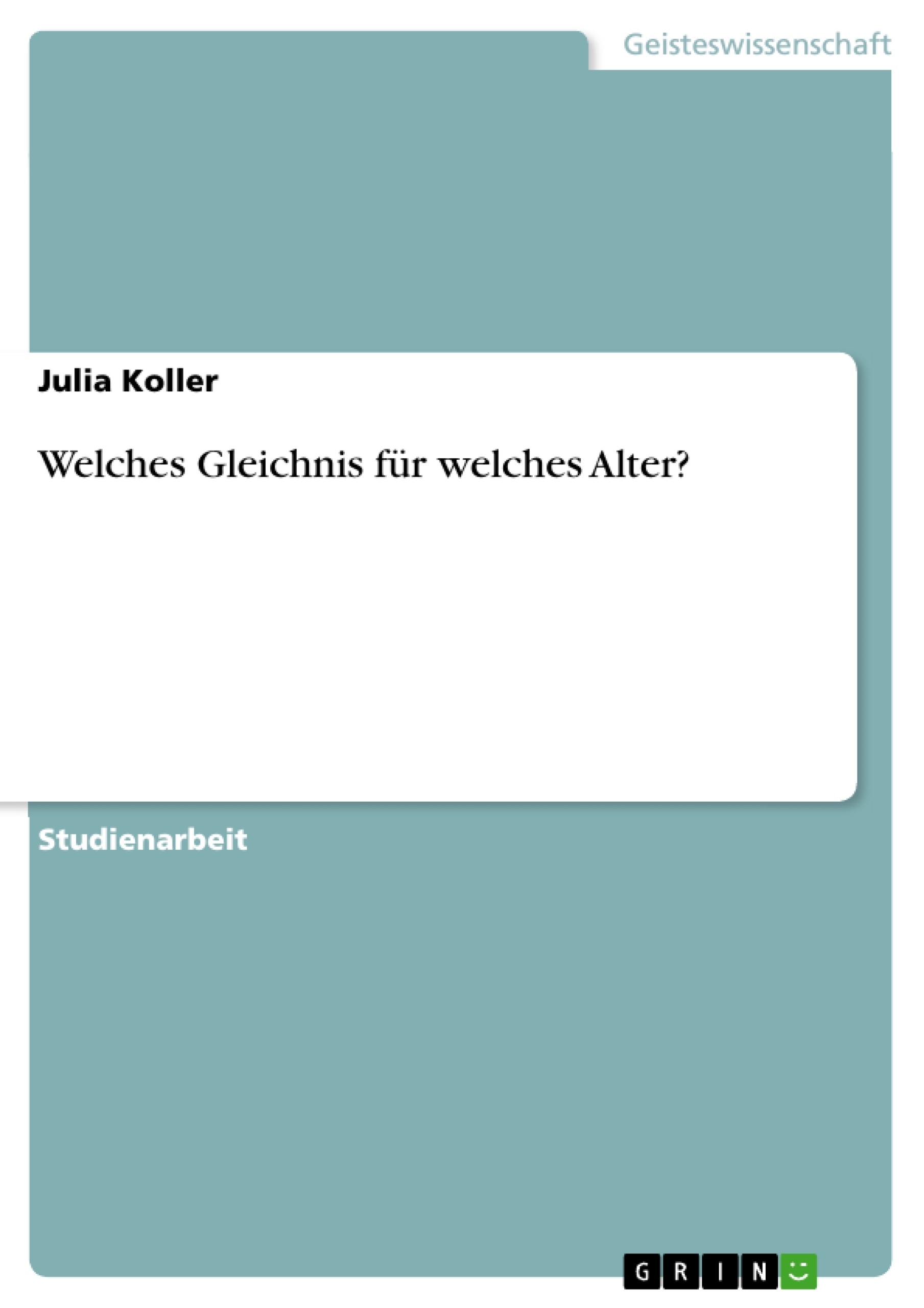1. Entwicklungsstufen des Denkens nach Jean Piaget
Um sich mit der Frage auseinander setzten zu können, welches Gleichnis sich für welche Altersstufe eignet, ist es wichtig, die Forschungsergebnisse Jean Piagets zu kennen und zu berücksichtigen. Er beschäftigte sich nämlich mit der Entwicklung des kindlichen Denkens und teilte diese in vier „Entwicklungsstufen“ ein.
Die Phase von der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr nennt man die sensomotorische Stufe. Ein Kind in diesem Alter kann Objekte erkennen und vor allem wird das Greifen, Saugen und Bewegen verbessert und integriert. Gegen Ende des zweiten Lebensjahres hat das Kind dann die Fähigkeit, momentan nicht gegenwärtige Gegenstände symbolisch zu repräsentieren. Das bedeutet, es besitzt ein inneres Abbild dieses Gegenstandes, auch wenn er zur Zeit sinnlich nicht wahrnehmbar ist.
Die präoperationale Phase geht dann vom zweiten bis zum siebten Lebensjahr. Diese Stufe ist vom anschaulichen Denken geprägt. Das heißt das Denken der Kinder ist vielmehr vom Sehen, als vom Denken selbst abhängig. Das zeigt unter anderem ein Versuch, bei dem man einem Kind einen Hund gezeigt hat. Es wusste, dass es ein Hund war. Nun setzte man dem Hund eine Katzenmaske auf und fragte es noch einmal. Diesmal war seine Antwort jedoch, dass es eine Katze vor sich haben.
Die dritte Phase, die konkret-operationale Phase, geht in etwa bis zum elften Lebensjahr. Und ab jetzt können Kinder geistige Operationen ausführen, ziehen aber immer noch Symbole vor.
Zwischen Ende des elften und des zwölften Lebensjahres erreicht das Kind dann die letzte Stufe des Denkens, die formal-operationale Phase, in der wir uns auch befinden. Ab jetzt ist ein abstraktes und logisches Denken möglich.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Entwicklungsstufen des Denkens nach Jean Piaget
- Die „erste Naivität“
- Das kindliche Weltbild
- Der Realismus des kindlichen Denkens
- Metaphern-, Fabel-, und kindliches Verständnis biblischer Gleichnisse
- Überlegungen zur Auswahl von Gleichnissen
- Beispiel für eine Unterrichtsstunde
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Eignung verschiedener Gleichnisse für unterschiedliche Altersstufen. Die Arbeit stützt sich auf die Entwicklungspsychologie Jean Piagets und die Forschungsergebnisse von Anton A. Bucher zum kindlichen Verständnis von Gleichnissen. Ziel ist es, ein besseres Verständnis für die Herausforderungen der religiösen Bildung im Kindes- und Jugendalter zu entwickeln.
- Entwicklungsstufen des kindlichen Denkens nach Piaget
- Das Konzept der „ersten Naivität“ und seine Auswirkungen auf das Gleichnisverständnis
- Der Realismus des kindlichen Denkens und seine Konsequenzen für die Interpretation von Gleichnissen
- Die Bedeutung des kindlichen Weltbildes für die Auswahl geeigneter Gleichnisse
- Didaktische Implikationen für den Religionsunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Entwicklungsstufen des Denkens nach Jean Piaget: Diese Einleitung beschreibt die vier Entwicklungsstufen des kindlichen Denkens nach Jean Piaget (sensomotorisch, präoperational, konkret-operational, formal-operational). Sie erläutert die charakteristischen Merkmale jeder Stufe und deren Relevanz für das Verständnis von Gleichnissen. Der Fokus liegt auf der präoperationalen und konkret-operationalen Phase, da diese die Altersgruppen betreffen, die im Mittelpunkt der Arbeit stehen. Die Beschreibung der jeweiligen Denkweisen legt die Grundlage für das Verständnis der Schwierigkeiten, die Kinder beim Interpretieren von Gleichnissen haben können.
Die „erste Naivität“: Dieses Kapitel behandelt das Konzept der „ersten Naivität“ nach Anton A. Bucher. Es beschreibt das kindliche Weltbild als eine konkrete, anschauliche Vorstellung der Welt, die sich stark von der abstrakten Denkweise Erwachsener unterscheidet. Der Realismus des kindlichen Denkens wird anhand von Beispielen und Forschungsergebnissen illustriert, wobei die Schwierigkeiten beim Verständnis von Symbolen und Analogien hervorgehoben werden. Der Abschnitt über Animismus und Magie im kindlichen Denken wird zwar erwähnt, aber nicht im Detail erläutert. Die Bedeutung dieses Kapitels liegt in der Erklärung, warum Kinder Gleichnisse oft wörtlich interpretieren und Schwierigkeiten haben, die zugrundeliegende Bedeutung zu erfassen.
Metaphern-, Fabel-, und kindliches Verständnis biblischer Gleichnisse: Dieses Kapitel (welches in der Vorlage in Unterkapitel unterteilt ist, hier jedoch zu einem zusammengefasst wird) analysiert das Verständnis von Metaphern und Fabeln bei Kindern und im Vergleich dazu das Verständnis biblischer Gleichnisse. Es wird untersucht, wie das kindliche Denken die Interpretation beeinflusst und welche Herausforderungen sich daraus für die religiöse Bildung ergeben. Die Zusammenfassung betont die Schwierigkeiten, die Kinder beim Verstehen der metaphorischen Sprache haben und wie dies mit ihren kognitiven Entwicklungsstufen zusammenhängt. Die Arbeit untersucht, wie Kinder Gleichnisse verstehen, und welchen Einfluss ihr Alter und ihr Entwicklungsstadium darauf haben.
Überlegungen zur Auswahl von Gleichnissen: Dieses Kapitel behandelt die didaktischen Implikationen der vorherigen Analysen. Es gibt Empfehlungen für die Auswahl von Gleichnissen, die dem jeweiligen Entwicklungsstand der Kinder entsprechen und berücksichtigt die beschriebenen Aspekte des kindlichen Denkens. Die didaktischen Überlegungen berücksichtigen die Schwierigkeiten, die Kinder beim Verständnis von abstrakten Konzepten haben, und bieten praktische Tipps für den Religionsunterricht.
Schlüsselwörter
Gleichnisse, kindliches Denken, Jean Piaget, Entwicklungspsychologie, „erste Naivität“, Anton A. Bucher, Religionspädagogik, Metapher, Fabel, Analogie, Weltbild, Realismus, Didaktik, Religionsunterricht.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Kindliches Verständnis von Gleichnissen
Was ist das Thema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht, wie Kinder in verschiedenen Altersstufen Gleichnisse verstehen. Sie konzentriert sich auf die Eignung verschiedener Gleichnisse für unterschiedliche Altersstufen und die Herausforderungen der religiösen Bildung im Kindes- und Jugendalter.
Welche Theorien werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf die Entwicklungspsychologie Jean Piagets und die Forschungsergebnisse von Anton A. Bucher zum kindlichen Verständnis von Gleichnissen. Piagets Stufenmodell des kindlichen Denkens bildet die Grundlage für die Analyse des Gleichnisverständnisses in verschiedenen Altersgruppen. Das Konzept der „ersten Naivität“ nach Bucher spielt eine zentrale Rolle beim Verständnis des kindlichen Weltbildes und seiner Auswirkungen auf die Interpretation von Gleichnissen.
Welche Entwicklungsstufen des Denkens nach Piaget werden behandelt?
Die Hausarbeit beschreibt die vier Stufen des kindlichen Denkens nach Piaget: sensomotorisch, präoperational, konkret-operational und formal-operational. Der Fokus liegt jedoch auf der präoperationalen und konkret-operationalen Phase, da diese die Altersgruppen betreffen, die im Mittelpunkt der Arbeit stehen.
Was ist die „erste Naivität“ und welche Rolle spielt sie?
Die „erste Naivität“ beschreibt das konkrete und anschauliche Weltbild von Kindern, das sich stark von der abstrakten Denkweise Erwachsener unterscheidet. Diese konkrete Denkweise beeinflusst maßgeblich das Verständnis von Gleichnissen, da Kinder diese oft wörtlich interpretieren und Schwierigkeiten haben, die zugrundeliegende Bedeutung zu erfassen.
Wie werden Metaphern, Fabeln und biblische Gleichnisse verglichen?
Die Arbeit analysiert das Verständnis von Kindern für Metaphern und Fabeln im Vergleich zu biblischen Gleichnissen. Sie untersucht, wie das kindliche Denken die Interpretation beeinflusst und welche Herausforderungen sich daraus für die religiöse Bildung ergeben. Die Schwierigkeiten beim Verstehen metaphorischer Sprache im Zusammenhang mit den kognitiven Entwicklungsstufen werden hervorgehoben.
Welche Empfehlungen gibt die Arbeit zur Auswahl von Gleichnissen?
Die Arbeit gibt Empfehlungen für die Auswahl von Gleichnissen, die dem jeweiligen Entwicklungsstand der Kinder entsprechen. Sie berücksichtigt die beschriebenen Aspekte des kindlichen Denkens und bietet praktische Tipps für den Religionsunterricht, um das Verständnis von abstrakten Konzepten zu erleichtern.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Gleichnisse, kindliches Denken, Jean Piaget, Entwicklungspsychologie, „erste Naivität“, Anton A. Bucher, Religionspädagogik, Metapher, Fabel, Analogie, Weltbild, Realismus, Didaktik, Religionsunterricht.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit beinhaltet Kapitel zu den Entwicklungsstufen des Denkens nach Piaget, dem Konzept der „ersten Naivität“, dem kindlichen Verständnis von Metaphern, Fabeln und biblischen Gleichnissen, sowie Überlegungen zur Auswahl geeigneter Gleichnisse für den Religionsunterricht. Zusätzlich enthält sie ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und eine Liste mit Schlüsselbegriffen.
- Quote paper
- Julia Koller (Author), 2001, Welches Gleichnis für welches Alter?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3235