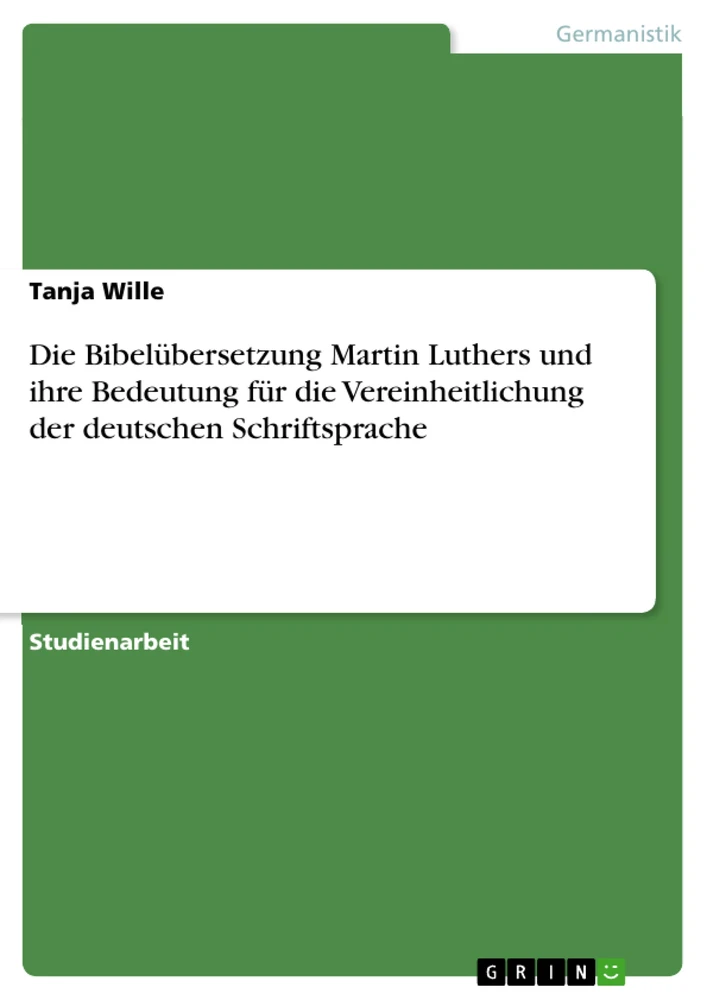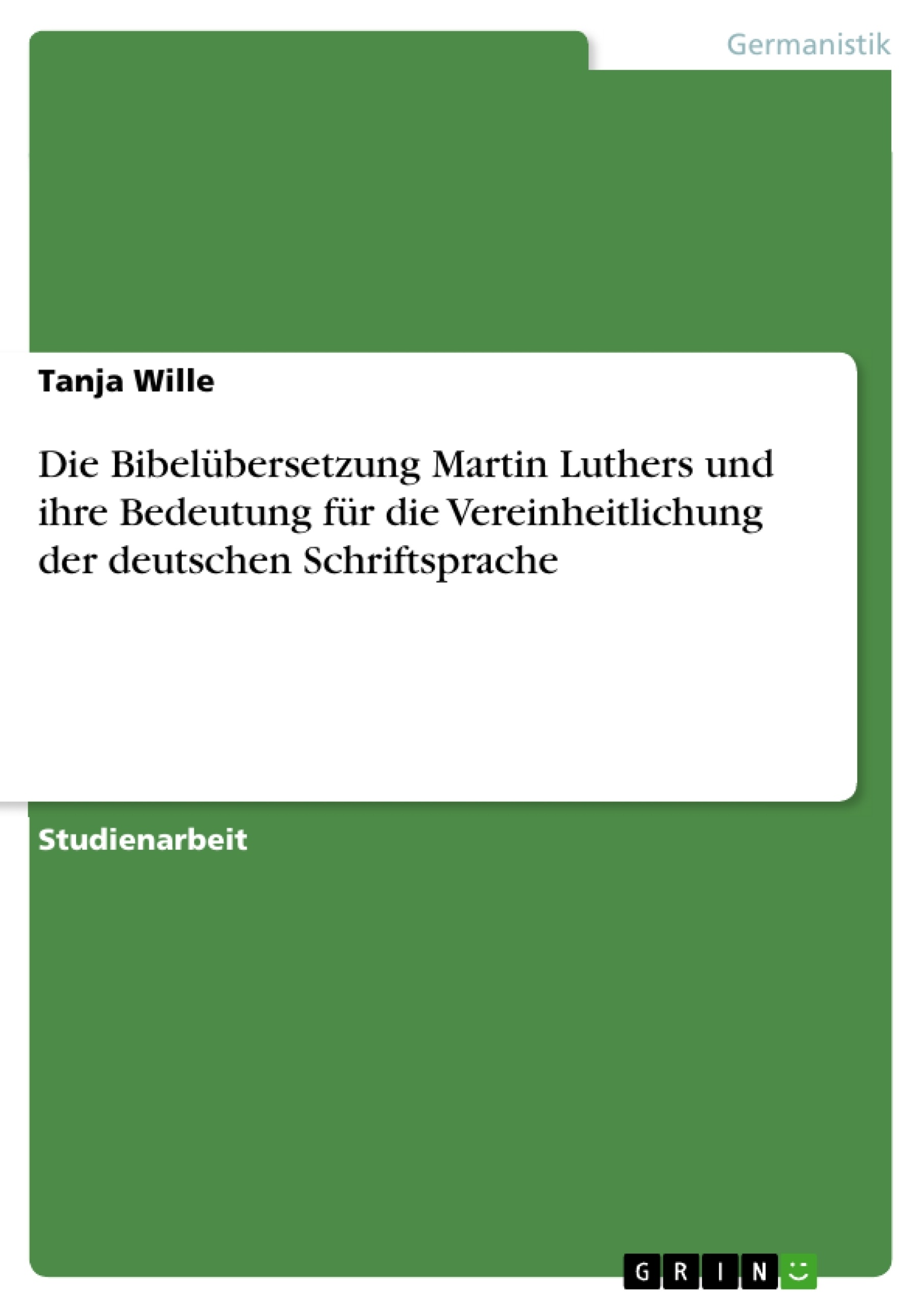Der Name Martin Luther hat sich unserem Gedächtnis über Jahrhunderte hinweg eingeprägt.
Die durch ihn formulierte Kritik an der Kirche und die damit eingeleitete Reformation gehören bis heute zu den bedeutenden Ereignissen deutscher Geschichte. Durch Luthers Übersetzung wurde die Bibel erstmalig allen Bevölkerungsschichten zugänglich, sodass auch die von ihm verwandte Sprache großräumig Verbreitung fand.
Die Bedeutung Luthers für die Entwicklung der Schreiblandschaften zur Neuhochdeutschen Schriftsprache unterliegt differenten Forschungsmeinungen. Während Konrad Burdach Luther als ‚Nachzügler’ der sprachlichen Entwicklung bewertet, ernennt Friedrich Kluge ihn zum ‚Schöpfer’ der einheitlichen Schriftsprache. Diese konträren Einschätzungen lassen die Vielfältigkeit dieser Thematik erkennen.
In dieser Hausarbeit soll der Beitrag Martin Luthers für die Vereinheitlichung der deutschen Schriftsprache näher betrachtet werden. Um seinen Einfluss adäquat beurteilen zu können, wird im folgenden Teil dieser Arbeit zunächst die Situation der deutschen Sprache vor Luthers Wirken dargelegt. Des Weiteren werden die auf Luther wirkenden sprachlichen Einflüsse aufgezeigt, welche für die Bedeutung seines Schaffens aufschlussreich erscheinen. Um Luthers Sprache im Kontext der sprachlichen Entwicklung bewerten zu können, wird eine Untersuchung seines Wortschatzes sowie der Syntax seiner Schriften folgen.
Inhaltsverzeichnis
- Überblick
- Sprachliche Ausgangsbedingungen Luthers Wirken
- Luthers Sprache
- sprachliche Einflüsse
- Lexik
- Syntax
- Die Verbreitung Luthers Sprache
- Luthers Bedeutung für die Vereinheitlichung der deutschen Schriftsprache
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Martin Luthers Beitrag zur Vereinheitlichung der deutschen Schriftsprache. Die Zielsetzung besteht darin, seinen Einfluss auf die sprachliche Entwicklung im Kontext der damaligen sprachlichen Ausgangsbedingungen zu beurteilen. Hierzu werden Luthers sprachliche Einflüsse, sein Wortschatz und seine Syntax analysiert.
- Die sprachliche Situation Deutschlands vor Luthers Wirken
- Die sprachlichen Einflüsse auf Luthers Werk
- Analyse von Luthers Wortschatz und Syntax
- Die Verbreitung von Luthers Sprache
- Luthers Einfluss auf die Vereinheitlichung der deutschen Schriftsprache
Zusammenfassung der Kapitel
Überblick: Der Text befasst sich mit der Bedeutung Martin Luthers für die Vereinheitlichung der deutschen Schriftsprache. Er stellt die gegensätzlichen Forschungsmeinungen zu Luthers Rolle dar – von "Nachzügler" bis "Schöpfer" der einheitlichen Schriftsprache – und kündigt eine detaillierte Untersuchung an, die die sprachliche Situation vor Luthers Wirken, seine sprachlichen Einflüsse und eine Analyse seines Wortschatzes und seiner Syntax umfasst.
Sprachliche Ausgangsbedingungen Luthers Wirken: Dieses Kapitel beschreibt die sprachliche Situation im Spätmittelalter in Deutschland. Es erklärt die Ablösung des Lateinischen durch deutsche Dialekte und die Herausbildung regionaler Schreiblandschaften, nördlich und südlich der Benrather Linie. Die Diskussion umfasst die Differenzierung zwischen Mundart und Schreibdialekt, die Rolle des Ostmitteldeutschen und die Bedeutung des Ausgleichsprozesses auf Schriftebene. Der Einfluss des Buchdrucks auf die Verbreitung deutscher Texte wird ebenfalls behandelt.
Luthers Sprache: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die sprachlichen Einflüsse auf Martin Luther, beginnend mit seinem familiären Hintergrund und den regionalen Dialekten seiner Kindheit und Jugend. Es beleuchtet den Einfluss der religiösen Erbauungsliteratur der Mystik auf Luthers Sprachstil und dessen Verbindung zur gesprochenen Sprache des kirchlichen Lebens. Die Bedeutung von Luthers Aneignung des Griechischen und Hebräischen für seine Bibelübersetzung und sein Sprachgefühl wird hervorgehoben. Das Kapitel deutet auf eine Analyse von Luthers Lexik und Syntax hin, die jedoch im vorliegenden Auszug nicht weiter ausgeführt wird.
Schlüsselwörter
Martin Luther, deutsche Schriftsprache, Sprachvereinheitlichung, Neuhochdeutsch, Sprachgeschichte, Bibelübersetzung, Ostmitteldeutsch, Niederdeutsch, Schreiblandschaften, Sprachliche Einflüsse, Lexik, Syntax.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Martin Luthers Beitrag zur Vereinheitlichung der deutschen Schriftsprache
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss Martin Luthers auf die Entwicklung und Vereinheitlichung der deutschen Schriftsprache. Sie beleuchtet seine Rolle im Kontext der damaligen sprachlichen Gegebenheiten und analysiert seine sprachlichen Eigenheiten.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst einen Überblick über die sprachliche Situation vor Luthers Wirken, eine Analyse seiner sprachlichen Einflüsse (familiärer Hintergrund, regionale Dialekte, religiöse Literatur, Griechisch und Hebräisch), eine Betrachtung seiner Lexik und Syntax sowie die Verbreitung seiner Sprache und deren Beitrag zur Sprachvereinheitlichung. Die verschiedenen Forschungsmeinungen zu Luthers Rolle – von "Nachzügler" bis "Schöpfer" – werden ebenfalls dargestellt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu folgenden Themen: Überblick, Sprachliche Ausgangsbedingungen Luthers Wirken, Luthers Sprache (inkl. sprachliche Einflüsse, Lexik und Syntax, Verbreitung von Luthers Sprache) und Luthers Bedeutung für die Vereinheitlichung der deutschen Schriftsprache.
Wie wird Luthers Sprache analysiert?
Die Analyse von Luthers Sprache konzentriert sich auf seine sprachlichen Einflüsse, seinen Wortschatz (Lexik) und seine Satzbauweise (Syntax). Die Arbeit deutet zwar auf eine detaillierte Analyse dieser Aspekte hin, diese ist jedoch im vorliegenden Auszug nicht vollständig enthalten.
Welche sprachlichen Ausgangsbedingungen werden betrachtet?
Die Arbeit beschreibt die sprachliche Situation im Spätmittelalter in Deutschland, die Ablösung des Lateinischen durch deutsche Dialekte, die Herausbildung regionaler Schreiblandschaften (nördlich und südlich der Benrather Linie), die Differenzierung zwischen Mundart und Schreibdialekt, die Rolle des Ostmitteldeutschen und den Einfluss des Buchdrucks.
Was ist das zentrale Ergebnis der Arbeit (im vorliegenden Auszug)?
Der vorliegende Auszug bietet einen Überblick über die Forschungsfrage und die Methodik. Ein detailliertes Ergebnis zur konkreten Auswirkung von Luthers Sprache auf die Sprachvereinheitlichung wird im Auszug nicht präsentiert, sondern nur angedeutet.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Martin Luther, deutsche Schriftsprache, Sprachvereinheitlichung, Neuhochdeutsch, Sprachgeschichte, Bibelübersetzung, Ostmitteldeutsch, Niederdeutsch, Schreiblandschaften, Sprachliche Einflüsse, Lexik, Syntax.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Die Arbeit ist für ein akademisches Publikum bestimmt, das sich mit der Sprachgeschichte des Deutschen und der Rolle Martin Luthers in diesem Kontext auseinandersetzt.
- Quote paper
- Tanja Wille (Author), 2010, Die Bibelübersetzung Martin Luthers und ihre Bedeutung für die Vereinheitlichung der deutschen Schriftsprache, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/323435