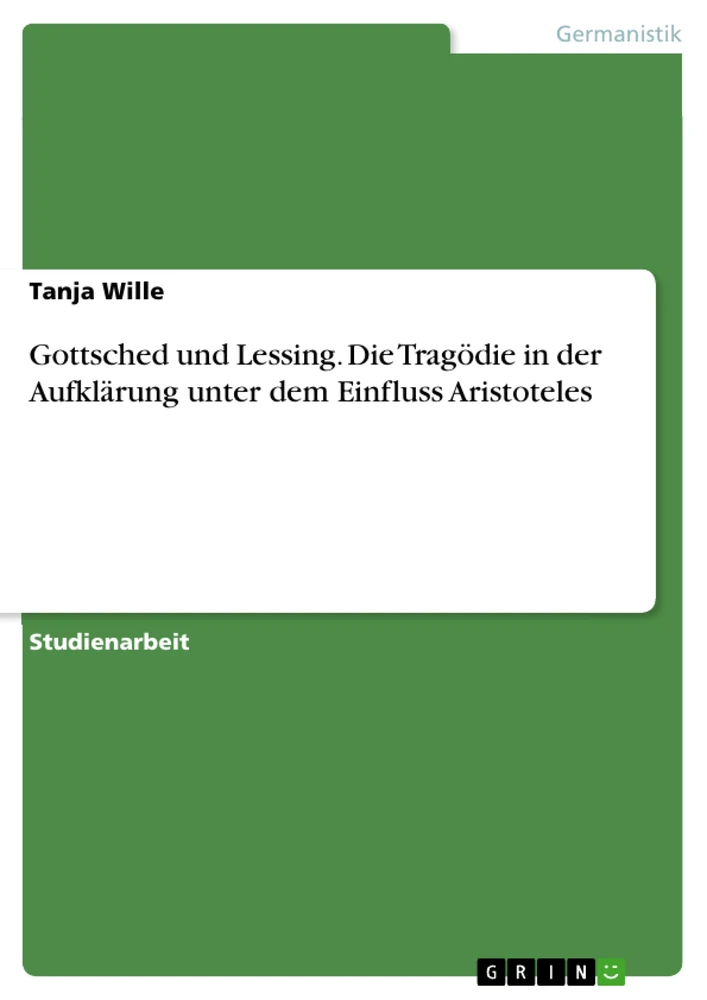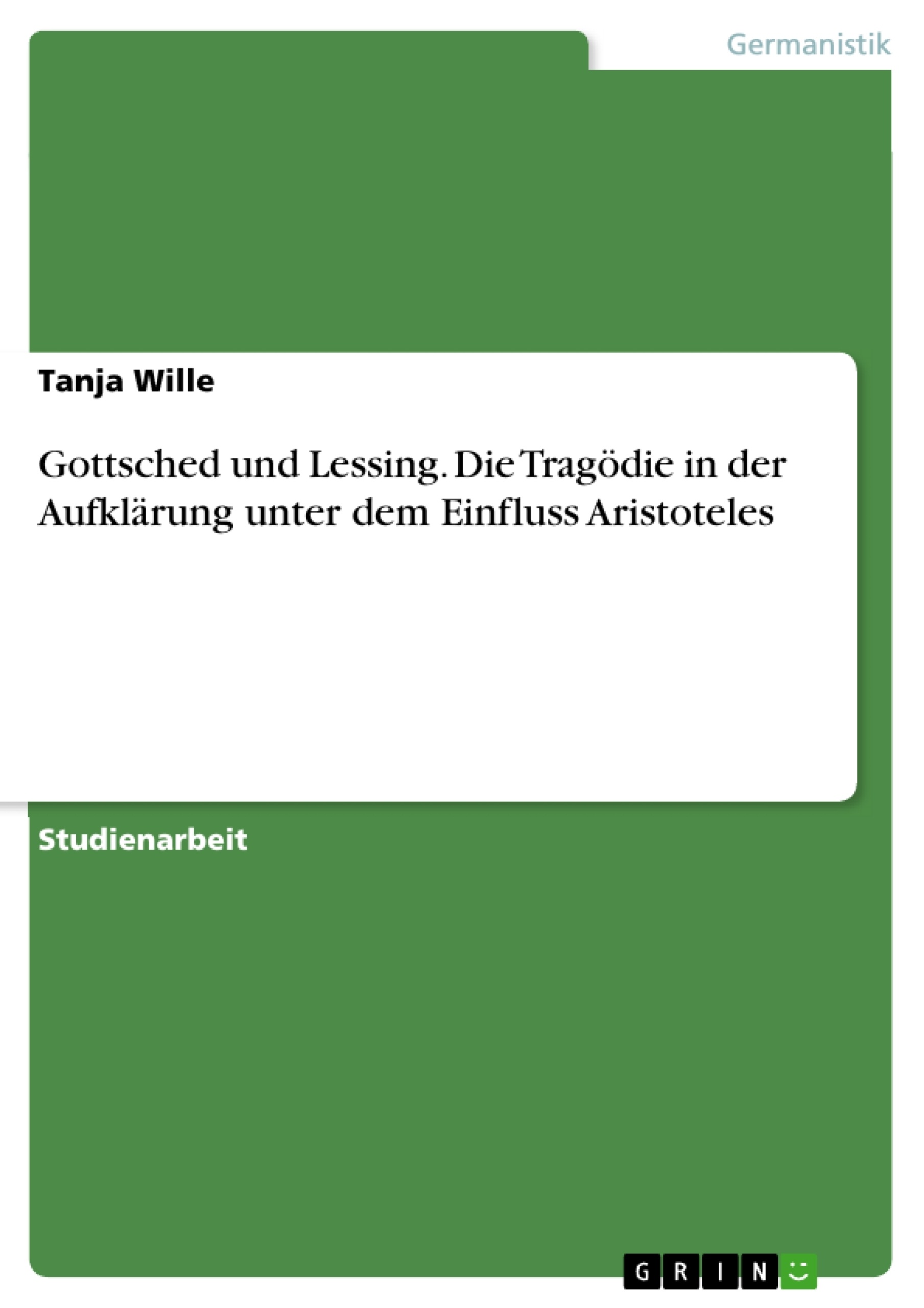Die Tragödie entstand im antiken Griechenland und geht auf den Dionysoskult zurück. Das Fest zu Ehren des griechischen Gottes der Fruchtbarkeit und des Gesanges gilt als Ursprung des Theaters. Den Höhepunkt des Festes bildeten die Tragödienaufführungen, später kamen Komödienaufführungen hinzu. Die aufgeführten Tragödien basierten auf mythologischen Überlieferungen und wurden durch einen Chor begleitet.
Die erste Theorie des Dramas entwarf der griechische Philosoph und Dichter Aristoteles. Die erstmals durch ihn formulierten Strukturmomente der Tragödie bilden den Ausgangspunkt dieser Arbeit. Die deutsche Theatersituation des 18. Jh. bewirkte eine Rückbesinnung zu den Tragödienursprüngen. Dabei führte die Auseinandersetzung mit der Wirkungslehre des Aristoteles zu Debatten zwischen deutschen Dichtern.
Die Diskussion wird durch die Aufklärer Johann Christoph Gottsched und Gotthold Ephraim Lessing dominiert, deren konträre Positionen die Tragödie des 18. Jh. prägen. Die durch Gottsched eingeleitete Reformierung des Theaters veranlasste Lessing einige Jahre später zu starker Kritik an dessen klassizistisch orientiertem Tragödienverständnis. Beide Dichter argumentierten auf der Basis Aristoteles’ „Poetik“, wodurch sie ihre Positionen zu legitimieren versuchten. In dieser Arbeit sollen die Theorien der genannten Vertreter untersucht und vor dem Einfluss Aristoteles’ betrachtet werden, wobei die wirkungsästhetischen Termini jeweils dem Verständnis des einzelnen Dichters angepasst werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Aristoteles, Gottsched und Lessing
- 2.1. Die „Poetik“ als Vorbild aufklärerischer Tragödientheorien
- 2.2. Das deutsche Theater vor Gottsched
- 2.3. Gottsched und die Tragödie
- 2.4. Lessing und die Tragödie
- 3. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Tragödientheorien von Aristoteles, Gottsched und Lessing im 18. Jahrhundert. Sie analysiert deren jeweilige Positionen im Kontext der aristotelischen „Poetik“ und beleuchtet die kontroversen Diskussionen um die Wirkungsästhetik der Tragödie.
- Aristoteles' „Poetik“ als Grundlage der Tragödientheorie
- Gottscheds und Lessings Interpretationen der „Poetik“
- Die Rolle der Katharsis und deren unterschiedliche Auslegungen
- Die Bedeutung des Mythos, der Handlung und des Charakters in der Tragödie
- Kontroversen um die Ständeklausel und die Einheit der Handlung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Ursprünge der Tragödie im antiken Griechenland und den Dionysoskult. Sie führt Aristoteles als den ersten Theoretiker des Dramas ein und hebt die Bedeutung seiner „Poetik“ hervor. Die Arbeit konzentriert sich auf die deutsche Theatersituation des 18. Jahrhunderts und die Auseinandersetzung mit Aristoteles' Werk durch Gottsched und Lessing, deren gegensätzliche Positionen die Tragödie dieser Epoche prägten. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Theorien der genannten Vertreter unter dem Einfluss von Aristoteles, wobei die wirkungsästhetischen Termini jeweils dem Verständnis des einzelnen Dichters angepasst werden.
2. Aristoteles, Gottsched und Lessing: Dieses Kapitel analysiert Aristoteles' „Poetik“ als Ausgangspunkt aufklärerischer Tragödientheorien. Es untersucht den Einfluss des Werkes auf die Diskussionen zwischen Gottsched und Lessing und beleuchtet deren unterschiedliche Interpretationen von Aristoteles' Konzepten, insbesondere der Katharsis, des Mythos, der Handlung und des Charakters des tragischen Helden. Der Text erörtert die verschiedenen Übersetzungen der „Poetik“ und deren Auswirkung auf die terminologische Einheitlichkeit der Debatte. Das Kapitel beleuchtet ausführlich Aristoteles' Definition der Tragödie, seine Ausführungen zur Peripetie, Anagnorisis und Hamartia und deren Bedeutung für die Wirkung auf den Zuschauer. Es wird die Rolle des mittleren Charakters des Helden diskutiert und die Bedeutung der Einheit von Handlung, Zeit und Ort erläutert. Die verschiedenen Interpretationen der Katharsis, die Rolle der Phobos und Eleos und deren Auswirkung auf die Rezeption werden detailliert untersucht.
Schlüsselwörter
Aristoteles, Poetik, Tragödie, Aufklärung, Gottsched, Lessing, Katharsis, Phobos, Eleos, Mythos, Handlung, Charakter, Hamartia, Peripetie, Anagnorisis, Ständeklausel, Wirkungsästhetik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Tragödientheorien im 18. Jahrhundert
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Tragödientheorien von Aristoteles, Gottsched und Lessing im 18. Jahrhundert. Sie analysiert deren jeweilige Positionen im Kontext der aristotelischen „Poetik“ und beleuchtet die kontroversen Diskussionen um die Wirkungsästhetik der Tragödie.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt Aristoteles' „Poetik“ als Grundlage der Tragödientheorie, die Interpretationen der „Poetik“ durch Gottsched und Lessing, die Rolle der Katharsis und deren unterschiedliche Auslegungen, die Bedeutung von Mythos, Handlung und Charakter in der Tragödie sowie die Kontroversen um die Ständeklausel und die Einheit der Handlung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Hauptkapitel zu Aristoteles, Gottsched und Lessing und eine Zusammenfassung. Die Einleitung beschreibt die Ursprünge der Tragödie und die Bedeutung der „Poetik“ Aristoteles'. Das Hauptkapitel analysiert Aristoteles' „Poetik“ als Ausgangspunkt aufklärerischer Tragödientheorien und untersucht den Einfluss des Werkes auf Gottsched und Lessing, insbesondere bezüglich der Katharsis, des Mythos, der Handlung und des Charakters des tragischen Helden. Es werden verschiedene Übersetzungen der „Poetik“ und deren Auswirkung auf die terminologische Einheitlichkeit der Debatte beleuchtet. Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen.
Welche Aspekte der „Poetik“ Aristoteles' werden besonders hervorgehoben?
Die Arbeit beleuchtet ausführlich Aristoteles' Definition der Tragödie, seine Ausführungen zur Peripetie, Anagnorisis und Hamartia und deren Bedeutung für die Wirkung auf den Zuschauer. Die Rolle des mittleren Charakters des Helden, die Bedeutung der Einheit von Handlung, Zeit und Ort und die verschiedenen Interpretationen der Katharsis, die Rolle der Phobos und Eleos und deren Auswirkung auf die Rezeption werden detailliert untersucht.
Welche Rolle spielen Gottsched und Lessing in dieser Arbeit?
Gottsched und Lessing werden als zentrale Figuren der aufklärerischen Auseinandersetzung mit Aristoteles' „Poetik“ betrachtet. Ihre gegensätzlichen Positionen und Interpretationen der aristotelischen Konzepte prägten die Tragödie des 18. Jahrhunderts. Die Arbeit analysiert deren unterschiedliche Interpretationen von Aristoteles' Konzepten und die daraus resultierenden Kontroversen.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für das Verständnis der Arbeit?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Aristoteles, Poetik, Tragödie, Aufklärung, Gottsched, Lessing, Katharsis, Phobos, Eleos, Mythos, Handlung, Charakter, Hamartia, Peripetie, Anagnorisis, Ständeklausel, Wirkungsästhetik.
- Quote paper
- Tanja Wille (Author), 2009, Gottsched und Lessing. Die Tragödie in der Aufklärung unter dem Einfluss Aristoteles, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/323433