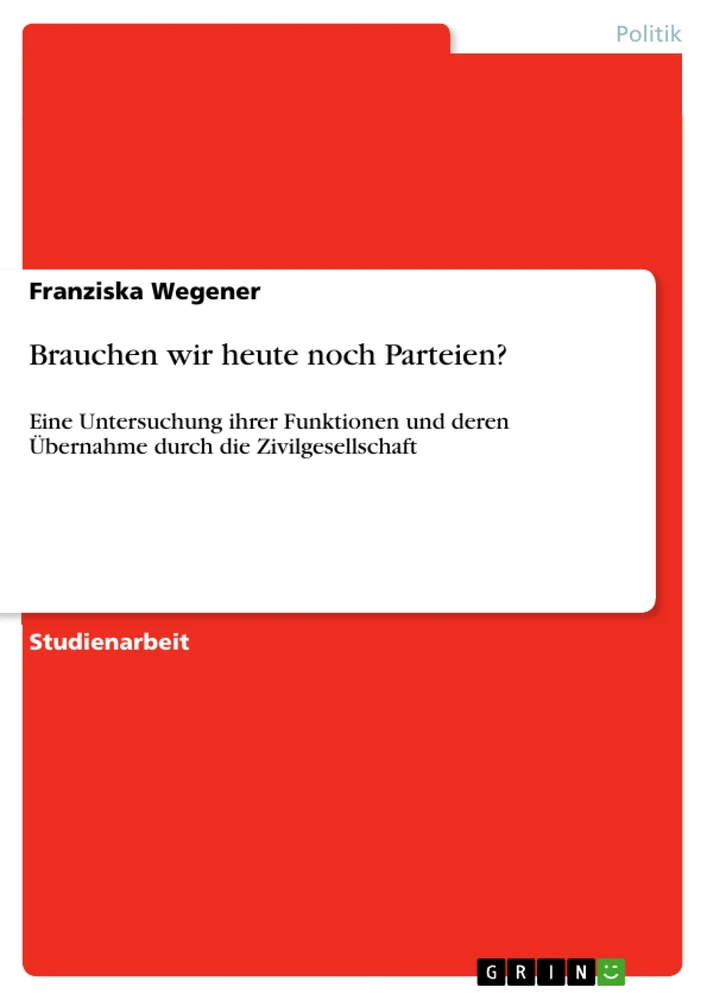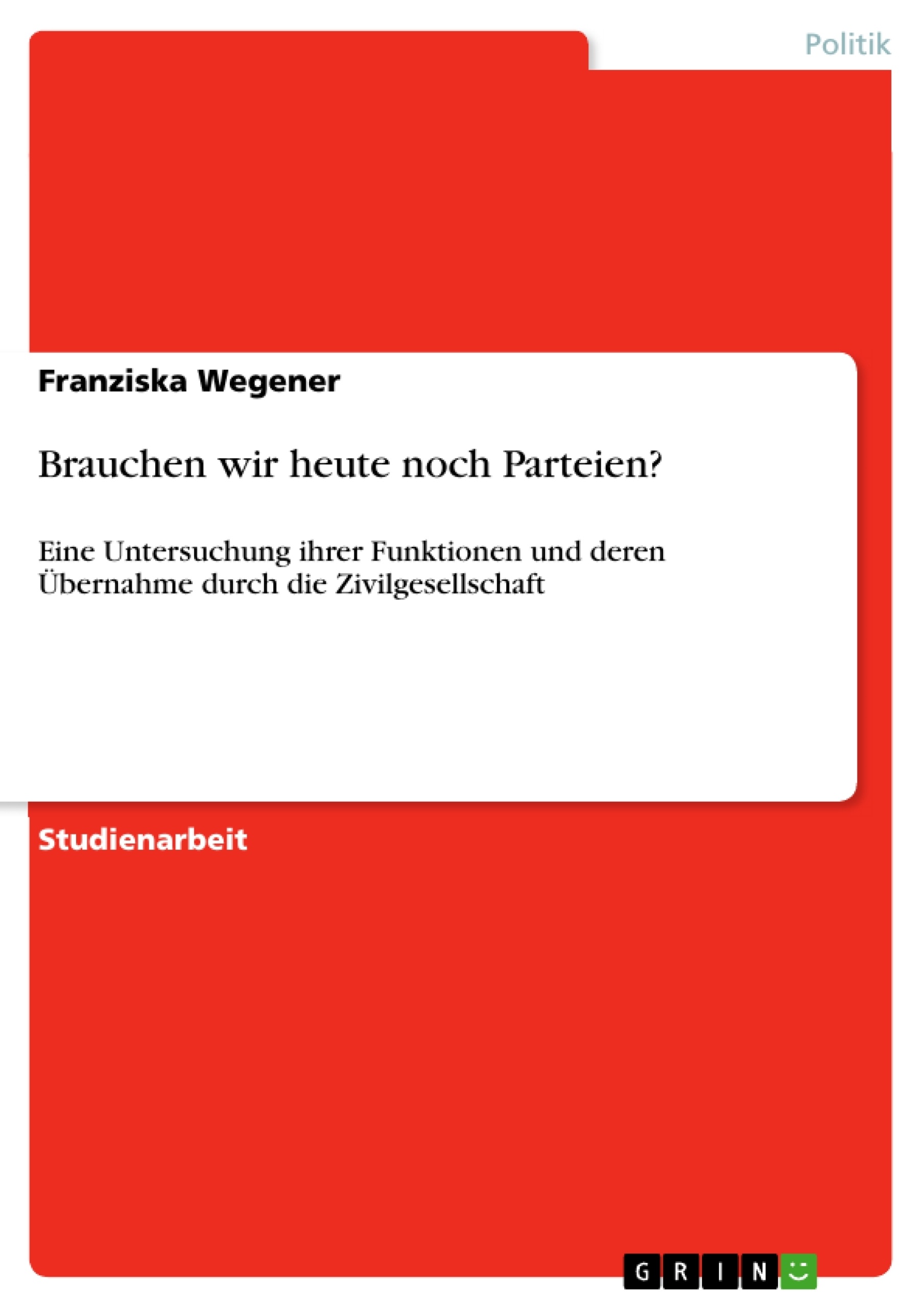Parteien sind seit jeher prägend für politische Systeme, sodass die heutigen Demokratien ohne sie kaum vorstellbar wären. Und doch hat unlängst ein Prozess eingesetzt, der diese Machtposition der Parteien zu untergraben scheint. Von Politikverdrossenheit ist die Rede, von Mitgliederschwund und von Erosion oder Zerfall der großen Parteien. Im schlimmsten Fall sogar davon, dass Parteien heute gar keinen Unterschied mehr machen. Und vor allem in der Öffentlichkeit und unter den Bürgern herrscht immer mehr Skepsis gegenüber denen, die seit Jahrzehnten die politische Bühne prägen. Auf den Punkt gebracht: Es gibt immer mehr Beweise dafür, dass die Rolle der Parteien in fortgeschrittenen Demokratien der Industriestaaten nicht mehr dieselbe zu seinen scheint.
Immer mehr treten dagegen zivilgesellschaftliche Alternativen in den Vordergrund, welche die Parteien in Bezug auf ihre ursprünglichen Funktionen zu ersetzen scheinen. Interessengruppen, Initiativen, Bürgerbewegungen und Vereine sind überall zu finden und werden immer präsenter. Egal wofür man sich einsetzen möchte, es gibt zahlreiche Möglichkeiten. Und das Wichtigste – die eigene Stimme wird tatsächlich wahrgenommen. Daher stellt sich nun die Frage, ob wir Parteien heute überhaupt noch brauchen. Diese kann aus zahlreichen Blickwinkeln der Parteienforschung beleuchtet werden, da dieses Feld der Forschung als äußerst Facettenreich gilt. In er vorliegenden Arbeit soll die Frage aber aus einer normativen Perspektive betrachtet werden. Es soll daher auf die eigentlichen Funktionen von politischen Parteien eingegangen werden und ob diese durch die Zivilgesellschaft übernommen wurden.
Die Forschungsfrage: „Brauchen wir heute noch Parteien?“, soll nun innerhalb von drei Schritten beantwortet werden. Zunächst wird herausgearbeitet welche Funktionen den Parteien von der wissenschaftlichen Literatur zugeschrieben werden. Hierzu werden verschiedene Funktionskataloge vorgestellt. Dann soll näher auf die Definition und die Funktionen der Zivilgesellschaft selbst eingegangen werden, bevor dann in einer Analyse untersucht werden soll, ob die Funktionen der Parteien durch die Zivilgesellschaft übernommen worden sind und ob wir somit keine Parteien mehr brauchen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Funktionen von Parteien
- 2.1 Ulrich von Alemann
- 2.2 Klaus Detterbeck
- 3. Zivilgesellschaft
- 3.1 Definition
- 3.2 Funktionen
- 4. Analyse - Zivilgesellschaft als Ersatz der Parteien?
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Frage, ob politische Parteien in modernen Demokratien noch notwendig sind. Sie analysiert die Funktionen von Parteien im Lichte des zunehmenden Einflusses zivilgesellschaftlicher Akteure. Die Arbeit fokussiert auf die normative Perspektive und untersucht, ob die traditionellen Funktionen von Parteien durch die Zivilgesellschaft übernommen wurden.
- Funktionen politischer Parteien
- Definition und Funktionen der Zivilgesellschaft
- Vergleich der Funktionen von Parteien und Zivilgesellschaft
- Analyse der potenziellen Ersetzung von Parteien durch die Zivilgesellschaft
- Bewertung der Notwendigkeit politischer Parteien in der heutigen Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Notwendigkeit von Parteien in heutigen Demokratien. Sie verweist auf den beobachteten Rückgang der Parteimitgliedschaft und das zunehmende Misstrauen in politische Parteien, sowie auf den Aufstieg zivilgesellschaftlicher Organisationen als potenzielle Alternative. Die Einleitung skizziert den methodischen Aufbau der Arbeit, der die Analyse von Parteifunktionen, die Definition und Funktionen der Zivilgesellschaft sowie einen Vergleich beider umfasst.
2. Funktionen von Parteien: Dieses Kapitel untersucht die verschiedenen Funktionskataloge von politischen Parteien, die in der Literatur zu finden sind. Es werden die Herausforderungen bei der Definition von Parteifunktionen aufgrund deren normativer Natur hervorgehoben. Das Kapitel diskutiert die Schwierigkeiten, eine allgemeingültige Definition zu finden und zeigt die Vielfalt der Ansätze in der Parteienforschung auf. Es bereitet den Boden für die detailliertere Betrachtung ausgewählter Funktionskataloge in den folgenden Unterkapiteln.
2.1 Ulrich von Alemann: Dieses Unterkapitel präsentiert den Funktionskatalog von Ulrich von Alemann. Alemann kategorisiert die sieben Parteifunktionen (Partizipation, Transmission, Selektion, Integration, Sozialisation, Selbstregulation und Legitimation) in zwei Gruppen: konventionelle Funktionen (von oben betrachtet) und Funktionen, die den einzelnen Bürger von unten betrachten. Der Fokus liegt auf der Interdependenz der Funktionen und ihrer Bedeutung für das politische System. Die Transmission, Selektion, Integration und Legitimation werden als systemerhaltende Funktionen beschrieben, während Partizipation, Sozialisation und Selbstregulation die Bürgerperspektive repräsentieren. Die Ausführungen von Alemann zur systemischen und gesellschaftlichen Rolle der Parteien bilden den Schwerpunkt dieses Abschnitts.
2.2 Klaus Detterbeck: Dieses Unterkapitel beschreibt den Funktionskatalog von Klaus Detterbeck, der sechs Parteifunktionen in zwei Kategorien einteilt: repräsentative und gouvernementale Funktionen. Die repräsentativen Funktionen beziehen sich auf die Interessenvertretung in der Gesellschaft, während die gouvernementalen Funktionen die Aufgaben der Parteien im Staat beschreiben. Detterbecks Ansatz betont die Verankerung von Parteien zwischen Gesellschaft und Staat und ihre Rolle als Vermittler zwischen beiden Sphären. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse des Verhältnisses zwischen den verschiedenen Funktionen und ihrer Bedeutung für die politische Repräsentation und Regierungsbildung.
3. Zivilgesellschaft: Dieses Kapitel definiert den Begriff „Zivilgesellschaft“ und beschreibt ihre Funktionen. Es beleuchtet die Rolle zivilgesellschaftlicher Organisationen als Akteure im politischen System und untersucht ihre Interaktion mit Parteien. Das Kapitel analysiert die Möglichkeiten und Grenzen zivilgesellschaftlichen Engagements und bereitet die Grundlage für den Vergleich mit den Funktionen der Parteien im darauffolgenden Kapitel.
Schlüsselwörter
Politische Parteien, Parteifunktionen, Zivilgesellschaft, Interessenvertretung, politische Partizipation, Systemstabilität, Demokratietheorie, Regierungsbildung, Elitenrekrutierung, Interessenaggregation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Notwendigkeit politischer Parteien in modernen Demokratien
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Frage, ob politische Parteien in modernen Demokratien angesichts des wachsenden Einflusses zivilgesellschaftlicher Akteure noch notwendig sind. Sie analysiert die Funktionen von Parteien und vergleicht diese mit den Funktionen der Zivilgesellschaft, um deren potenzielle Ersetzung zu bewerten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Funktionen politischer Parteien (nach Alemann und Detterbeck), die Definition und Funktionen der Zivilgesellschaft, einen Vergleich der Funktionen von Parteien und Zivilgesellschaft, die potenzielle Ersetzung von Parteien durch die Zivilgesellschaft und die Notwendigkeit politischer Parteien in der heutigen Zeit. Die Arbeit betrachtet die normative Perspektive und konzentriert sich auf die Frage, ob die traditionellen Parteifunktionen durch die Zivilgesellschaft übernommen wurden.
Welche Autoren werden in Bezug auf Parteifunktionen zitiert?
Die Arbeit bezieht sich auf die Funktionskataloge von Ulrich von Alemann und Klaus Detterbeck. Alemann kategorisiert Parteifunktionen in konventionelle (von oben betrachtet) und bürgerorientierte Funktionen (von unten betrachtet). Detterbeck unterscheidet zwischen repräsentativen und gouvernementalen Funktionen von Parteien.
Wie werden die Parteifunktionen nach Alemann beschrieben?
Alemann beschreibt sieben Parteifunktionen: Partizipation, Transmission, Selektion, Integration, Sozialisation, Selbstregulation und Legitimation. Er unterteilt diese in systemerhaltende (Transmission, Selektion, Integration, Legitimation) und bürgerorientierte Funktionen (Partizipation, Sozialisation, Selbstregulation). Der Fokus liegt auf deren Interdependenz und Bedeutung für das politische System.
Wie werden die Parteifunktionen nach Detterbeck beschrieben?
Detterbeck unterscheidet zwischen repräsentativen Funktionen (Interessenvertretung in der Gesellschaft) und gouvernementalen Funktionen (Aufgaben der Parteien im Staat). Sein Ansatz betont die Vermittlerrolle der Parteien zwischen Gesellschaft und Staat.
Wie wird die Zivilgesellschaft definiert und welche Funktionen werden ihr zugeschrieben?
Die Arbeit definiert den Begriff „Zivilgesellschaft“ und beschreibt ihre Funktionen im politischen System. Sie analysiert die Interaktion zivilgesellschaftlicher Organisationen mit Parteien, sowie die Möglichkeiten und Grenzen zivilgesellschaftlichen Engagements.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, die die Forschungsfrage und den methodischen Aufbau erläutert. Es folgen Kapitel zu den Funktionen von Parteien (mit Unterkapiteln zu Alemann und Detterbeck), zur Zivilgesellschaft, einem Vergleich beider und abschließend einem Fazit.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter umfassen: Politische Parteien, Parteifunktionen, Zivilgesellschaft, Interessenvertretung, politische Partizipation, Systemstabilität, Demokratietheorie, Regierungsbildung, Elitenrekrutierung, Interessenaggregation.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
(Die konkrete Schlussfolgerung ist nicht im vorliegenden Auszug enthalten. Der Auszug umfasst lediglich eine Inhaltsangabe.)
- Quote paper
- Franziska Wegener (Author), 2016, Brauchen wir heute noch Parteien?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/323147