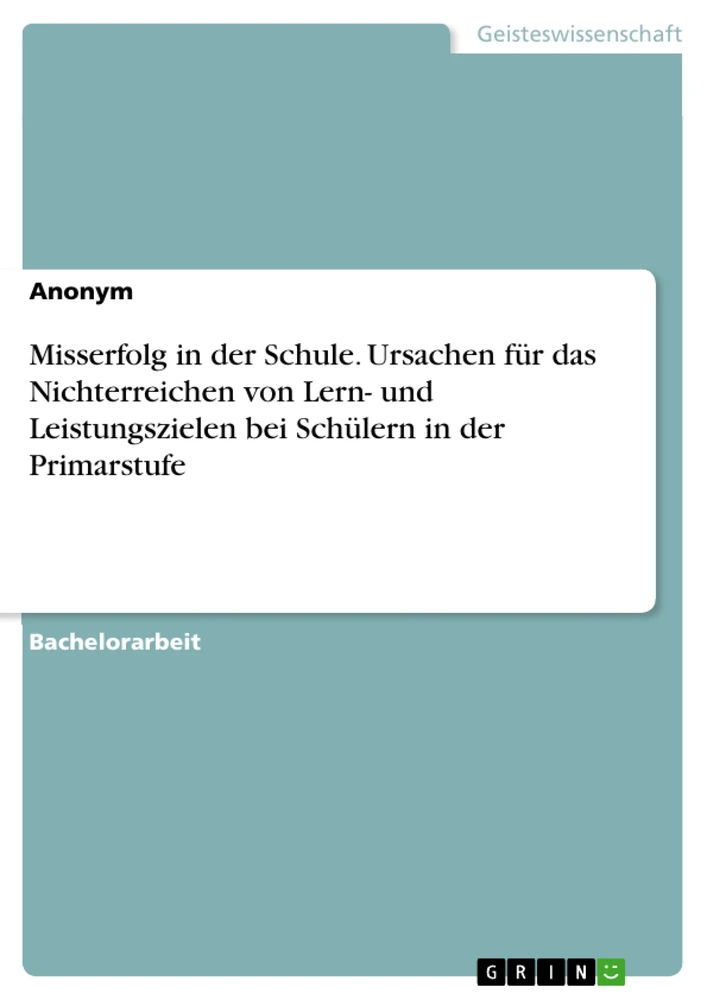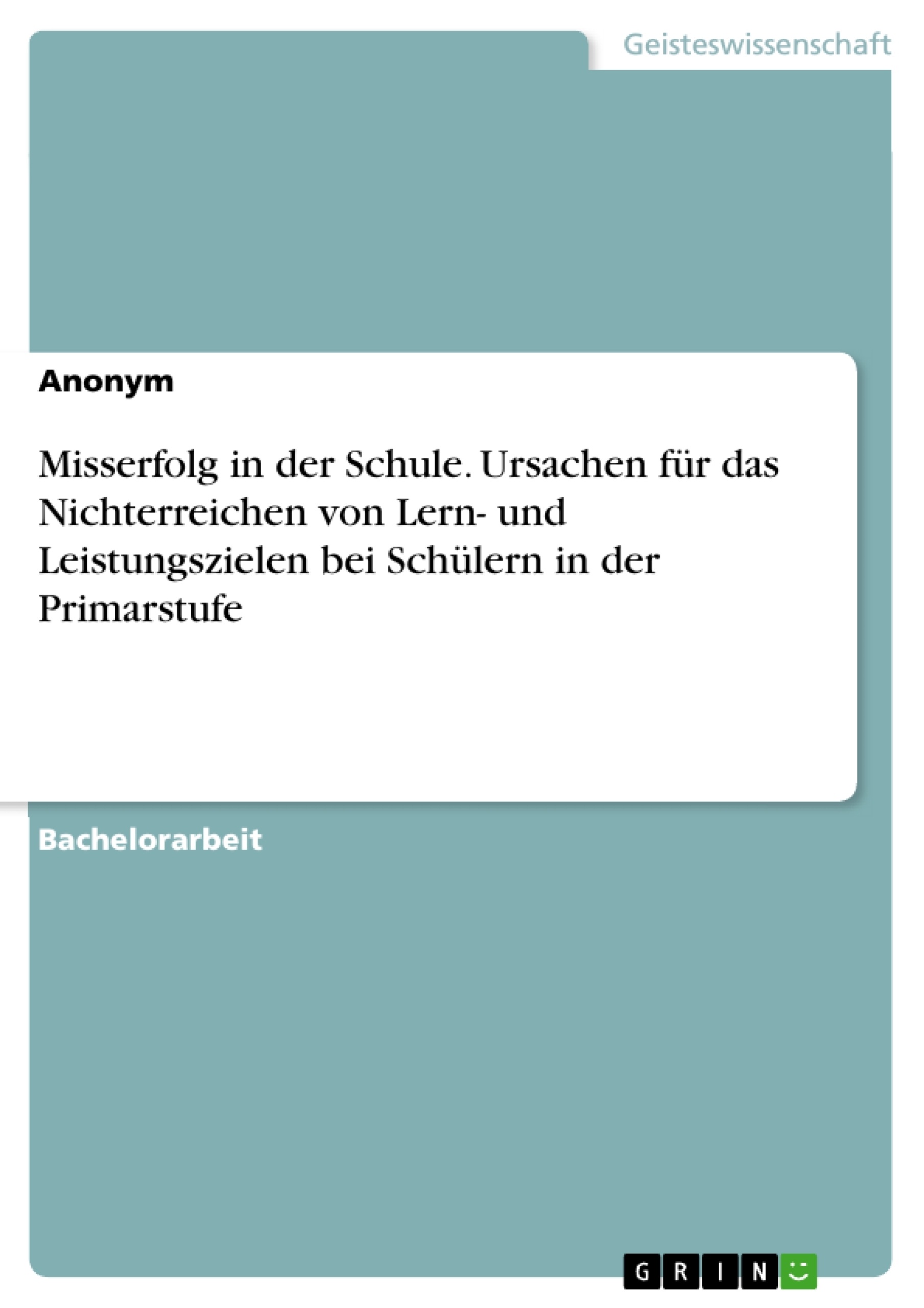Welche Auswirkung hat ein Misserfolg auf nachfolgende Zielsetzungen? Und nach welchem System wählen wir unsere Ziele aus?
In der folgenden Arbeit wird diesen Fragen nachgegangen. Dazu wird zuerst definiert, was eigentlich ein Misserfolg im schulischen Kontext ist und versucht erste Ursachen auszumachen die hier zu einem Misserfolg führen können. Darauf folgt eine Auswahl an motivationspsychologischen Theorien die der Erklärung von Misserfolg und seinen Folgen dienen.
Da diese Theorien auf alle Menschen in variablen Lebenslagen zutreffen können, wird im dritten Teil dieser Arbeit auf Konzepte eingegangen die insbesondere auf Schulkinder zutreffen. Zum Schluss sollen Modelle dargestellt werden, die sich im schulischen Kontext dazu eignen, bestimmte Eigenschaften von Kindern so zu fördern, dass diese mit Misserfolgen produktiv umgehen können.
Fragt man eine Person „Was ist ein Misserfolg?“, so würde sie wahrscheinlich antworten: „Ich erlebe einen Misserfolg, wenn ich ein Ziel das ich mir gesetzt habe, nicht erreichen konnte“. Würde man sie daraufhin fragen „Was folgt für dich auf den Misserfolg?“, so könnte sie antworten: „Ich würde mich fragen, was ich falsch gemacht habe und versuchen bei einer zweiten Gelegenheit nicht den gleichen Fehler zu begehen“.
Doch würden wir wirklich so wie oben beschrieben objektiv darüber nachdenken, was nun zu diesem Misserfolg geführt hat und dann unser Verhalten ändern? Kann man überhaupt objektiv beurteilen, was nun zum Misserfolg geführt hat und vor allem können Kinder das schon?
Neben den selbst gesetzten Zielen, werden uns unser Leben lang Ziele vorgegeben bzw. nahegelegt. Im Kleinkindalter fängt es mit so banalen Dingen an, wie laufen zu lernen. Spätestens im Grundschulalter werden uns weitere Ziele vorgegeben, wie Schreiben und Lesen lernen oder das kleine Ein-Mal-Eins zu beherrschen. Setzt sich das Grundschulkind bereits selbst diese Ziele? Wie hängen diese Ziele mit der Umwelt und im Kontext Schule mit den Lehrkräften zusammen? Man ahnt, dass das Erreichenwollen von Zielen oft mit Anreizen aus der Außenwelt zusammenhängt. Besonders im Kontext Schule, bekommen wir Ziele, genauer Lernziele und Leistungsziele, vorgegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schulischer Misserfolg
- Lern- und Leistungsmotivation
- Intrinsische und extrinsische Motivation
- Das Anspruchsniveau
- Die Attributionstheorie
- Erlernte Hilflosigkeit als Folge von wiederholten Misserfolgen
- Schülerpersönlichkeit
- Lern- und Leistungszielorientierung
- Selbstkonzept
- Selbstwirksamkeitserwartung
- Der Glaube an eine gerechte Welt
- Förderung der Lern- und Leistungsmotivation
- Auswirkungen der Bezugsnormierung auf den Attributionsstil des Schülers
- Aus Misserfolgen lernen
- Erfolge wertschätzen
- Erreichbare Ziele setzen
- Selbstwirksamkeitserwartung fördern
- Was tun wenn es eigentlich schon zu spät ist?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ursachen und Auswirkungen von Misserfolgen bei Grundschulkindern im schulischen Kontext. Sie analysiert die Rolle der Lern- und Leistungsmotivation, die Bedeutung der Schülerpersönlichkeit und entwickelt Fördermodelle für einen produktiven Umgang mit Misserfolgen.
- Definition und Ursachen schulischen Misserfolgs
- Motivationspsychologische Theorien zur Erklärung von Misserfolg
- Einflussfaktoren der Schülerpersönlichkeit auf den Umgang mit Misserfolg
- Förderansätze zur Verbesserung des Umgangs mit Misserfolgen
- Bezugsnormierung und deren Auswirkungen auf den Attributionsstil
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung wirft zwei zentrale Fragen auf: Erstens, wie beeinflussen Misserfolge nachfolgende Zielsetzungen, und können Kinder objektiv die Ursachen von Misserfolgen analysieren? Zweitens, nach welchem System werden Ziele ausgewählt – selbstgesetzt oder vorgegeben? Die Arbeit untersucht diese Fragen, indem sie schulischen Misserfolg definiert, motivationspsychologische Theorien beleuchtet und Fördermodelle im schulischen Kontext vorstellt.
Schulischer Misserfolg: Dieses Kapitel definiert schulischen Misserfolg anhand von Leistungsbewertungen durch Lehrkräfte. Es wird diskutiert, wie die subjektive Wahrnehmung von Misserfolg vom individuellen und sozialen Vergleich abhängt, sowie von den unterschiedlichen Bewertungsmaßstäben (objektiv, intraindividuell, interindividuell). Das Kapitel hebt hervor, dass die Lehrkraft-Perspektive nicht immer mit der Schüler-Perspektive übereinstimmt und dass Motivation im Primarbereich oft von äußeren Anreizen abhängt.
Schlüsselwörter
Schulischer Misserfolg, Lernmotivation, Leistungsmotivation, Attributionstheorie, Selbstwirksamkeitserwartung, Bezugsnormierung, Schülerpersönlichkeit, Fördermodelle, Primarstufe.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Ursachen und Auswirkungen von Misserfolgen bei Grundschulkindern
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Ursachen und Auswirkungen von Misserfolgen bei Grundschulkindern im schulischen Kontext. Sie analysiert die Rolle der Lern- und Leistungsmotivation, die Bedeutung der Schülerpersönlichkeit und entwickelt Fördermodelle für einen produktiven Umgang mit Misserfolgen.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Definition und Ursachen schulischen Misserfolgs; motivationspsychologische Theorien zur Erklärung von Misserfolg; Einflussfaktoren der Schülerpersönlichkeit auf den Umgang mit Misserfolg; Förderansätze zur Verbesserung des Umgangs mit Misserfolgen; Bezugsnormierung und deren Auswirkungen auf den Attributionsstil.
Welche Aspekte der Lern- und Leistungsmotivation werden beleuchtet?
Die Arbeit untersucht intrinsische und extrinsische Motivation, das Anspruchsniveau, die Attributionstheorie und erlernte Hilflosigkeit als Folge von wiederholten Misserfolgen. Es wird auch der Einfluss der Bezugsnormierung auf den Attributionsstil des Schülers betrachtet.
Welche Aspekte der Schülerpersönlichkeit spielen eine Rolle?
Die Arbeit betrachtet die Lern- und Leistungszielorientierung, das Selbstkonzept, die Selbstwirksamkeitserwartung und den Glauben an eine gerechte Welt als wichtige Einflussfaktoren auf den Umgang mit Misserfolg.
Welche Fördermodelle werden vorgestellt?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Förderansätze, die darauf abzielen, den Umgang mit Misserfolgen zu verbessern. Dies beinhaltet das Lernen aus Misserfolgen, das Wertschätzen von Erfolgen, das Setzen erreichbarer Ziele und die Förderung der Selbstwirksamkeitserwartung. Es wird auch die Frage behandelt, was getan werden kann, wenn es bereits zu spät scheint.
Wie wird schulischer Misserfolg definiert?
Schulischer Misserfolg wird in dieser Arbeit anhand von Leistungsbewertungen durch Lehrkräfte definiert. Es wird betont, dass die subjektive Wahrnehmung von Misserfolg vom individuellen und sozialen Vergleich sowie von unterschiedlichen Bewertungsmaßstäben (objektiv, intraindividuell, interindividuell) abhängt.
Welche Rolle spielt die Einleitung?
Die Einleitung stellt zwei zentrale Fragen: Erstens, wie beeinflussen Misserfolge nachfolgende Zielsetzungen, und können Kinder objektiv die Ursachen von Misserfolgen analysieren? Zweitens, nach welchem System werden Ziele ausgewählt – selbstgesetzt oder vorgegeben? Die Arbeit untersucht diese Fragen im weiteren Verlauf.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Schulischer Misserfolg, Lernmotivation, Leistungsmotivation, Attributionstheorie, Selbstwirksamkeitserwartung, Bezugsnormierung, Schülerpersönlichkeit, Fördermodelle, Primarstufe.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist strukturiert in Kapitel zu Einleitung, Schulischem Misserfolg, Lern- und Leistungsmotivation, Schülerpersönlichkeit, Förderung der Lern- und Leistungsmotivation und Fazit. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Thematik.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2011, Misserfolg in der Schule. Ursachen für das Nichterreichen von Lern- und Leistungszielen bei Schülern in der Primarstufe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/323027