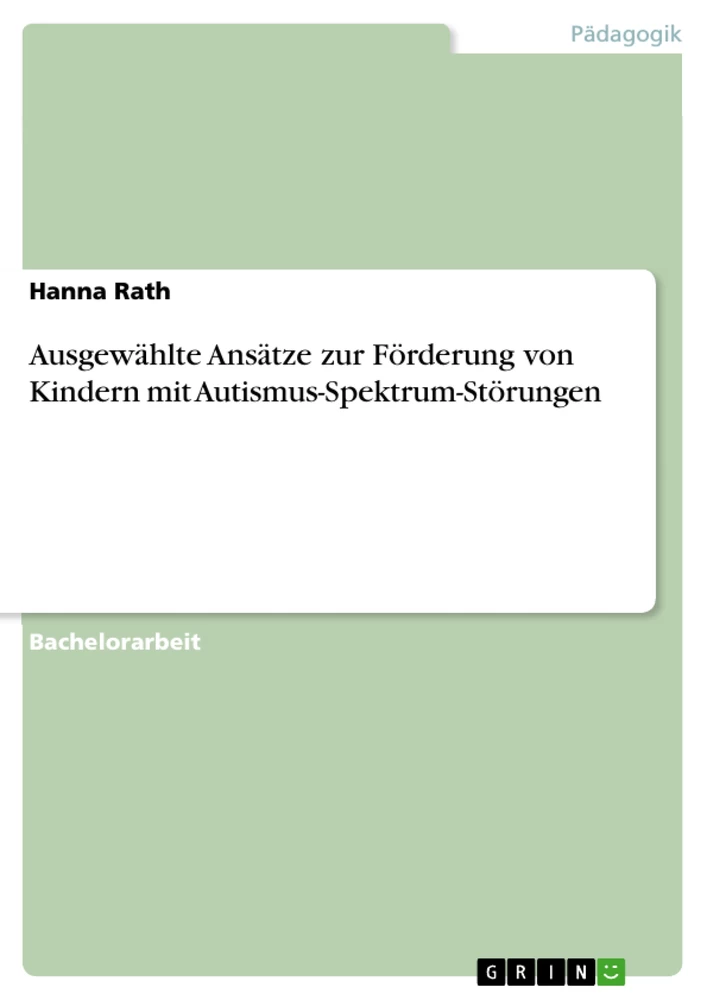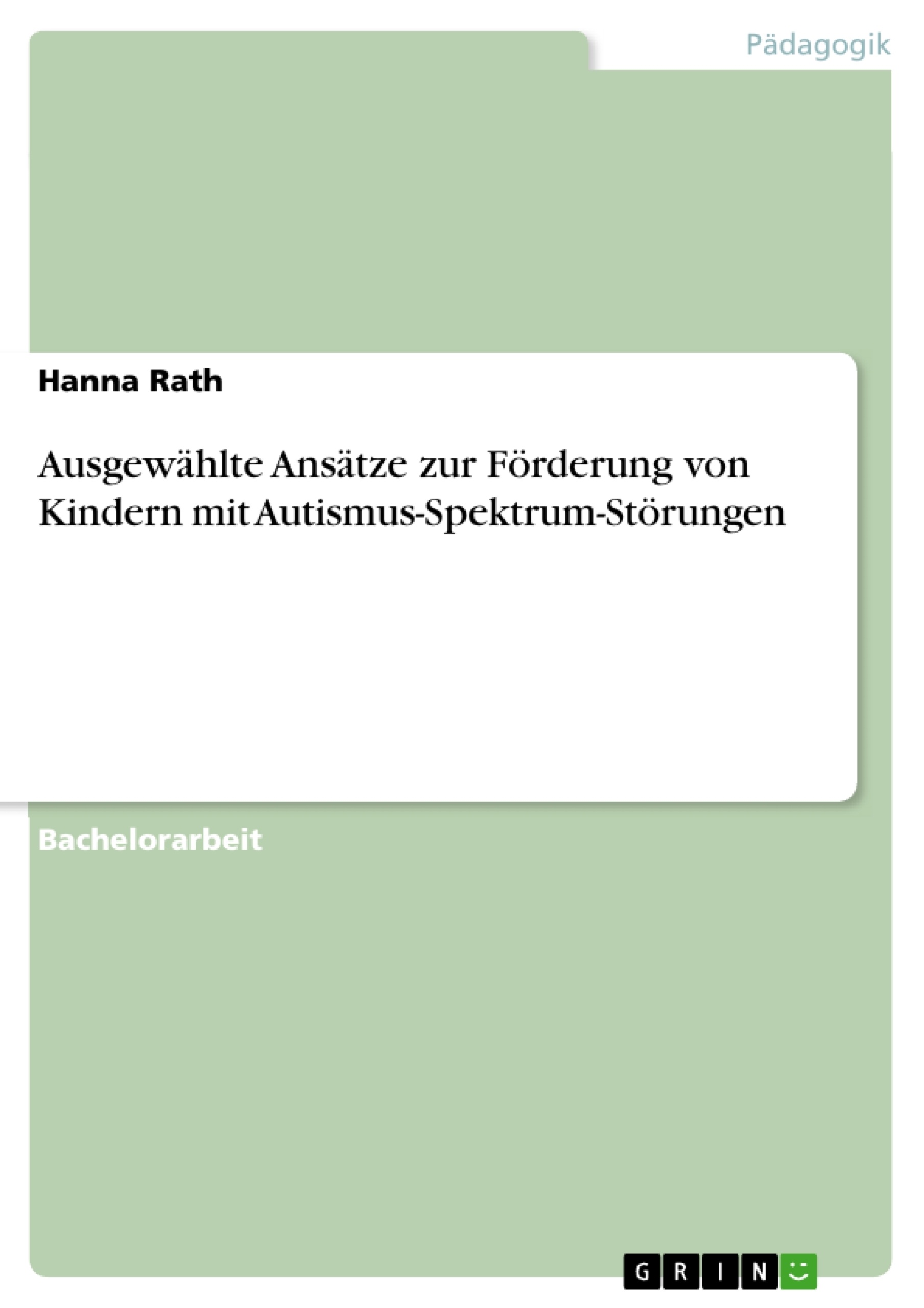Seit der im März 2009 in Deutschland geltenden UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen werden intensive Diskussionen über die schulische Bildung geführt. Laut Artikel 24 erkennen die Vertragsstaaten „das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung an“. „Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen“, verpflichten sich die Vertragsstaaten dazu, ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen zu schaffen und somit jedem Schüler den Zugang zu einer Schule für alle zu ermöglichen. Angesichts dessen besteht in der Bildungspolitik momentan die Tendenz, die bestehenden Förderschulen aufzulösen und alle Kinder gemeinsam zu unterrichten. Ausgehend von der gegenwärtigen Inklusionsdebatte ergibt sich für die Verfasserin als angehende Grundschullehrerin die Relevanz für das zu behandelnde Thema Ausgewählte Ansätze zur Förderung von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen dieser Bachelorarbeit. So werden sich zukünftig insbesondere die Anforderungen an Grundschullehrkräfte stark wandeln, die „die Heterogenität ihrer Schülerinnen und Schüler schätzen und im Unterricht fruchtbar machen“ und die Bedürfnisse aller Schüler mit und ohne Behinderung im Unterricht berücksichtigen sollen. Aufgrund der rechtlichen Grundlage der UN-Konvention erhalten auch Kinder mit einer Autismus-Spektrum-Störung das Recht, eine Regelschule zu besuchen. Für eine Grundschullehrkraft ist daher die Wahrscheinlichkeit, ein Kind mit einer autistischen Störung in der Klasse zu haben, auch aufgrund der gestiegenen Prävalenzrate der Autismus-Spektrum-Störungen, relativ hoch.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Phänomen Autismus-Spektrum-Störungen
- 2.1 Anfänge der Forschung
- 2.2 Klassifikation und Symptomatik
- 2.3 Komorbidität
- 2.4 Prävalenz
- 2.5 Prognose
- 2.6 Ursachen
- 2.7 Diagnostik
- 3. Ausgewählte Ansätze zur Förderung von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen
- 3.1 Evidenzbasierte Förderung
- 3.2 Das Picture Exchange Communication System (PECS)
- 3.2.1 Beschreibung des Verfahrens
- 3.2.2 Prinzipien
- 3.2.3 Durchführung
- 3.2.4 Empirische Studien
- 3.3 Der TEACCH-Ansatz
- 3.3.1 Beschreibung des Ansatzes
- 3.3.2 Prinzipien
- 3.3.3 Methode
- 3.3.4 Empirische Studien
- 3.4 Bewertung der Evidenz
- 3.5 Empfehlungen der Kultusministerkonferenz
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht ausgewählte Förderansätze für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen. Ziel ist es, einen Überblick über evidenzbasierte Methoden und deren Wirksamkeit zu geben. Die Arbeit fokussiert sich auf die praktische Anwendung und die wissenschaftliche Fundierung der jeweiligen Ansätze.
- Beschreibung des Phänomens Autismus-Spektrum-Störungen (ASS)
- Analyse evidenzbasierter Fördermethoden
- Detaillierte Darstellung des PECS und des TEACCH-Ansatzes
- Bewertung der empirischen Studien zu den ausgewählten Ansätzen
- Auswertung der Empfehlungen der Kultusministerkonferenz
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Bachelorarbeit ein und beschreibt die Relevanz der Thematik. Sie umreißt den Aufbau der Arbeit und die Forschungsfrage, die im Rahmen dieser Arbeit untersucht wird. Die Einleitung stellt den Kontext für die nachfolgenden Kapitel dar und dient als Grundlage für das Verständnis der gesamten Arbeit. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der frühzeitigen und angemessenen Förderung von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen.
2. Das Phänomen Autismus-Spektrum-Störungen: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über Autismus-Spektrum-Störungen. Es behandelt die Anfänge der Forschung, die Klassifikation und Symptomatik, Komorbiditäten, Prävalenz, Prognose, Ursachen und Diagnostik von ASS. Die verschiedenen Aspekte werden detailliert beschrieben und mit relevanten Forschungsergebnissen untermauert, um ein ganzheitliches Bild der Erkrankung zu zeichnen. Das Kapitel legt den Fokus auf das Verständnis der komplexen Natur von ASS und bereitet den Boden für die Diskussion der Förderansätze in den nachfolgenden Kapiteln.
3. Ausgewählte Ansätze zur Förderung von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen: Dieses Kapitel stellt verschiedene Förderansätze für Kinder mit ASS vor, wobei der Schwerpunkt auf evidenzbasierten Methoden liegt. Es werden detailliert das Picture Exchange Communication System (PECS) und der TEACCH-Ansatz beschrieben, einschließlich ihrer Prinzipien, Methoden und empirischen Studien. Eine kritische Bewertung der Evidenz sowie die Berücksichtigung der Empfehlungen der Kultusministerkonferenz runden das Kapitel ab. Es werden sowohl die Stärken als auch die Schwächen der jeweiligen Methoden beleuchtet und deren Eignung für verschiedene Altersgruppen und Schweregrade von ASS diskutiert. Das Kapitel dient als Grundlage für eine differenzierte Einschätzung der Wirksamkeit verschiedener Interventionen.
Schlüsselwörter
Autismus-Spektrum-Störungen, ASS, Förderansätze, evidenzbasierte Förderung, PECS, TEACCH, Komorbidität, Diagnostik, Empirische Studien, Kultusministerkonferenz, Inklusion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: Ausgewählte Förderansätze für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen
Was ist der Inhalt dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit befasst sich mit ausgewählten Förderansätzen für Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Sie gibt einen Überblick über evidenzbasierte Methoden und deren Wirksamkeit, fokussiert auf die praktische Anwendung und wissenschaftliche Fundierung der Ansätze. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel über das Phänomen ASS, ein Kapitel über ausgewählte Förderansätze (inkl. detaillierter Beschreibung von PECS und TEACCH), ein Fazit und eine Zusammenfassung der Kapitel. Schlüsselwörter und ein Inhaltsverzeichnis sind ebenfalls enthalten.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Beschreibung des Phänomens ASS (Anfänge der Forschung, Klassifikation und Symptomatik, Komorbidität, Prävalenz, Prognose, Ursachen und Diagnostik), Analyse evidenzbasierter Fördermethoden, detaillierte Darstellung des PECS und des TEACCH-Ansatzes (inkl. Prinzipien, Methoden und empirischen Studien), Bewertung der empirischen Studien zu den ausgewählten Ansätzen und Auswertung der Empfehlungen der Kultusministerkonferenz.
Welche Förderansätze werden im Detail untersucht?
Die Arbeit untersucht im Detail das Picture Exchange Communication System (PECS) und den TEACCH-Ansatz. Für beide Ansätze werden die Prinzipien, die Methode, die Durchführung (bei PECS) und die Ergebnisse empirischer Studien vorgestellt und bewertet.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit basiert auf wissenschaftlichen Studien und Forschungsergebnissen zu Autismus-Spektrum-Störungen und den ausgewählten Förderansätzen. Die konkreten Quellen werden im Literaturverzeichnis der vollständigen Arbeit aufgeführt (hier nicht enthalten).
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung der Arbeit ist es, einen Überblick über evidenzbasierte Fördermethoden für Kinder mit ASS zu geben und deren Wirksamkeit zu untersuchen. Der Fokus liegt auf der praktischen Anwendung und der wissenschaftlichen Fundierung der jeweiligen Ansätze.
Was ist das Fazit der Arbeit?
(Das Fazit ist nicht explizit in der Vorschau aufgeführt, es wird aber in der vollständigen Arbeit zu finden sein.) Es wird voraussichtlich eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Analyse der ausgewählten Förderansätze und deren Schlussfolgerungen enthalten.
Wer ist die Zielgruppe dieser Arbeit?
Die Zielgruppe sind Personen, die sich mit der Thematik Autismus-Spektrum-Störungen und deren Förderung auseinandersetzen, z.B. Fachkräfte in der Pädagogik, Therapie und Forschung.
Wo finde ich die vollständige Arbeit?
Die vollständige Arbeit mit allen Details, Quellenangaben und dem Fazit ist nicht in diesem HTML-Snippet enthalten. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit der vollständigen Arbeit sind beim Herausgeber anzufragen.
- Arbeit zitieren
- Hanna Rath (Autor:in), 2011, Ausgewählte Ansätze zur Förderung von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/322989