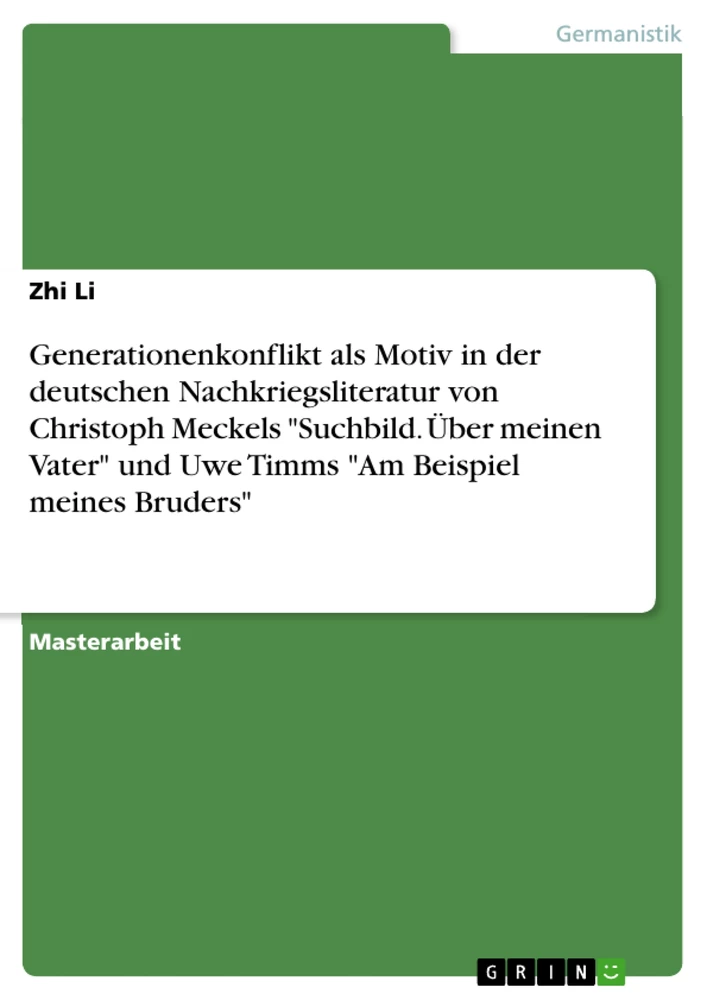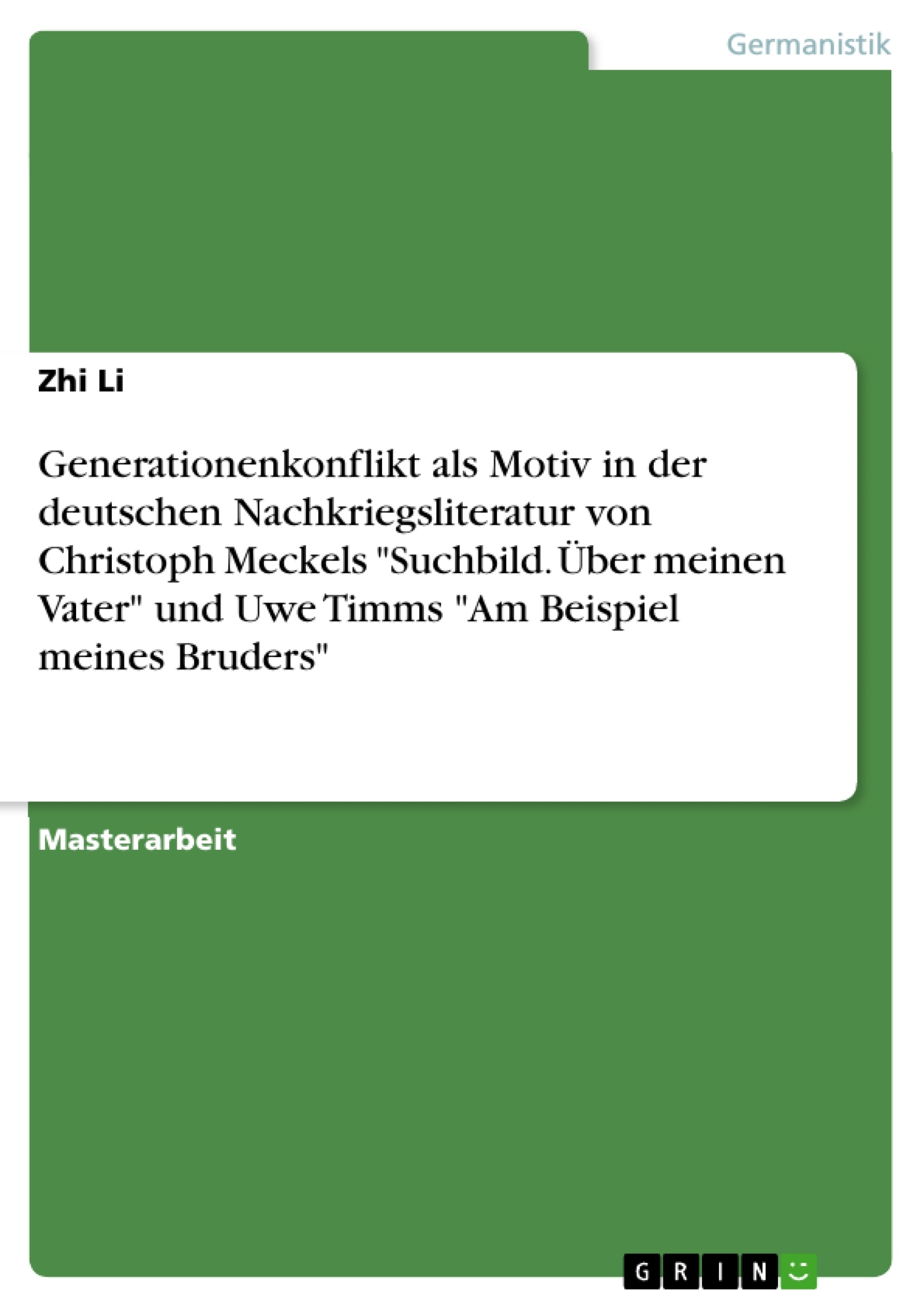Der Generationenkonflikt, besonders die Auseinandersetzung der Söhne mit ihren Vätern, ist ein zeitloses Motiv der Literaturgeschichte. Diese Tradition geht schon auf die frühe Literatur zurück. In der griechischen Mythologie sind eindeutige Spuren schon zu erkennen: Die Familiengeschichte von Zeus ist eine Geschichte des Generationenkonflikts.
Kronos, der Vater von Zeus, entmannte seinen eigenen Vater Uranos, um Herrscher der Titanen zu werden. Zeus, der spätere oberste Gott von Olymp, musste mit Kronos kämpfen, um zuerst ein Unterhaltsrecht und später die Herrschaft über die Welt zu erringen. Aus Angst, selbst von seinen eigenen Kindern entmachtet zu werden, fraß Zeus seine schwangere Gattin Metis auf, denn ein Orakel hatte ihn geweissagt, dass eine Tochter der Metis ihm gleichrangig wäre und ein Sohn würde ihn stürzen. Nicht zu vergessen die Ödipus-Erzählung, die als klassisches Motiv für einen Vater-Sohn-Konflikt steht. Dieser muss sich wegen seines Vatermords von Psychologen, Philosophen und Literaten über Generation aus der jeweiligen fachlichen Sicht interpretieren lassen. Auch Martin Opitz empfahl 1624 in seinem Buch von der deutschen Poeterey, dass der Mord an Kindern und Vätern besonders wirksame Themen für Dramatiker ist. In der Zeit von Sturm und Drang gewann der Kampf zwischen rebellischen Söhnen und autoritären Vätern sogar epochale Bedeutung, denn „in der Literaturgeschichtsschreibung ist es allgemein üblich, den Sturm und Drang unter dem Gesichtspunkt einer Generationserscheinung zu sehen [...].“
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Ein Generationendiskurs im Schatten des zweiten Weltkriegs
- 2.1 Theoretisch: zum Begriff der Generation
- 2.2 Generationentypen und der Zweite Weltkrieg
- 2.2.1 Die Kriegsgeneration
- 2.2.2 Die Nachkriegsgenerationen
- 2.2.2.1 die zweite Generation
- 2.2.2.2 die dritte Generation
- 2.3 Text statt Gespräch - Über das beschädigte Kommunikationsschema zweier Generationen
- 3. Die Schuldfragen
- 3.1 Zum Verständnis der Schuldfrage
- 3.2 Die kollektive Verleugnung der deutschen Schuld
- 3.3 Die zweite Generation und die zweite Schuld
- 4. Konflikt mit dem fremden Vater aus dem dritten Reich - Christoph Meckel ,,Suchbild. Über meinen Vater"
- 4.1 Eberhard Meckel: biographische Vorkenntnisse
- 4.2 Vater-Sohn-Konflikte auf der familiären Ebene
- 4.2.1 Zerfall des Halbgott-Images
- 4.2.2 Vater als fremder Eindringling
- 4.3 Vater-Sohn-Konflikte auf der gesellschaftspolitischen Ebene
- 4.3.1 Die Entdeckung des unbekannten Vaters im Dritten Reich
- 4.3.2 Suche nach Vaterspuren - Sohn als Ankläger und Richter
- 4.4 Fazit: Suchbild im Rahmen der Väterliteratur
- 5. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte über die Nazi-Vergangenheit
- Uwe Timms am Beispiel meines Bruders
- 5.1 Motive für Timms Spurensuche
- 5.2 Timms Konflikt mit Eltern und Bruder im Bereich des Familiengedächtnisses
- 5.2.1 Das Bruder-Bild in dem Familiengedächtnis
- 5.2.2 Timms Auseinandersetzung mit den Leerstellen im Familiengedächtnis
- 5.3 Timms Konflikt mit Vorurteilsstruktur in der Familie
- 5.3.1 Tätersprache
- 5.3.2 krankes Denkmuster
- 5.4 Fazit: Timms Werk im Vergleich zur Väterliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht den Generationenkonflikt als Motiv in der deutschen Nachkriegsliteratur am Beispiel der Werke von Christoph Meckel und Uwe Timm. Die Arbeit analysiert die Auseinandersetzung der Söhne mit ihren Vätern im Kontext der deutschen Geschichte und der Schuldfrage des Nationalsozialismus. Dabei werden die spezifischen Herausforderungen und Konflikte der Nachkriegsgenerationen beleuchtet.
- Die Auseinandersetzung mit der Nazi-Vergangenheit und der Rolle der Vätergeneration
- Der Generationenkonflikt als literarisches Motiv und seine spezifischen Ausprägungen in der Nachkriegszeit
- Die Schuldfrage und ihre Auswirkungen auf die Familiengeschichte und das Individuum
- Die Suche nach Identität und die Konstruktion von Vater-Sohn-Beziehungen im Schatten des Nationalsozialismus
- Das literarische Medium als Ort der Aufarbeitung von Vergangenheit und Trauma
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Generationenkonflikt als ein zeitloses Motiv der Literaturgeschichte vor und skizziert die Relevanz des Themas für die deutsche Nachkriegsliteratur. Kapitel 2 beleuchtet den Generationendiskurs im Kontext des Zweiten Weltkriegs und untersucht die verschiedenen Generationentypen und ihre spezifischen Erfahrungen. Kapitel 3 widmet sich der Schuldfrage und den komplexen Verstrickungen der Nachkriegsgenerationen in die Vergangenheit. Kapitel 4 analysiert Christoph Meckels Werk ,,Suchbild. Über meinen Vater" als Beispiel für die Auseinandersetzung mit einem Vater aus der Nazi-Vergangenheit. Kapitel 5 untersucht Uwe Timms ,,am Beispiel meines Bruders" und betrachtet die Konflikte im Familiengedächtnis und die Auseinandersetzung mit Vorurteilsstrukturen. Die Arbeit schließt mit einer Konklusion, die die zentralen Ergebnisse zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Generationenkonflikt, Nachkriegsliteratur, Christoph Meckel, Uwe Timm, Nazi-Vergangenheit, Schuldfrage, Familiengedächtnis, Vater-Sohn-Beziehung, Trauma, Identität, Literaturgeschichte.
- Citation du texte
- Zhi Li (Auteur), 2012, Generationenkonflikt als Motiv in der deutschen Nachkriegsliteratur von Christoph Meckels "Suchbild. Über meinen Vater" und Uwe Timms "Am Beispiel meines Bruders", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/322931