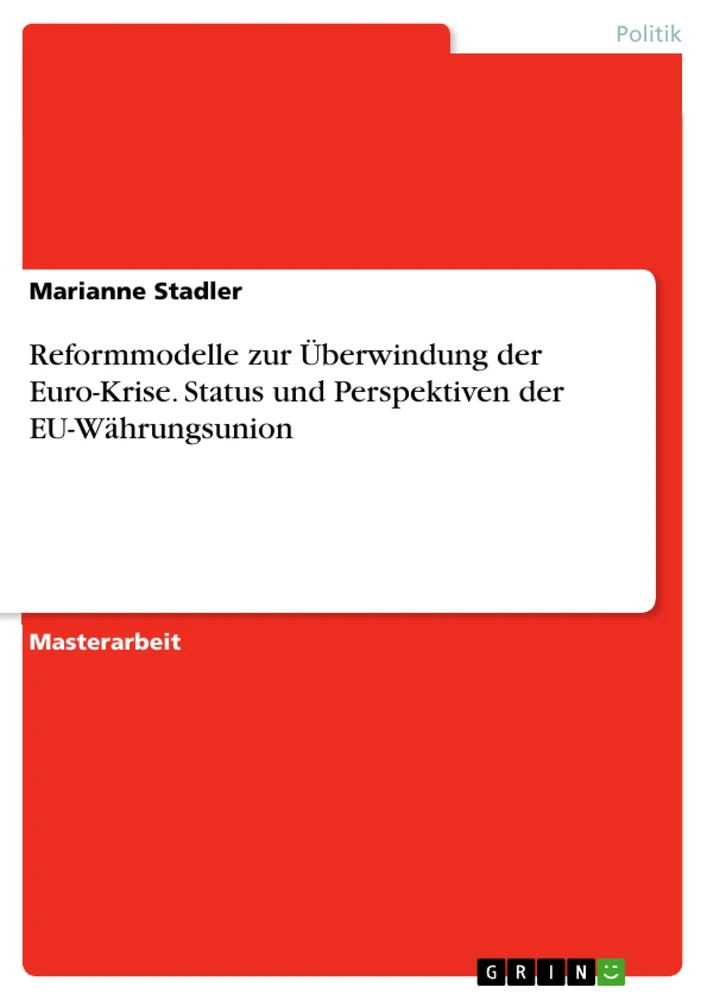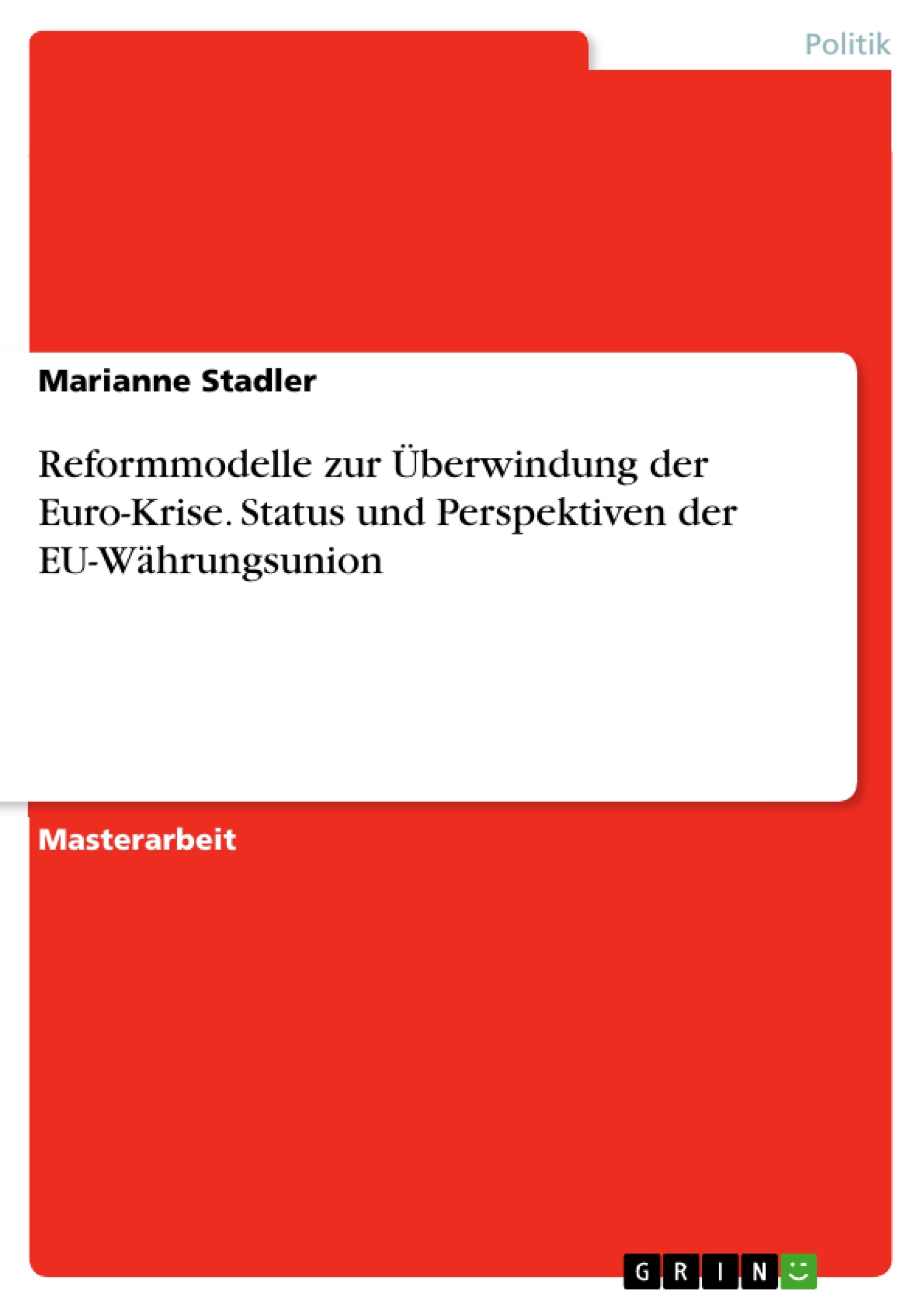Der Euro, welcher sukzessiv von 1999 – 2002 eingeführt worden ist, galt originär als das Symbol für die europäische Integration von Wirtschaft und Politik im Euro-Währungsraum.
Aus diesem Grund sollte die Gemeinschaftswährung vor allen Dingen als Ergänzung des Binnenmarktes innerhalb der Europäischen Union dienen und folglich dessen Effizienz steigern. Darüber hinaus erhöht eine Gemeinschaftswährung die Preistransparenz, Währungswechselkosten entfallen, die Wirtschaft wird vorangetrieben und der internationale Handel vereinfacht.
Doch insbesondere im Nachgang zur Finanzkrise 2008 wurde deutlich, dass der Euro nicht für alle Mitgliedsländer zur Basis des wirtschaftlichen Erfolgs geworden ist, wie es die Theorie anfangs weitestgehend suggerierte. Vielmehr sind insbesondere strukturelle Probleme innerhalb einiger Euro-Mitgliedsländer offensichtlich geworden, welche nachhaltig die Stabilität und den Wert des Euro belasten sowie zu einigen Krisenherde innerhalb der gesamten Währungsunion führten.
Basierend auf diesem Status Quo liegt der Fokus dieser Masterarbeit auf der Analyse möglicher Reformmodelle zur Überwindung der Euro-Krise.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Herauskristallisierung und Stellenwert der Themenstellung
- 1.2 Problemstellung, Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- 2. Der Euro als Resultat der europäischen Währungsunion
- 2.1 Das Konstrukt einer Währungsunion
- 2.1.1 Definition Währungsunion und Optimalität
- 2.1.2 Wirtschaftliche Anreize sowie Kosten der Einheitswährung
- 2.1.3 Politische Motivation
- 2.1.4 Rechtliche Grundlagen innerhalb der EU
- 2.1.5 Anfängliches Stimmungsbild privater Haushalte
- 2.2 Entstehung der europäischen Währungsunion
- 2.2.1 Implementation der Gemeinschaftswährung
- 2.2.1.1 Konvergenzkriterien
- 2.2.1.2 Praktische Umsetzung
- 2.2.2 Erweiterung der Währungsunion
- 2.2.3 Grundlegende Fehlkonstruktionen
- 2.2.4 Exklusion einiger europäischer Länder
- 3. Die Euro Krise
- 3.1 Analyse der Ursachen anhand der Wirtschaftsleistung der PIIGS-Staaten
- 3.1.1 Portugal
- 3.1.2 Irland
- 3.1.3 Italien
- 3.1.4 Griechenland
- 3.1.5 Spanien
- 3.1.6 Deutschland im Vergleich zu den PIIGS-Staaten
- 3.2 Verlauf der Krise
- 3.2.1 Finanzkrise
- 3.2.2 Griechenlandkrise
- 3.3 Die Rolle der Europäischen Zentralbank
- 3.3.1 Institutionelle Abgrenzung und Originäres Mandat
- 3.3.2 Leitungsorgane der EZB
- 3.3.3 Geldpolitische Instrumentarien
- 3.3.3.1 Offenmarktgeschäfte
- 3.3.3.2 Ständige Fazilitäten
- 3.3.3.3 Mindestreservepolitik
- 3.3.4 Unabhängigkeit der EZB
- 3.4 Der Euro-Rettungsschirm
- 3.4.1 Begriffsabgrenzung
- 3.4.2 Europäischer Finanzstabilisierungsmechanismus (EFSM)
- 3.4.3 Europäische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF)
- 3.4.4 Europäischer Stabilitätsmechanismus (ESM)
- 4. Kritische Beurteilung möglicher Reformmodelle zur Überwindung der Krise
- 4.1 Die Währungsunion als Transferunion
- 4.2 Ein Europa der zwei Geschwindigkeiten
- 4.3 Nord- und Südeuro
- 4.4 Einführung einer Parallelwährung zum Euro
- 4.5 Einführung einer Europasteuer
- 4.6 Implementierung eines europäischen Finanzministers
- 4.7 Ausscheiden auf Zeit
- 4.8 Insolvenzregime für zahlungsunfähige Staaten
- 4.9 Ein Europa nach amerikanischem Vorbild
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Entstehung und Entwicklung der europäischen Währungsunion sowie die Herausforderungen, die sich durch die Eurokrise ergeben haben. Sie untersucht die Ursachen der Krise, beleuchtet die Rolle der Europäischen Zentralbank und analysiert verschiedene Reformmodelle, die zur Überwindung der Krise beitragen könnten.
- Die Entstehung und Entwicklung der Europäischen Währungsunion
- Die Ursachen und Folgen der Eurokrise
- Die Rolle der Europäischen Zentralbank in der Krise
- Mögliche Reformmodelle zur Überwindung der Eurokrise
- Die Zukunft der Europäischen Währungsunion
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der europäischen Währungsunion ein und beleuchtet die Relevanz der Themenstellung. Kapitel 2 beschreibt die Entstehung der Währungsunion und beleuchtet die wirtschaftlichen, politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Kapitel 3 analysiert die Eurokrise und untersucht die Ursachen anhand der Wirtschaftsleistung der PIIGS-Staaten. Kapitel 4 befasst sich mit der Rolle der Europäischen Zentralbank während der Krise und analysiert verschiedene Reformmodelle zur Überwindung der Krise.
Schlüsselwörter
Europäische Währungsunion, Eurokrise, PIIGS-Staaten, Europäische Zentralbank, Reformmodelle, Wirtschaftsleistung, Staatsverschuldung, Geldpolitik, Finanzkrise, Transferunion.
- Quote paper
- Marianne Stadler (Author), 2016, Reformmodelle zur Überwindung der Euro-Krise. Status und Perspektiven der EU-Währungsunion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/322718