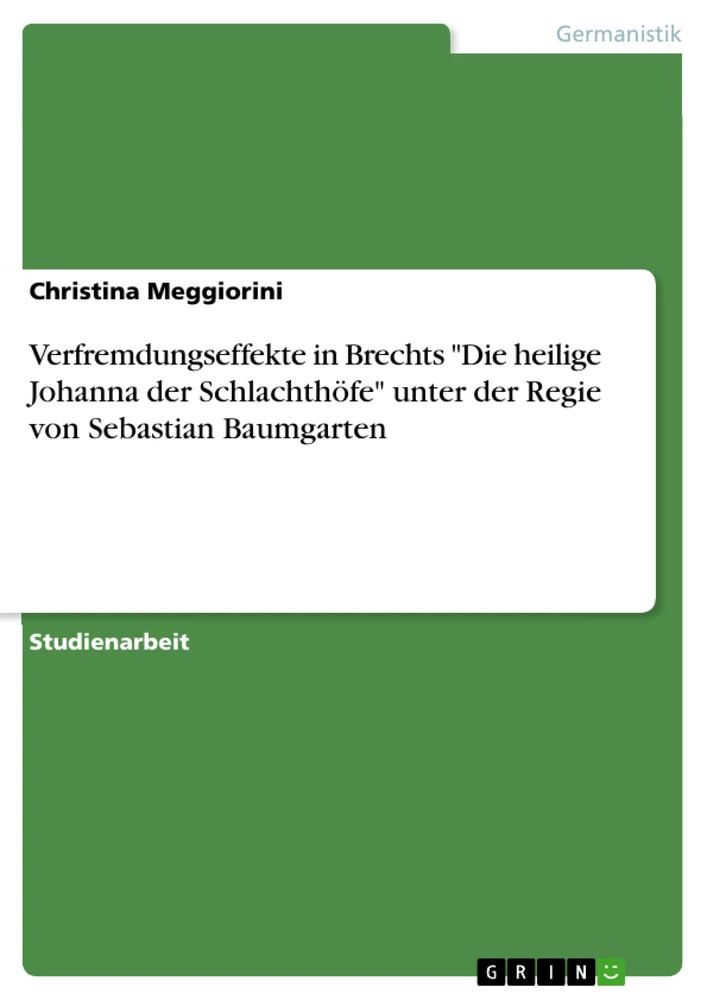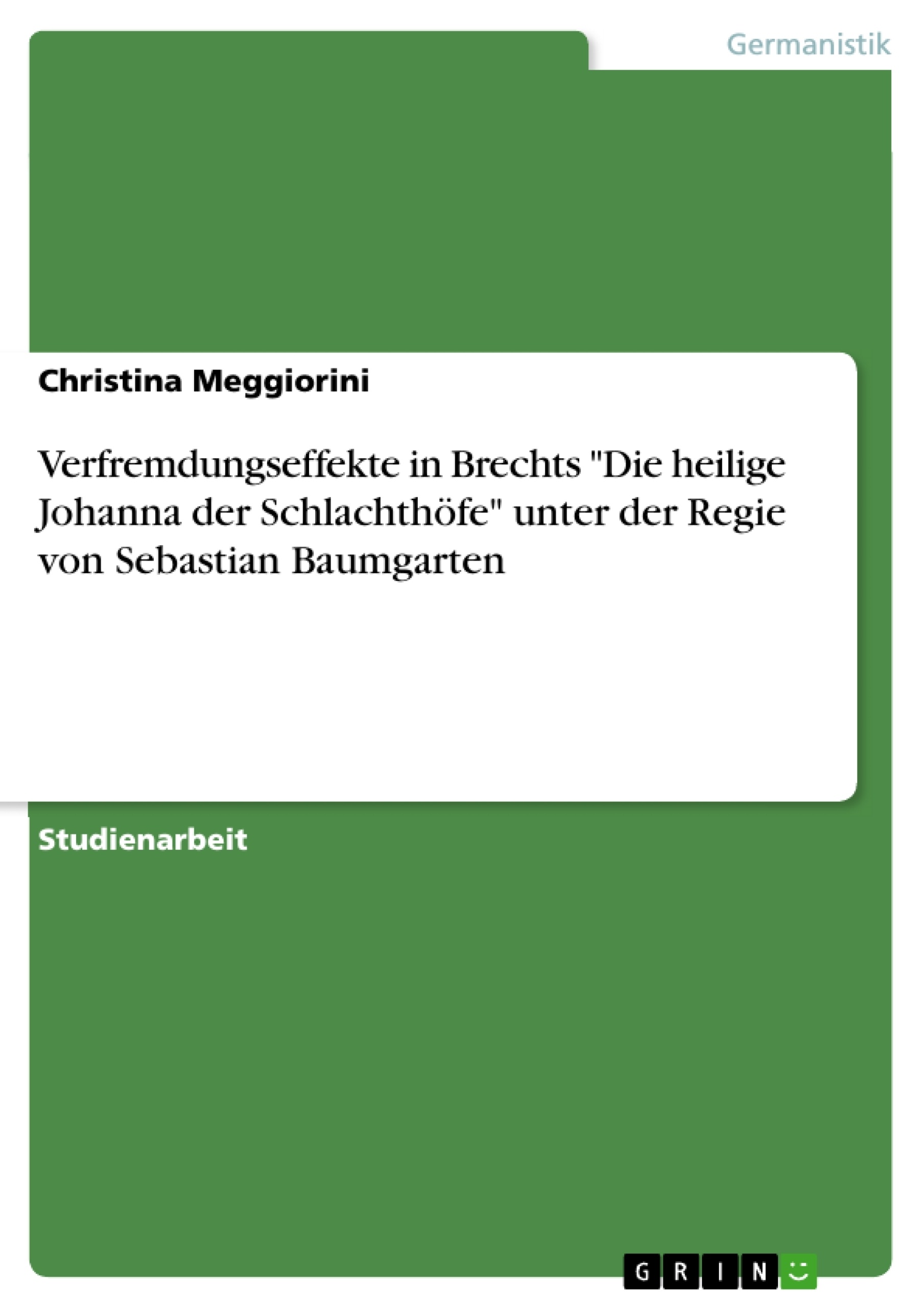Das Stück "Die heilige Johanna der Schlachthöfe" ist das Ergebnis eines gemeinschaftlichen Schöpfungsprozesses von Bertold Brecht, Elisabeth Hauptmann, Hermann Borchardt und Emil Burri. Das Stück wurde von Radio Berlin am 11. April 1932 in einer stark gekürzten Hörspielfassung erstmals ausgestrahlt. Brechts Bemühungen das Theaterstück auf die Bühne zu bringen scheiterten an der politisch schwierigen Situation. Es wurde erst am 30. April 1959 am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg uraufgeführt, danach folgten zahlreiche weitere Inszenierungen. Sebastian Baumgarten brachte es 2012 erneut auf die Bühne und wurde damit ein Jahr später zum 50. Theatertreffen nach Berlin eingeladen, bei dem die bemerkenswertesten Theaterinszenierungen der Saison ausgezeichnet werden.
Brechts episches Theater beinhaltet viele Unterschiede zur dramatischen Form. Der elementarste, welcher eine Einfühlung des Zuschauers in die Darstellung verhindern soll, stellt die Einführung des Verfremdungseffektes dar. In meiner Arbeit möchte ich der Fragestellung nachgehen, wie Baumgarten den Verfremdungseffekt in seiner Inszenierung interpretiert und integriert. Um eine Basis dafür zu schaffen ist es sinnvoll zuerst die Begrifflichkeit zu klaren um dann über die Bedeutung der Verfremdung für das epische Theater zu einer Inszenierungsanalyse zu kommen. Die Inszenierungsanalyse behandelt diese Fragestellung anhand von ausgewählten Passagen und beansprucht nicht den Umfang einer Gesamtanalyse.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Verfremdungseffekt nach Brecht
- 2.1 Begriffsherkunft
- 2.2 Notwendigkeit der Verfremdung
- 2.2.1 Historisierung
- 3. Inszenierungsanalyse
- 3.1 Bühnenbau und Musik
- 3.2 Kostüme und Maske
- 3.3 Schauspiel
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Interpretation und Integration des Verfremdungseffekts in Sebastian Baumgartens Inszenierung von Brechts „Die heilige Johanna der Schlachthöfe“. Die Analyse konzentriert sich auf die Umsetzung des Verfremdungseffekts anhand ausgewählter Passagen der Inszenierung. Die Arbeit klärt zunächst die Begrifflichkeit des Verfremdungseffekts und dessen Bedeutung für das epische Theater.
- Der Verfremdungseffekt nach Brecht und seine Begriffsherkunft
- Die Notwendigkeit des Verfremdungseffekts im epischen Theater
- Die Historisierung als Methode der Verfremdung
- Analyse der Inszenierung von Sebastian Baumgarten
- Umsetzung des Verfremdungseffekts in der Inszenierung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Entstehung und Aufführungsgeschichte von Brechts „Die heilige Johanna der Schlachthöfe“, insbesondere die Inszenierung von Sebastian Baumgarten und deren Auszeichnung beim Theatertreffen Berlin. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Interpretation und Integration des Verfremdungseffekts in dieser Inszenierung und skizziert den Aufbau der Arbeit.
2. Verfremdungseffekt nach Brecht: Dieses Kapitel analysiert Brechts Verständnis des Verfremdungseffekts. Es untersucht die Begriffsherkunft, vergleicht „verfremden“ und „entfremden“, und diskutiert unterschiedliche Interpretationen des Begriffs, einschließlich der Verbindung zu Hegel, Marx und der Kapitalismuskritik. Das Kapitel beleuchtet die Bedeutung des Verfremdungseffekts als zentralen Bestandteil von Brechts epischem Theater und seiner Kritik am bestehenden Theatermodell.
3. Inszenierungsanalyse: Dieses Kapitel analysiert die Inszenierung von Sebastian Baumgarten von „Die heilige Johanna der Schlachthöfe“ im Hinblick auf die Umsetzung des Verfremdungseffekts. Es untersucht, wie Baumgarten die sprachlichen und nichtsprachlichen Mittel des Verfremdungseffekts einsetzt, um dem Zuschauer einen kritischen Blick auf die dargestellten gesellschaftlichen Vorgänge zu ermöglichen. Die Analyse bezieht sich auf ausgewählte Passagen der Inszenierung und beschränkt sich auf das Inszenierungskonzept, ohne die spezifischen Mittel der filmischen Aufzeichnung zu berücksichtigen.
Schlüsselwörter
Verfremdungseffekt, episches Theater, Bertold Brecht, Sebastian Baumgarten, Die heilige Johanna der Schlachthöfe, Inszenierungsanalyse, Historisierung, Kapitalismuskritik, Theatertheorie.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Inszenierung von „Die heilige Johanna der Schlachthöfe“
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Interpretation und Integration des Verfremdungseffekts in Sebastian Baumgartens Inszenierung von Brechts „Die heilige Johanna der Schlachthöfe“. Der Fokus liegt auf der Umsetzung des Verfremdungseffekts anhand ausgewählter Szenen der Inszenierung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Verfremdungseffekt nach Brecht, seine Begriffsherkunft und Bedeutung für das epische Theater. Sie untersucht die Notwendigkeit des Verfremdungseffekts, insbesondere die Historisierung als Methode der Verfremdung. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Analyse der Inszenierung von Sebastian Baumgarten selbst, insbesondere wie der Verfremdungseffekt in dieser Inszenierung umgesetzt wird.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Verfremdungseffekt nach Brecht, ein Kapitel zur Inszenierungsanalyse und ein Fazit. Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage. Das zweite Kapitel analysiert den Verfremdungseffekt nach Brecht, seine Begriffsherkunft und Bedeutung. Das dritte Kapitel analysiert die Inszenierung von Sebastian Baumgarten im Hinblick auf die Umsetzung des Verfremdungseffekts. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung beschreibt die Entstehung und Aufführungsgeschichte von Brechts „Die heilige Johanna der Schlachthöfe“, insbesondere die Inszenierung von Sebastian Baumgarten und deren Auszeichnung beim Theatertreffen Berlin. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Interpretation und Integration des Verfremdungseffekts in dieser Inszenierung und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Was wird im Kapitel zum Verfremdungseffekt behandelt?
Dieses Kapitel analysiert Brechts Verständnis des Verfremdungseffekts. Es untersucht die Begriffsherkunft, vergleicht „verfremden“ und „entfremden“, und diskutiert unterschiedliche Interpretationen des Begriffs, einschließlich der Verbindung zu Hegel, Marx und der Kapitalismuskritik. Es beleuchtet die Bedeutung des Verfremdungseffekts als zentralen Bestandteil von Brechts epischem Theater und seiner Kritik am bestehenden Theatermodell.
Was wird in der Inszenierungsanalyse untersucht?
Die Inszenierungsanalyse untersucht, wie Sebastian Baumgarten die sprachlichen und nichtsprachlichen Mittel des Verfremdungseffekts einsetzt, um dem Zuschauer einen kritischen Blick auf die dargestellten gesellschaftlichen Vorgänge zu ermöglichen. Die Analyse bezieht sich auf ausgewählte Passagen der Inszenierung und beschränkt sich auf das Inszenierungskonzept, ohne die spezifischen Mittel der filmischen Aufzeichnung zu berücksichtigen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Verfremdungseffekt, episches Theater, Bertold Brecht, Sebastian Baumgarten, Die heilige Johanna der Schlachthöfe, Inszenierungsanalyse, Historisierung, Kapitalismuskritik, Theatertheorie.
Welche Methode wird in der Inszenierungsanalyse verwendet?
Die Inszenierungsanalyse untersucht die Umsetzung des Verfremdungseffekts in Sebastian Baumgartens Inszenierung, indem sie die sprachlichen und nichtsprachlichen Mittel der Inszenierung analysiert, die zur Erzeugung des Verfremdungseffekts beitragen. Es wird sich auf ausgewählte Passagen der Inszenierung konzentriert.
- Quote paper
- Christina Meggiorini (Author), 2016, Verfremdungseffekte in Brechts "Die heilige Johanna der Schlachthöfe" unter der Regie von Sebastian Baumgarten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/322675