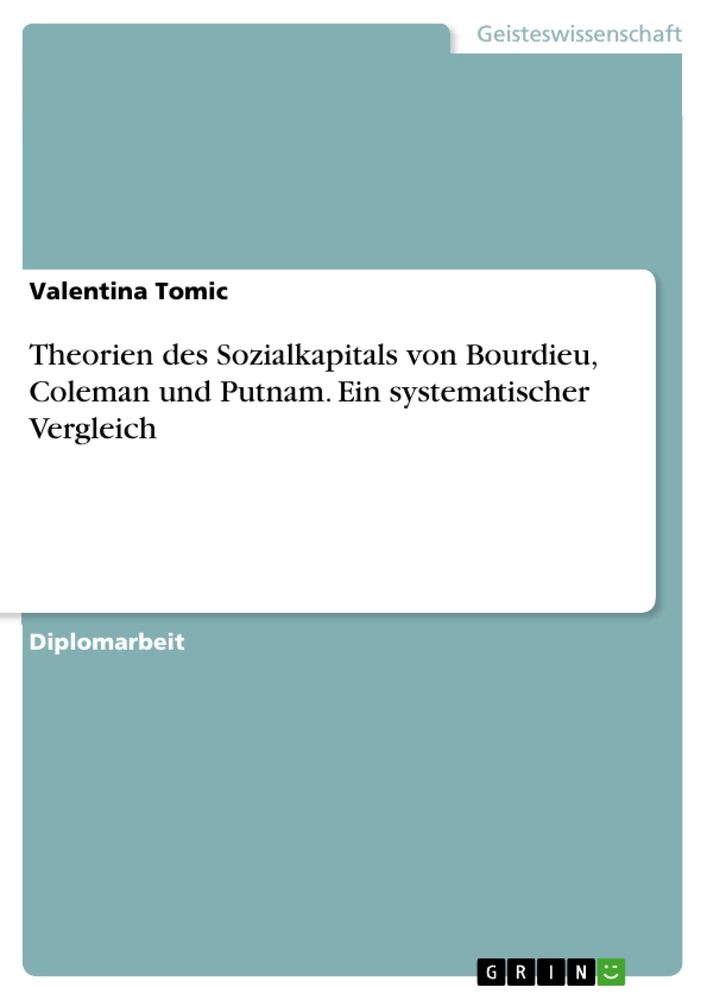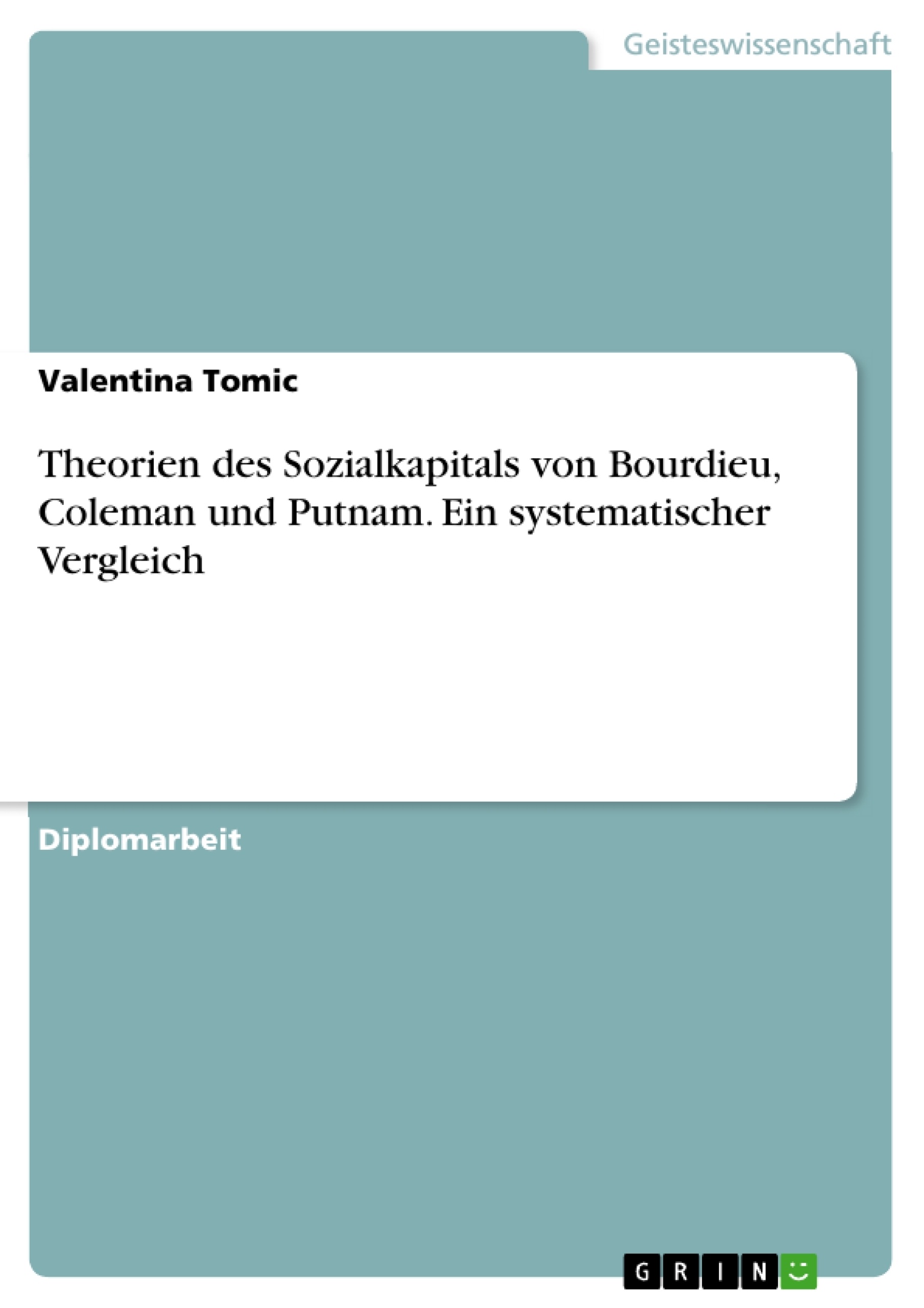Der Gegenstand vorliegender Arbeit ist ein systematischer Vergleich der Sozialkapitaltheorien. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass es keine einheitliche Sozialkapitaltheorie gibt, stellt sich hier die Frage, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede es zwischen verschiedenen Sozialkapitaltheorien gibt. Herrscht Einigkeit darüber, wie das Sozialkapital entsteht und wem es zugänglich ist? Haben die Theoretiker die gleichen Auffassungen darüber, welche Funktion das Sozialkapital erfüllt und welche Auswirkungen es hat? Das sind Fragen, die in vorliegender Arbeit beantwortet werden sollen.
Seit Mitte der neunziger Jahre ist die Zahl der Forschungen zum Thema Sozialkapital drastisch gestiegen. Das Forschungsinteresse für das Sozialkapital ist in vielen wissenschaftlichen Bereichen ersichtlich. Diekmann spricht in Bezug auf seine steigende Popularität von „Sozialkapital-Fieber“ (s. Diekmann 2007, 47). Über Sozialkapital wird in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen wie Soziologie, Politikwissenschaft und Wirtschaftswissenschaften geforscht. Entscheidend für die Erklärung seiner Konjunktur ist aber weniger die Frage, in welchen wissenschaftlichen Bereichen es alles untersucht wird, sondern warum.
„Sozialkapital galt lange Zeit als universell einsetzbares Allheilmittel“ (Geißler/Kern/Klein/Berger 2004, 9). Es werden ihm zahlreiche positive Auswirkungen zugeschrieben. Sie reichen von seinem positiven Einfluss auf die Wirtschaft, die Kriminalitätsbekämpfung und physische Gesundheit, bis hin zu seinen positiven Auswirkungen auf die Qualität öffentlicher Verwaltungen und die Demokratie. Auf der anderen Seite gibt es Autoren, die mit dem Sozialkapital auch negative Auswirkungen verbinden, wie die Integrationsverhinderung und Exklusion. Das Sozialkapital kann sowohl als privates als auch als kollektives Gut existent sein. Es kann „sowohl als Merkmal von Individuen bzw. Beziehungen zwischen Individuen wie auch als Merkmal von Kollektiven“ aufgefasst werden, was nicht zuletzt der Grund dafür ist, dass es in unterschiedlichen Zusammenhängen angewendet werden kann. Dies hat wiederum eine „Vielzahl an Definitionen und Operationalisierungen“ zur Folge. Es gibt keine einheitliche Theorie des Sozialkapitals, sondern mehrere unabhängig voneinander existierende Forschungsparadigmen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Das Sozialkapital
- 1. Der Begriff des Sozialkapitals
- 2. Wie wird das Sozialkapital gemessen?
- III. Theorien des Sozialkapitals
- 1. Sozialkapital in der Theorie von Pierre Bourdieu
- 1.1 Der soziale Raum
- 1.2 Der Habitus
- 1.3 Kulturelles Kapital
- 1.3.1 Inkorporiertes kulturelles Kapital
- 1.3.2 Objektiviertes kulturelles Kapital
- 1.3.3 Institutionalisiertes kulturelles Kapital
- 1.4 Sozialkapital
- 1.5 Transferierbarkeit des Kapitals
- 1.6 Kapital und Reproduktionsstrategien
- 2. Sozialkapital in der Theorie von James S. Coleman
- 2.1 Formen des Sozialkapitals
- 2.1.1 Verpflichtungen und Erwartungen
- 2.1.2 Informationspotenziale
- 2.1.3 Soziale Normen und wirksame Sanktionen
- 2.1.4 Herrschaftsbeziehungen
- 2.1.5 Soziale Organisationen
- 2.2 Sozialkapital als Kollektivgut
- 2.3 Sozialkapital und Vertrauen
- 2.4 Sozialkapital in Bezug auf andere Kapitalarten
- 3. Sozialkapital in der Theorie von Robert D. Putnam
- 3.1 Formen des Sozialkapitals
- 3.1.1 Formelles und informelles Sozialkapital
- 3.1.2 Sozialkapital mit hoher und geringer Dichte
- 3.1.3 Innenorientiertes und außenorientiertes Sozialkapital
- 3.1.4 Brückenbildendes und brückenbindendes Sozialkapital
- 3.2 Sozialkapital und Vertrauen
- 3.3 Sozialkapital in Bezug auf andere Kapitalarten
- IV. Ein Vergleich der Theorien von Bourdieu, Coleman und Putnam
- 1. Strukturelle Ebene des Sozialkapitals
- 1.1 Mikroebene
- 1.2 Mesoebene
- 1.3 Makroebene
- 2. Sozialkapital - Entstehung und Zugangsberechtigung
- 3. Funktionen und Auswirkungen des Sozialkapitals
- 3.1 Positive Auswirkungen des Sozialkapitals
- 3.2 Negative Auswirkungen des Sozialkapitals
- 4. Sozialkapital und Vertrauen
- 5. Operationalisierung des Sozialkapitals
- V. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, die verschiedenen Theorien des Sozialkapitals systematisch zu vergleichen und Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede aufzuzeigen. Dabei werden die Ansätze von Pierre Bourdieu, James S. Coleman und Robert D. Putnam im Fokus stehen. Die Arbeit untersucht, wie die Entstehung und der Zugang zum Sozialkapital in den jeweiligen Theorien beschrieben werden, welche Funktionen und Auswirkungen ihm zugeschrieben werden und wie die Beziehung zwischen Sozialkapital und Vertrauen betrachtet wird.
- Der Begriff des Sozialkapitals und seine verschiedenen Facetten
- Die Entstehung und der Zugang zum Sozialkapital in unterschiedlichen Theorien
- Die Funktionen und Auswirkungen von Sozialkapital auf Individuen und Gesellschaft
- Die Rolle von Vertrauen im Kontext des Sozialkapitals
- Die Operationalisierung des Sozialkapitals in der Forschung
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird der Begriff des Sozialkapitals eingeführt und seine Entstehungsgeschichte beleuchtet. Außerdem werden verschiedene Methoden zur Messung des Sozialkapitals vorgestellt. Kapitel II befasst sich mit den Sozialkapitaltheorien von Bourdieu, Coleman und Putnam. Bourdieus Theorie des Sozialkapitals wird im Kontext seines Konzepts des sozialen Raums und des Habitus vorgestellt. Coleman betrachtet Sozialkapital als ein Kollektivgut, das positive Auswirkungen auf die Gesellschaft hat. Putnam untersucht die verschiedenen Formen des Sozialkapitals und ihre Rolle im gesellschaftlichen Zusammenhalt. Kapitel III vergleicht die drei Theorien hinsichtlich ihrer unterschiedlichen Perspektiven auf die Entstehung, den Zugang, die Funktionen und Auswirkungen des Sozialkapitals. Schließlich werden die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und Ausblicke auf zukünftige Forschungsfragen gegeben.
Schlüsselwörter
Sozialkapital, Pierre Bourdieu, James S. Coleman, Robert D. Putnam, soziale Netzwerke, Vertrauen, gesellschaftlicher Zusammenhalt, gesellschaftliche Ungleichheit, Reproduktionsstrategien, Kulturelles Kapital, Ökonomisches Kapital, Mikroebene, Mesoebene, Makroebene, Operationalisierung.
- Quote paper
- Dipl. Soziologin Valentina Tomic (Author), 2011, Theorien des Sozialkapitals von Bourdieu, Coleman und Putnam. Ein systematischer Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/322621