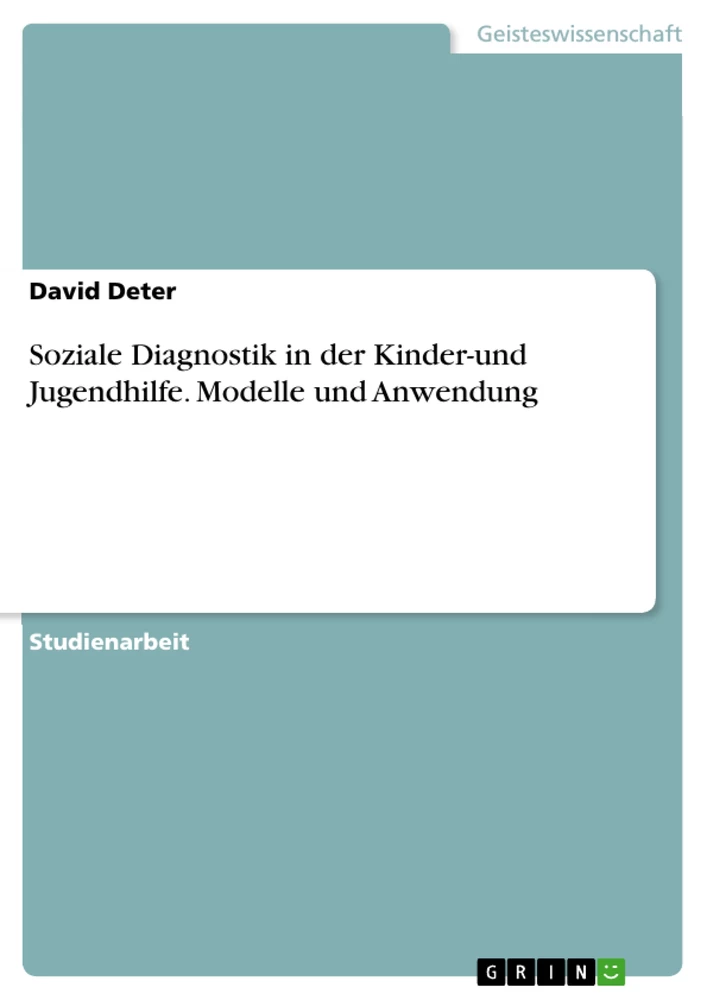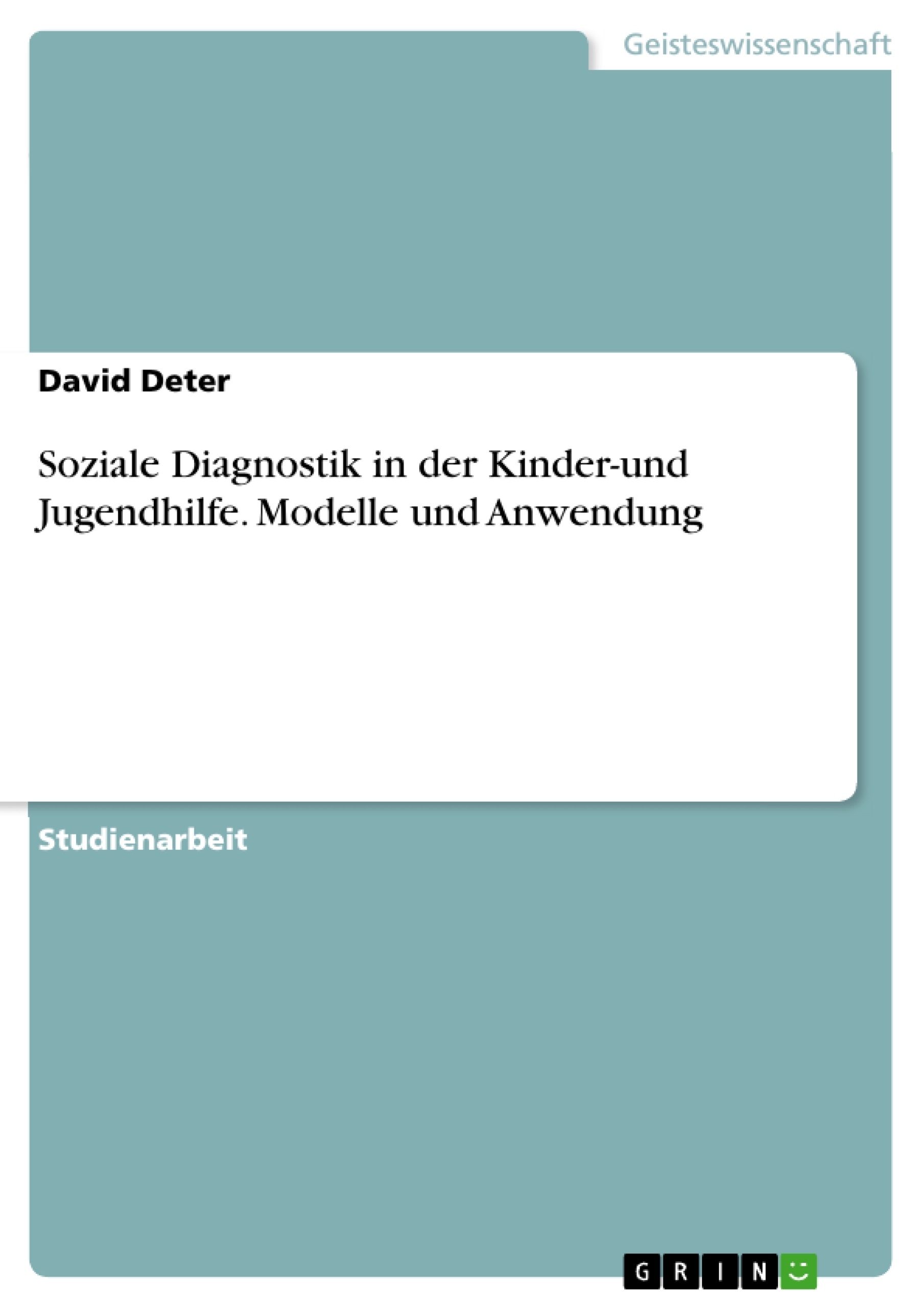Soziale Diagnostik wird in vielen Bereichen der Sozialen Arbeit angewendet (häufig auch unbewusst), in der Regel wird diese lediglich anders oder auch gar nicht benannt. Die Diagnose, welche eher im Bereich der Medizin oder der Psychologie angesiedelt ist, stellt eine Einschätzung oder eine Aussage dar.
Diese Annahmen durch einen „erkennenden Menschen“ beanspruchen vorläufige Geltung und sollen eine Grundlage oder eine Anleitung für das folgende Handeln darstellen. Daher wage ich die These, dass jeder fachlichen Leistungserbringung durch Sozialarbeiter / Sozialpädagogen eine Diagnostik zu Grunde liegt. Die Fachkräfte der Sozialen Arbeit beobachten, beschreiben, analysieren und bewerten, um zu einer Beurteilung eines Falles zu gelangen. Im Feld der Kinder- und Jugendhilfe werden Leistungen des SGB VIII als Interventionen bei familiären Problemen, Lernstörungen, Entwicklungsverzögerungen und vor allem bei Erziehungsproblemen und zur Gefährdungsabwehr realisiert.
Inhaltsverzeichnis
- Was ist Soziale Diagnostik
- Verhältnis der Sozialen Arbeit zur Diagnostik
- Methodisierte Verfahren sozialer Diagnostik würden den Fachkräften der Sozialen Arbeit nicht zur sach- und fachgerechten Erkenntnis der sozialen Realität verhelfen (vgl. Kunstreich u.a. 2005).
- Im Gegensatz dazu wird bezweifelt, ob verbesserte Erkenntnisverfahren überhaupt wünschenswert seien.
- Modell nach Mollenhauer und Uhlendorff
- Das Verfahren richtet sich nicht an einzelne Helfer, sondern an kleinere Fachteams (3-6 Personen).
- Die Problemdefinition und Handlungsplanung wird nicht an außenstehende „Experten“ abgegeben, sondern obliegt den Bezugsbetreuern, welche einen regelhaften Kontakt haben (vgl. Krumenacker 2004, S. 92).
- Das Verfahren eignet sich eher für „schwierige Fälle“ und nicht zum routinemäßigen Einsatz, da der zeitliche Aufwand als sehr hoch eingeordnet werden muss (vgl. Krumenacker 2004, S. 94).
- Anwendung im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe (ASD/RSD)
- Die Anwendung der Sozialpädagogischen Diagnose nach Mollenhauer und Uhlendorff bezieht sich eher auf Kinder und Jugendliche, die sich bereits in einem Kontext der Jugendhilfe befinden.
- In der Kinder- und Jugendhilfe obliegt es den Fachkräften des ASD/RSD des zuständigen Jugendamtes einzuschätzen, ob ein Anspruch auf eine öffentliche Unterstützung im Rahmen des SGB VIII besteht und ob ggf. das Kindeswohl gefährdet ist.
- Die Fachkräfte des ASD/RSD geben somit in diesen beiden Bereichen Einschätzungen ab, welche Eindeutig eine Sozialpädagogische Diagnostik darstellt.
- Müller sieht die Hilfeplanung an sich noch nicht als Diagnostik an, sondern als „Verhandlungsverfahren, in welchem die Leistungen der Hilfe ausgehandelt werden“ (Müller 2004, S. 70), aber die „Erarbeitung eines fachlich vertretbaren Standpunktes“ mit dem die Fachkraft des ASD/RSD in diese Verhandlung geht bezeichnet Müller hierbei als Diagnose (Müller 2004, S. 70).
- Noch gewichtiger erscheinen die Auswirkungen der Sozialpädagogischen Diagnose im Bereich des Kinderschutzes. Hierzu soll § 8a Abs. 2 SGB VIII angeführt werden.
- Als standardisiertes Instrument zur Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung wird zum Beispiel in den Berliner RSDs der sogenannte „1. Check – Bogen“ verwendet.
- Müller geht in der Beschreibung der diagnostischen Tätigkeit der Fachkräfte des ASD/RSD noch weiter und ergänzt, dass „der ASD nicht nur zum Verständnis der Probleme seiner Klienten fähig sein muss und in der Lage, ein passendes Angebot dafür zu entwickeln“, er muss weiterhin „diagnostische Kompetenzen entwickeln, das eigene Arbeitsfeld zu strukturieren, Prioritäten zu setzen, Netzwerke aufdecken, die Aufgaben abnehmen können etc.“ (Müller 2004, S. 64).
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text befasst sich mit der Sozialen Diagnostik im Kontext der Sozialen Arbeit. Ziel ist es, die Bedeutung und Anwendung der Sozialen Diagnostik zu beleuchten und anhand eines konkreten Modells nach Mollenhauer und Uhlendorff ein praxisnahes Verfahren zu beschreiben. Darüber hinaus wird die Rolle der Sozialen Diagnostik im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe (ASD/RSD) erörtert und ihre Bedeutung für die Einschätzung von Kindeswohlgefährdung hervorgehoben.
- Die Relevanz und Anwendung der Sozialen Diagnostik in verschiedenen Bereichen der Sozialen Arbeit
- Die Diskussion um die Entwicklung eigener Diagnoseverfahren als Bestandteil der Professionalisierungsdebatte in der Sozialen Arbeit
- Das Modell der sozialpädagogisch-hermeneutischen Diagnose nach Mollenhauer und Uhlendorff als praxisnahes Verfahren
- Die Anwendung der Sozialen Diagnostik im ASD/RSD im Kontext des SGB VIII und die Bedeutung für die Einschätzung von Kindeswohlgefährdung
- Die Herausforderungen und Kritikpunkte im Umgang mit der Sozialen Diagnostik in der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Was ist Soziale Diagnostik
Dieser Abschnitt erläutert die Definition und Anwendung der Sozialen Diagnostik in der Sozialen Arbeit. Es wird betont, dass jeder fachlichen Leistungserbringung eine Diagnostik zugrunde liegt, die Beobachtungen, Analysen und Bewertungen beinhaltet. Der Abschnitt verdeutlicht die Bedeutung der Sozialen Diagnostik für die Einschätzung von Fällen, insbesondere im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe.
Verhältnis der Sozialen Arbeit zur Diagnostik
Dieser Abschnitt beleuchtet das ambivalente Verhältnis der Sozialen Arbeit zum Begriff der Diagnose. Die Diskussion um ein eigenes Diagnoseverfahren wird als Teil der Professionalisierungsdebatte dargestellt. Es werden kritische Punkte hinsichtlich der Dominanz fremder Beurteilungsinstanzen und der Notwendigkeit einer methodischen Grundlage für die Expertise von Sozialarbeitern/Sozialpädagogen angesprochen.
Modell nach Mollenhauer und Uhlendorff
Dieser Abschnitt beschreibt das sozialpädagogisch-hermeneutische Diagnoseprozess nach Mollenhauer und Uhlendorff. Es wird betont, dass das Verfahren auf Fachteams ausgerichtet ist und eher für „schwierige Fälle“ geeignet ist. Die Grundlage des Verfahrens ist ein halbstrukturiertes Interview mit dem Klienten, welches „Lebensthemen“ aufdeckt, um die Perspektive des Klienten zu verstehen und neue Ansatzpunkte für die Fallarbeit zu finden.
Anwendung im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe (ASD/RSD)
Dieser Abschnitt zeigt die Anwendung der Sozialpädagogischen Diagnose im Kontext des ASD/RSD, insbesondere im Hinblick auf die Einschätzung von Kindeswohlgefährdung. Es wird betont, dass die Einschätzung des ASD/RSD weitreichende Folgen hat und daher auf einer strukturierten Grundlage mit festgelegten Kriterien basieren sollte. Die Bedeutung des Vier-Augen-Prinzips und die Notwendigkeit der Einbeziehung der betroffenen Personen in die Einschätzung werden hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Soziale Diagnostik, Sozialpädagogische Diagnose, Professionalisierung, Diagnostikverfahren, Mollenhauer und Uhlendorff, Kinder- und Jugendhilfe, ASD/RSD, Kindeswohlgefährdung, Hilfen zur Erziehung, SGB VIII, Fallverstehen, Lebensthemen, Selbstdeutungsmuster, Fallarbeit, Fallteam, Vier-Augen-Prinzip, Gütekriterien, Reliabilität, Validität, Objektivität, Transparenz.
- Quote paper
- B.A. David Deter (Author), 2015, Soziale Diagnostik in der Kinder-und Jugendhilfe. Modelle und Anwendung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/322589