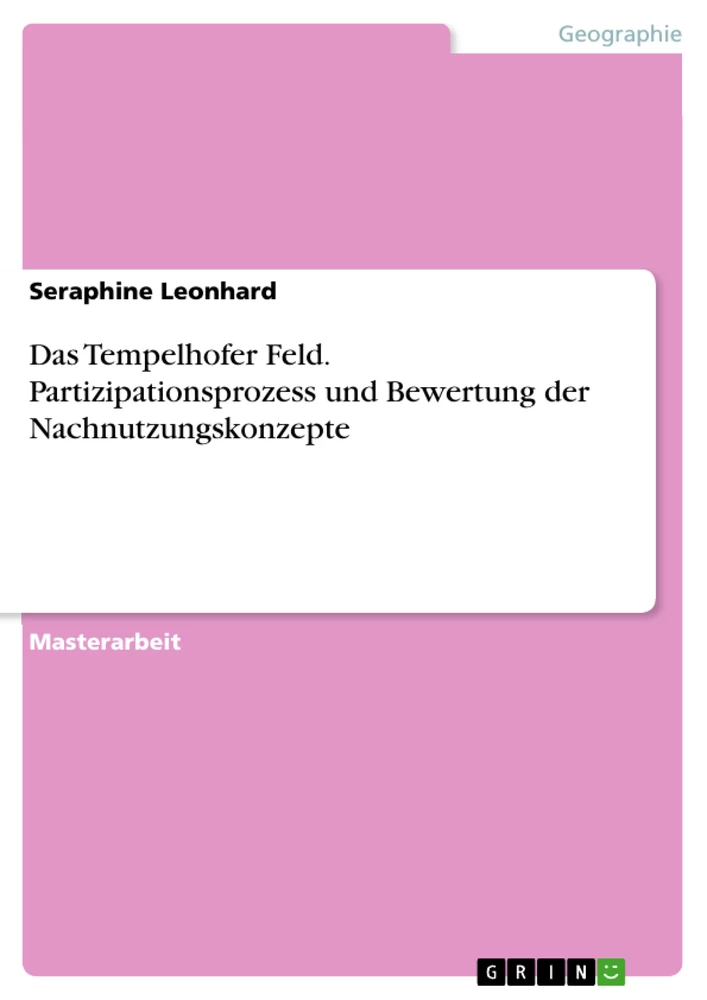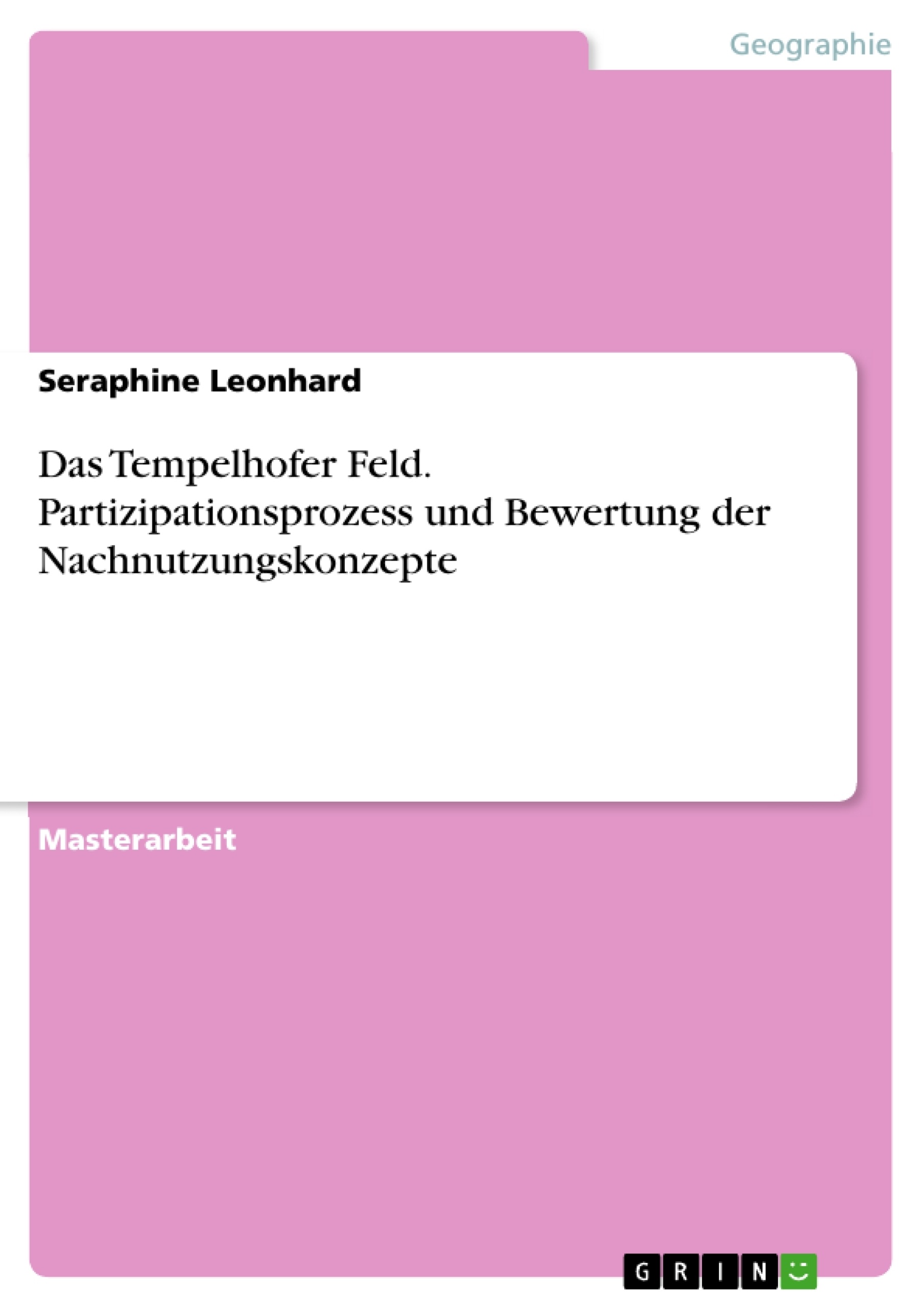Das Tempelhofer Feld: Ein Ort zum Entspannen, Sport treiben, zum Erleben und Staunen. Vielfältige Pionierprojekte, international angesehene Großveranstaltungen und ein breit gefächertes Angebot an Freizeitaktivitäten prägen heute das Areal, das zwischen den Bezirken Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg und Schöneberg-Tempelhof gelegen ist. Mit einer Größe von insgesamt 386 ha erzeugt der ehemalige Flughafen einen riesigen Freiraum inmitten der dicht bebauten Stadt Berlin. Auch historisch gesehen ist es ein Ort, der viele weithin unbekannte Geschichten zu erzählen hat. Vom Beginn der Luftfahrtgeschichte über Konzentrationslager bis hin zur endgültigen Schließung im Jahr 2008: Seit seiner Entstehung wird die Nutzung, Umnutzung und Nachnutzung des Feldes hitzig diskutiert und oftmals vertritt die Bevölkerung Berlins diesbezüglich eine andere Meinung als der Verwaltungsapparat der Stadt.
Die Schließung des Flughafens ist inzwischen sieben Jahre her und der Nachnutzungsprozess des Tempelhofer Feldes kann aus Sicht des Senats heute als gescheitert betrachtet werden. Viele Bürger stellten sich von Anfang an gegen die Pläne des Senats, sodass sich diese letztendlich zerschlugen. Aus heutiger Sicht darf man sich fragen, inwieweit die Berliner Bevölkerung im Beteiligungsprozess zum Tempelhofer Feld tatsächlich für ihre eigenen Interessen und damit für die beste Lösung im Sinne der Allgemeinheit eintrat oder sie lediglich von einer Art Trotzreaktion gegenüber dem Senat getrieben wurde. Ist es wirklich zum Besten dieser Stadt und seiner Bewohner, das Tempelhofer Feld unbebaut zu lassen, wie es mit dem ThF-Gesetz festgelegt wurde?
Die vorliegende Arbeit zeigt auf, wie der Disput „Wohnungen versus Freiraum“ seit jeher zwischen Politik und Bevölkerung stand und welche Bemühungen unternommen wurden, um die Bürger in den Entscheidungsprozess zur Nachnutzung des Tempelhofer Feldes miteinzubeziehen. Eine Untersuchung der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken der beiden Konzepte des Senats und der Initiative 100 % Tempelhofer Feld wird außerdem aufzeigen, welche Nachnutzung aus objektiver Sicht die bessere Lösung für Berlin bedeuten würde. Im Ergebnis soll erkennbar sein, welcher Aspekt tatsächlich den größeren Einfluss auf die Entscheidung zur Nachnutzung des Areals hatte: die Kontroverse zwischen Bürgern und Politikern in Verbindung mit den offerierten Partizipationsmöglichkeiten oder aber der reale Mehrwert der Konzepte.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Ausgangssituation
- 1.2 Problemstellung
- 1.3 Zielsetzung
- 2 Grundlagen Tempelhofer Feld
- 2.1 Projektbeteiligte
- 2.2 Derzeitige Nutzung
- 2.3 Ehemaliges Flughafengebäude und Umbaupläne
- 2.4 Veranstaltungen und Mieter im Gebäude
- 2.5 Zusammenfassung Grundlagen
- 3 Nutzungsgeschichte Tempelhofer Feld
- 3.1 Entstehungsgeschichte: 13. bis 19. Jahrhundert
- 3.2 Luftfahrt: 1870er bis 1920er Jahre
- 3.3 Wohnraummangel: 1910 bis 1930er Jahre
- 3.4 Zentralflughafen Berlin: 1920er bis 1930er Jahre
- 3.5 Nationalsozialismus: 1933 bis 1943
- 3.6 Kalter Krieg: 1945 bis 1980er Jahre
- 3.6.1 Tempelhof als „Tor zur Welt“
- 3.6.2 Tempelhof als potenzielle Grünanlage
- 3.7 Großflughafen Berlin-Brandenburg: 1985 bis 2008
- 3.8 Zusammenfassung Nutzungsgeschichte
- 4 Partizipationsprozess Tempelhofer Feld
- 4.1 Grundlagen Partizipation
- 4.2 Ideenwerkstatt Tempelhof 2007
- 4.3 Ideengewinnung Tempelhofer Freiheit 2007
- 4.4 Volksentscheid gegen die Schließung des Flughafens 2008
- 4.5 Städtebaulich-landschaftsplanerischer Ideenwettbewerb 2008
- 4.5.1 Rahmenbedingungen Ideenwettbewerb 2008
- 4.5.2 Ergebnisse Ideenwettbewerb 2008
- 4.6 Landschaftsplanerischer Ideenwettbewerb 2010
- 4.6.1 Rahmenbedingungen Ideenwettbewerb 2010
- 4.6.2 Wettbewerbsvorbereitende Bürgerbeteiligung 2009
- 4.6.3 Ergebnisse Ideenwettbewerb 2010
- 4.7 Zwischen- und Pioniernutzungen ab 2011
- 4.8 Planungszelle 2013
- 4.9 Volksentscheid über den Erhalt des Tempelhofer Feldes 2014
- 4.10 Zusammenfassung Partizipationsprozess
- 5 Nachnutzungskonzepte: Masterplan vs. Initiativenplan
- 5.1 Masterplan Senat
- 5.1.1 Entstehung und Weiterentwicklung Masterplan
- 5.1.2 Inhalte Masterplan
- 5.2 Konzept 100% Tempelhofer Feld
- 5.2.1 Initiative 100% Tempelhofer Feld
- 5.2.2 Inhalte Initiativenplan
- 5.3 Zusammenfassung Nachnutzungskonzepte
- 6 SWOT Analyse
- 7 SWOT Ergebnisse im Fokus urbaner Lebensqualität
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit analysiert den Partizipationsprozess zur Nachnutzung des Tempelhofer Feldes in Berlin und bewertet die konkurrierenden Konzepte des Senats und der Initiative „100% Tempelhofer Feld“. Die Arbeit untersucht die verschiedenen Phasen der Bürgerbeteiligung und deren Einfluss auf die Entwicklung der Nachnutzungspläne.
- Partizipationsprozesse bei der Nachnutzung des Tempelhofer Feldes
- Bewertung der verschiedenen Nachnutzungskonzepte
- Analyse der Stärken und Schwächen der konkurrierenden Pläne
- Auswirkungen auf die urbane Lebensqualität
- Zusammenhang zwischen Partizipation und Nachhaltigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Ausgangssituation des Tempelhofer Feldes nach der Schließung des Flughafens und die daraus resultierende Notwendigkeit einer Nachnutzungsplanung unter Einbezug der Bürgerbeteiligung. Die Problemstellung verdeutlicht die Herausforderungen bei der Abstimmung der unterschiedlichen Interessen und die Notwendigkeit einer umfassenden Bewertung der verschiedenen Konzepte. Die Zielsetzung der Arbeit wird definiert als die Analyse des Partizipationsprozesses und die Bewertung der Nachnutzungskonzepte.
2 Grundlagen Tempelhofer Feld: Dieses Kapitel liefert einen Überblick über das Tempelhofer Feld, seine aktuelle Nutzung, die Geschichte des ehemaligen Flughafengebäudes und die geplanten Umbauten. Es werden die verschiedenen Veranstaltungen und Mieter im Gebäude beschrieben und die komplexen Grundlagen für die Nachnutzung gelegt. Der Fokus liegt auf der Darstellung des Ist-Zustands als Ausgangspunkt für die weitere Analyse.
3 Nutzungsgeschichte Tempelhofer Feld: Die Nutzungsgeschichte des Tempelhofer Feldes wird von seinen Anfängen bis zur Schließung des Flughafens umfassend dargestellt. Von der landwirtschaftlichen Nutzung über die Entwicklung zum Flughafen bis hin zu seiner Rolle im Kalten Krieg werden die verschiedenen Epochen und ihre Auswirkungen auf die Fläche erläutert. Der Kapitelverlauf zeigt die kontinuierliche Veränderung und die unterschiedlichen Nutzungsansprüche an diesem bedeutenden Ort.
4 Partizipationsprozess Tempelhofer Feld: Das Kapitel detailliert den Partizipationsprozess der Nachnutzungsplanung. Es werden die verschiedenen Beteiligungsformate wie Ideenwerkstätten, Volksentscheide und Wettbewerbe analysiert und deren Einfluss auf die Entwicklung der Konzepte beschrieben. Der Fokus liegt auf der Chronologie und den unterschiedlichen Akteurskonstellationen.
5 Nachnutzungskonzepte: Masterplan vs. Initiativenplan: In diesem Kapitel werden die beiden konkurrierenden Nachnutzungskonzepte – der Masterplan des Senats und der Plan der Initiative „100% Tempelhofer Feld“ – gegenübergestellt. Die Entstehung, die Inhalte und die Unterschiede beider Konzepte werden detailliert dargestellt und analysiert. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der verschiedenen Zielsetzungen und Planungsansätze.
Schlüsselwörter
Tempelhofer Feld, Nachnutzung, Partizipation, Bürgerbeteiligung, Masterplan, Initiative 100% Tempelhofer Feld, urbane Lebensqualität, SWOT-Analyse, Nachhaltigkeit, Stadtplanung, Flughafen Tempelhof.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Nachnutzung des Tempelhofer Feldes
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Diese Masterarbeit analysiert den Partizipationsprozess zur Nachnutzung des Tempelhofer Feldes in Berlin und bewertet die konkurrierenden Konzepte des Senats und der Initiative „100% Tempelhofer Feld“. Die Arbeit untersucht die verschiedenen Phasen der Bürgerbeteiligung und deren Einfluss auf die Entwicklung der Nachnutzungspläne.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Partizipationsprozesse bei der Nachnutzung des Tempelhofer Feldes, die Bewertung der verschiedenen Nachnutzungskonzepte, die Analyse der Stärken und Schwächen der konkurrierenden Pläne, die Auswirkungen auf die urbane Lebensqualität und den Zusammenhang zwischen Partizipation und Nachhaltigkeit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Einleitung, 2. Grundlagen Tempelhofer Feld, 3. Nutzungsgeschichte Tempelhofer Feld, 4. Partizipationsprozess Tempelhofer Feld, 5. Nachnutzungskonzepte: Masterplan vs. Initiativenplan, 6. SWOT Analyse und 7. SWOT Ergebnisse im Fokus urbaner Lebensqualität. Jedes Kapitel bietet eine detaillierte Analyse des jeweiligen Themas.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Einleitung?
Die Einleitung beschreibt die Ausgangssituation des Tempelhofer Feldes nach der Flughafenschließung, die Herausforderungen bei der Interessensabwägung und die Notwendigkeit einer umfassenden Bewertung der Nachnutzungskonzepte. Die Zielsetzung der Arbeit ist die Analyse des Partizipationsprozesses und die Bewertung der Nachnutzungskonzepte.
Was wird im Kapitel "Grundlagen Tempelhofer Feld" behandelt?
Dieses Kapitel bietet einen Überblick über das Tempelhofer Feld, seine aktuelle Nutzung, die Geschichte des ehemaligen Flughafengebäudes, geplante Umbauten, Veranstaltungen und Mieter. Es legt die komplexen Grundlagen für die Nachnutzung dar und fokussiert den Ist-Zustand.
Worauf konzentriert sich das Kapitel zur Nutzungsgeschichte?
Das Kapitel zur Nutzungsgeschichte beschreibt umfassend die Entwicklung des Tempelhofer Feldes von seinen Anfängen bis zur Flughafenschließung. Es beleuchtet die landwirtschaftliche Nutzung, die Entwicklung zum Flughafen, seine Rolle im Kalten Krieg und zeigt die kontinuierliche Veränderung und unterschiedlichen Nutzungsansprüche.
Wie wird der Partizipationsprozess detailliert dargestellt?
Das Kapitel zum Partizipationsprozess analysiert detailliert verschiedene Beteiligungsformate wie Ideenwerkstätten, Volksentscheide und Wettbewerbe und deren Einfluss auf die Entwicklung der Konzepte. Die Chronologie und die unterschiedlichen Akteurskonstellationen stehen im Fokus.
Wie werden die Nachnutzungskonzepte verglichen?
Das Kapitel zu den Nachnutzungskonzepten vergleicht den Masterplan des Senats und den Plan der Initiative „100% Tempelhofer Feld“. Es beschreibt Entstehung, Inhalte und Unterschiede beider Konzepte, wobei der Vergleich der Zielsetzungen und Planungsansätze im Mittelpunkt steht.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Tempelhofer Feld, Nachnutzung, Partizipation, Bürgerbeteiligung, Masterplan, Initiative 100% Tempelhofer Feld, urbane Lebensqualität, SWOT-Analyse, Nachhaltigkeit, Stadtplanung, Flughafen Tempelhof.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Forschungsmethode, die auf der Analyse von Dokumenten, Berichten und anderen relevanten Quellen basiert. Eine SWOT-Analyse wird zur Bewertung der Nachnutzungskonzepte eingesetzt.
- Quote paper
- Seraphine Leonhard (Author), 2016, Das Tempelhofer Feld. Partizipationsprozess und Bewertung der Nachnutzungskonzepte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/322372