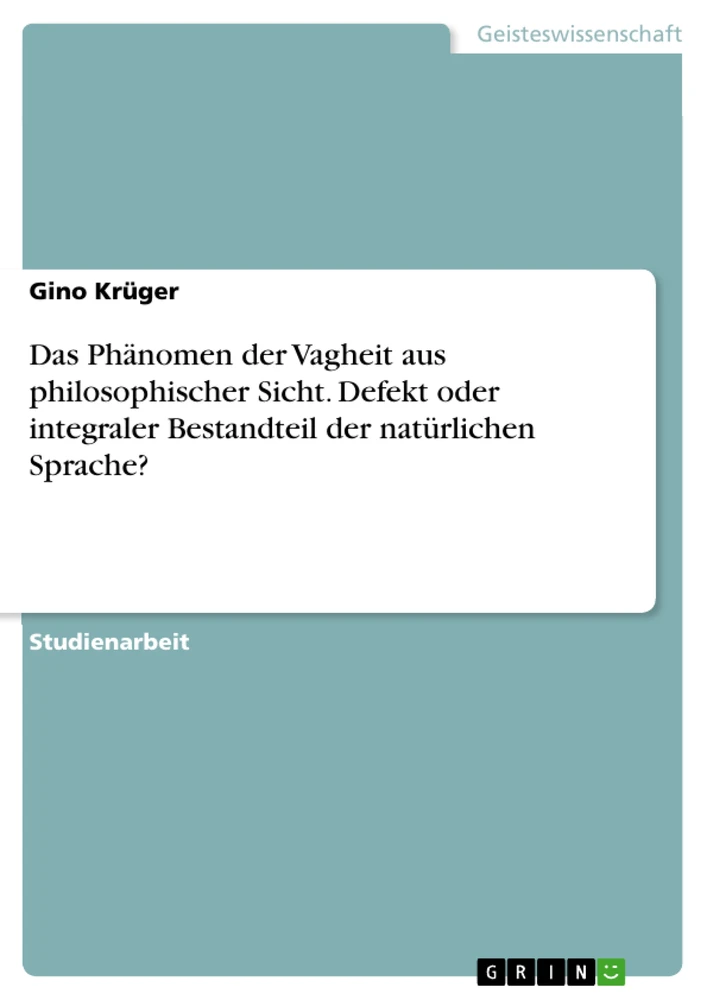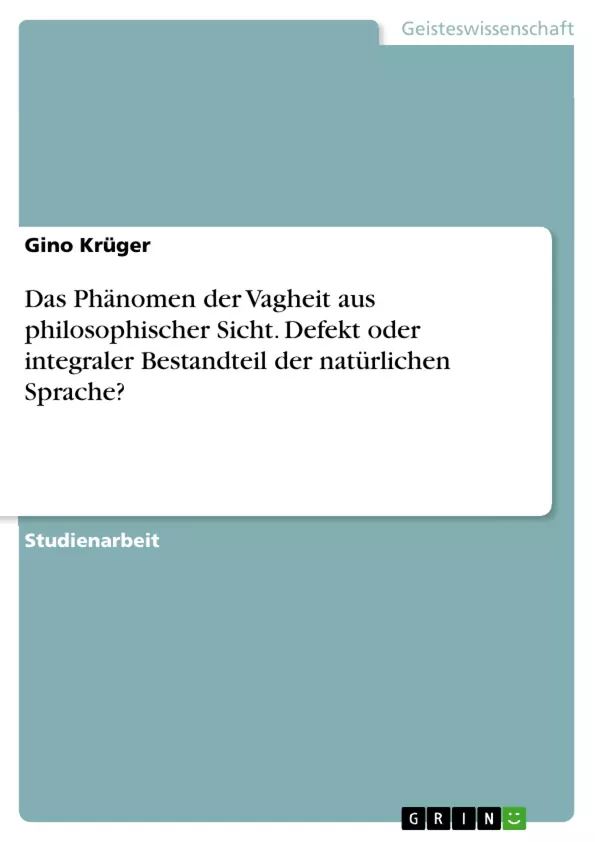Der Begriff der Vagheit sowie auch der dazugehörige Prädikator ‚vage‘ sind gängige Elemente unserer Alltagssprache und finden in einer Vielzahl von unterschiedlichen Kontexten Verwendung, um auf verschiedene Unbestimmtheitsfaktoren Bezug zu nehmen. Doch im Kontext des sprachphilosophischen Diskurses wird unter dem Vagheitsbegriff eine noch immer andauernde Debatte geführt, welche sich explizit mit einem spezifischen Unbestimmtheitsphänomen und dessen Implikationen befasst. Obwohl diese Debatte eindeutig im Raum der theoretischen Philosophie lokalisiert ist, sind ihre Einsichten nichtsdestotrotz auch von hoher Relevanz für gesellschaftliche Praktiken und Institutionen. So kann z.B. der anhaltende Deutungskonflikt, welcher im Rahmen des ‚Abtreibungsdiskurses‘ geführt wird und der im Kern um die Frage oszilliert: Wann ist ein befruchteter Zellhaufen ein Mensch? als eine Manifestation der Vagheitsproblematik in einer konkreten gesellschaftlichen Praxisform angesehen werden. Doch ungeachtet der unterschiedlichen Formen, welche Vagheitsphänomene in der gesellschaftlichen Praxis annehmen und auch ungeachtet des Faktums, dass sich in der philosophischen Debatte keine einheitliche Definition auffinden lässt, scheint dennoch die Mehrzahl der Autoren, die sich mit dem Phänomen der Vagheit philosophisch auseinandersetzen, davon auszugehen, dass es sich hierbei um eine Art Defekt oder Mangel unserer natürlichen Sprache handelt, welcher sich u.a. in formalsprachlichen Paradoxien manifestiert und irgendwie behoben oder zumindest kompensiert werden muss, um die Funktionsfähigkeit unserer logischen Kalküle weiterhin gewährleisten zu können.
An diesem Punkt wird die vorliegende Ausarbeitung anknüpfen, um die folgende Hypothese zu untersuchen: Vagheit ist kein Defekt, sondern ein integraler Bestandteil der natürlichen Sprache. Zu diesem Zweck wird sich der Hauptteil der Arbeit intensiv mit der Frage nach der ‚Natur der Vagheit‘ befassen, was anders gesprochen bedeutet, dass differenziert untersucht wird, um was für ein Phänomen es sich bei der Vagheit eigentlich handelt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Konstitutivprämissen einer Heuristik
- 2. Unscharfe Begriffe
- 3. Sorites-Paradoxien
- 4. Objektbereich(e) der Vagheitsphänomene
- 5. Bestimmung und Differenzierung von Vagheitsphänomenen
- 6. Fazit – der ‚Nutzen‘ der Vagheit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Ausarbeitung untersucht die Hypothese, dass Vagheit kein Defekt, sondern ein integraler Bestandteil der natürlichen Sprache ist. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Analyse der ‚Natur der Vagheit‘ und ihrer Implikationen für kognitive und soziale Systeme.
- Einführung und Erläuterung systemtheoretischer Prämissen als Grundlage einer erkenntnisversprechenden Heuristik
- Untersuchung der ‚Extensionsunschärfe‘ unscharfer Begriffe anhand des Problems der Kategorienbildung und Verwendung
- Analyse von Sorites-Paradoxien und deren Auswirkungen auf klassische Logikkalküle
- Diskussion des Objektbereichs von Vagheitsphänomenen und deren ontologischer Natur
- Systematische Unterscheidung von Vagheitsphänomenen von anderen Unbestimmtheitsphänomenen
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in das Thema Vagheit ein, präsentiert die Arbeitshypothese und skizziert die Gliederung der Arbeit.
- Kapitel 1 erläutert grundlegende Prämissen der allgemeinen Systemtheorie und zeigt deren Relevanz für die Untersuchung von Vagheitsphänomenen auf.
- Kapitel 2 beleuchtet das Problem der ‚Extensionsunschärfe‘ unscharfer Begriffe und arbeitet deren Implikationen für die Kategorieverwendung heraus.
- Kapitel 3 analysiert klassische Logikkalküle im Kontext von Sorites-Paradoxien und zeigt die Grenzen klassischer Logik in Bezug auf Vagheitsphänomene auf.
- Kapitel 4 untersucht den Objektbereich von Vagheitsphänomenen und stellt die verschiedenen Perspektiven auf dessen Bestimmung dar.
- Kapitel 5 verdichtet die Erkenntnisse zu einem Schema der spezifischen Charakteristika von Vagheitsphänomenen und differenziert sie von anderen Unbestimmtheitsphänomenen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Vagheit und seinen Implikationen für die natürliche Sprache, kognitive Prozesse, soziale Systeme und klassische Logikkalküle. Zu den wichtigsten Schlüsselbegriffen zählen: Vagheit, Unscharfe Begriffe, Sorites-Paradoxien, Extensionsunschärfe, Toleranzprinzip, Kategorienbildung, Systemtheorie, operative Geschlossenheit, Komplexität, Umwelt, symbolische Generalisierung, Mehrwertige Logik, Supervaluationismus, Kontextualismus, ontologische Natur, Grenzziehung, Kontrastklassenabhängigkeit, kommunikative Ökonomie, Flexibilität, Effizienz.
- Quote paper
- Gino Krüger (Author), 2016, Das Phänomen der Vagheit aus philosophischer Sicht. Defekt oder integraler Bestandteil der natürlichen Sprache?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/322347