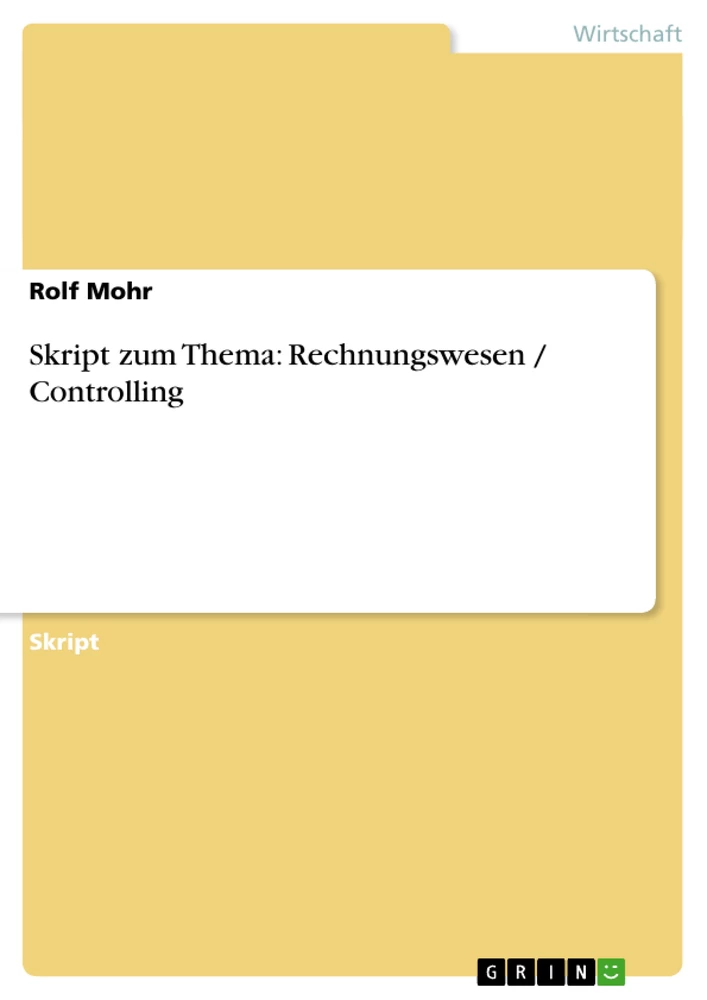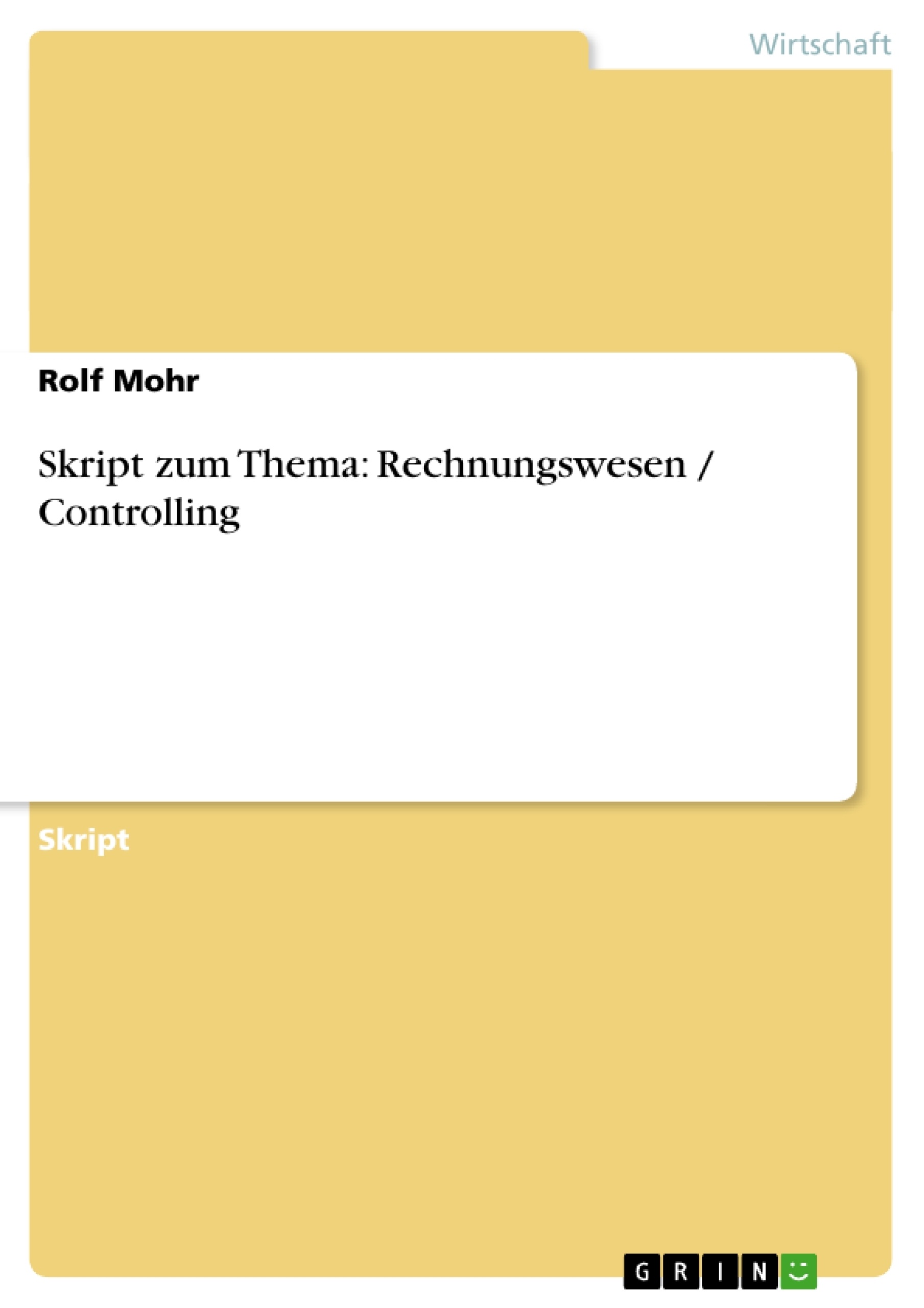Damit Sie die Finanzen Ihres Unternehmens im Griff haben und jederzeit über die wirtschaftlichen Ertragsaussichten sowie die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage informiert sind, müssen Sie sich mit den kaufmännischen Aufgaben und Pflichten des Rechnungswesens vertraut machen. Das Führen von Büchern und Aufzeichnungen - heute üblicherweise unter Verwendung moderner EDV-Techniken - ist Voraussetzung für die unternehmerische Erfolgskontrolle.
Als Kaufmann sind sie gemäß § 242 HGB zur Erstellung einer Jahresbilanz sowie einer Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 242 II HGB verpflichtet.
Eine leistungsfähige und aussagekräftige Buchhaltung gewährleistet die ständige Informationsmöglichkeit über die aktuelle Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.
Auch Gesellschafter, Banken und die Finanzbehörde wollen über die Unternehmensentwicklung informiert werden.
Zum Rechnungswesen eines Unternehmens gehören:
Buchführung
Kostenrechnung
Bestandteile
Zum betrieblichen Rechnungswesen werden alle Verfahren gezählt, die die im Betrieb auftretenden Geld- und Leistungsströme erfassen und überwachen. Es erfasst, ordnet und bewertet systematisch alle Wert- und Mengenbewegungen im Unternehmen. Mit Hilfe des Rechnungswesens können Sie die
Bestände,
Vermögens- und Kapitalveränderungen,
das Unternehmensergebnis,
Kosten und Leistungen,
ermitteln und somit den gesetzlichen Bestimmungen (Handelsrecht, Steuergesetzgebung) nachkommen.
Funktionen des Rechnungswesens
Die Buchführung ist u.a. die Grundlage für die Bilanzierung, in der Kostenrechnung werden so wichtige Fragen gestellt wie:
Zu welchem Preis muss das Produkt oder die Dienstleistung überhaupt verkauft werden, damit der Betrieb - zumindest - kostendeckend arbeitet?
Wie könnten Fix- und Gemeinkosten verringert werden?
Wo im Unternehmen entstehen die wesentlichen Kosten?
Welche Produkte oder Dienstleistungen tragen zur Deckung der Fixkosten bei?
Welche Aufträge sollten angenommen werden?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Vorwort.
- 2. Rechtsformen
- 2.1. Einteilung
- 2.2. Wahl der Rechtsform
- 2.3. Einzelunternehmung.
- 2.4. Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR).
- 2.5. OHG (Offene Handelsgesellschaft).
- 2.6. Stille Gesellschaft....
- 2.7. KG (Kommanditgesellschaft)
- 2.8. KG auf Aktien..
- 2.9. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
- 2.10. GmbH & Co KG...
- 2.11. Freiberufler......
- 2.12. Vereine, Genossenschaften, Stiftungen.
- 2.13. Aktiengesellschaft -Kapitalgesellschaft-.
- 2.14. Die „kleine AG“.
- 2.15. Pro&Contras auf einen Blick
- 3. Finanzbuchhaltung -gesetzlich extern-
- 3.1. Einleitung.
- 3.2. Inventar/Inventur.
- 3.3. Eröffnungsbilanz.
- 3.4. Kontenschema (Doppelte Buchführung)
- 3.5. Bestandskonten
- 3.6. Ablaufplan beim Buchen von Geschäftsfällen.
- 3.7. Erfolgskonten
- 3.8. Aufwendungen und Erträge
- 3.9. Erfolgswirksame und erfolgsunwirksame Geschäftsvorfälle.
- 3.10. Gewinn und Verlust Rechnung
- 3.11. G&V-Rechung mit fertigen und unfertigen Erzeugnissen
- 3.12. Abschreibung der Anlagegüter...
- 3.13. Buchung der Umsatzsteuer..
- 4. Auswertung des Jahresabschlusses (Bilanz, G&V).
- 4.1. Erstellen einer Bilanzanalyse (Grafik) ..
- 4.2. Kennzahlen auf Grundlage der Bilanz
- 4.3. Analyse und Auswertung der G&V-Rechnung.
- 4.4. Umschlagskennzahlen (G&V-Basis).
- 4.5. Kapitalrentabilitätskennzahlen (G&V-Basis)
- 4.6. Cashflow-Analyse (G&V-Basis)....
- 4.7. Erfolgsstrukturanalyse (G&V-Basis)....
- 5. Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) -innerbetrieblich-
- 5.1. Grundlagen der KLR...
- 5.1.1. Übersichslandkarte des Rechnungswesens.
- 5.1.2. Begriffe und Definitionen der KLR..
- 5.1.3. Anwendung von Kostenrechnungssystemen.
- 5.1.4. Hauptzielsetzungen der KLR.
- 5.2. Praxisbeispiel als Vollkostenrechnung.
- 5.2.1. Ausgangssituation....
- 5.2.2. STEP 1: Abgrenzungsrechnung......
- 5.2.2.1. Vorläufiges Abfiltern nicht betrieblicher Aufwendungen/Erträge
- 5.2.2.2. Korrekturen durch kalkulatorische Kosten
- 5.2.2.3. Entgültiges Ergebnis der Ausfilterungen.
- 5.2.3. STEP 2: Kostenartenrechnung (KAR) ..
- 5.2.4. STEP 3: Kostenstellenrechnung
- 5.2.4.1. Betriebseinteilung in Kostenstellen- und Bereiche.
- 5.2.4.2. Erstellen des Betriebsabrechnungsbogens (BAB).
- 5.2.4.3. Berechung der Erzeugnisselbstkosten...
- 5.2.5. STEP 4: Kostenträgerrechung.
- 5.2.5.1. Kostenträgerstückrechung als Angebotskalkulation
- 6. Grundlagen des Controllings
- 6.1. Aufgaben des Controllers...
- 6.2. Stellung des Controllers in der Ablauforganisation .
- 6.3. Verbindung des Controllings zum Rechnungswesen..
- 7. Existenzgründung..
- 7.1. Einleitung
- 7.2. Glossar.
- 7.3. Rechtsgrundlagen.
- 7.4. Betriebsübernahme/ Franchising
- 7.5. Unternehmenszusammenschlüsse.
- 7.6. Steuern.....
- 7.7. Formular Wegweiser zur Steuererklärung
- 7.8. Praktisches Beispiel..
- 8. Finanzmathematik...
- 8.1. Zinsrechung
- 8.2. Zinseszins
- 8.3. Gemischte Verzinsung.
- 8.4. Unterjährliche Verzinsung.
- 8.5. Rentenrechnung...
- 9. Führung .....
- 9.1. Einleitung
- 9.2. Führungsstile.....
- 9.3. Kritik/Anerkennungsgespräch
- 9.4. Teamentwicklung ....
- Rechtsformen im Unternehmenskontext
- Grundlagen der Finanzbuchhaltung und Bilanzanalyse
- Kosten- und Leistungsrechnung als Instrument der innerbetrieblichen Steuerung
- Einführung in die Aufgaben und Funktionsweise des Controllings
- Praktische Aspekte der Existenzgründung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Text führt in die grundlegenden Prinzipien der Betriebswirtschaftslehre ein. Die Inhalte erstrecken sich von der Auswahl der Rechtsform über die Finanzbuchhaltung und Kennzahlenanalyse bis hin zur Kosten- und Leistungsrechnung sowie Grundlagen des Controllings. Darüber hinaus wird die Existenzgründung, die Finanzmathematik und Aspekte der Führung behandelt.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel liefert eine Einführung in die Betriebswirtschaftslehre und ihre Bedeutung für die Bereitstellung von Gütern zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse. Es werden grundlegende ökonomische Prinzipien und Einflussfaktoren auf betriebswirtschaftliche Ziele beleuchtet.
Kapitel 2 befasst sich mit verschiedenen Rechtsformen im Unternehmenskontext. Es werden die Eigenschaften und Vor- und Nachteile verschiedener Rechtsformen wie Einzelunternehmen, Gesellschaften des bürgerlichen Rechts (GbR), OHG, KG, GmbH, Aktiengesellschaften und weitere erläutert.
Kapitel 3 führt in die Finanzbuchhaltung ein. Die Bedeutung von Inventur und Eröffnungsbilanz wird dargestellt, sowie das Kontenschema der doppelten Buchführung. Es werden Bestandskonten, Erfolgskonten, Aufwendungen und Erträge sowie erfolgswirksame und erfolgsunwirksame Geschäftsvorfälle erklärt. Kapitel 3 behandelt auch die Gewinn- und Verlustrechnung (G&V) und die Buchung der Umsatzsteuer.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit der Auswertung des Jahresabschlusses, insbesondere Bilanz und G&V. Es werden Methoden zur Erstellung einer Bilanzanalyse, wichtige Kennzahlen auf Grundlage der Bilanz, die Analyse der G&V, Umschlagskennzahlen, Kapitalrentabilitätskennzahlen, Cashflow-Analyse und die Erfolgsstrukturanalyse behandelt.
Kapitel 5 beleuchtet die Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) als Instrument der innerbetrieblichen Steuerung. Es werden die Grundlagen der KLR, die Anwendung von Kostenrechnungssystemen und die Hauptzielsetzungen der KLR behandelt. Praxisbezogen wird ein Beispiel für die Vollkostenrechnung vorgestellt, wobei die Schritte der Abgrenzungsrechnung, Kostenartenrechnung, Kostenstellenrechnung und Kostenträgerrechnung erläutert werden.
Kapitel 6 widmet sich den Grundlagen des Controllings. Es werden die Aufgaben und die Stellung des Controllers in der Ablauforganisation eines Unternehmens sowie die Verbindung zum Rechnungswesen behandelt.
Kapitel 7 befasst sich mit der Existenzgründung. Es werden wichtige Themenbereiche wie Rechtsgrundlagen, Betriebsübernahme, Franchising, Unternehmenszusammenschlüsse, Steuern und Formularwegweiser zur Steuererklärung behandelt. Es wird auch ein praktisches Beispiel vorgestellt.
Kapitel 8 führt in die Finanzmathematik ein. Es werden Zinsrechung, Zinseszinsrechnung, gemischte Verzinsung, unterjährliche Verzinsung und Rentenrechnung behandelt.
Kapitel 9 behandelt Aspekte der Führung im Unternehmenskontext. Es werden verschiedene Führungsstile vorgestellt und die Bedeutung von Kritik- und Anerkennungsgesprächen sowie Teamentwicklung erläutert.
Schlüsselwörter
Die wesentlichen Schlüsselwörter und Themengebiete des Buches umfassen die Rechtsformen im Unternehmenskontext, Finanzbuchhaltung und Bilanzanalyse, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling, Existenzgründung, Finanzmathematik und Führung.
- Quote paper
- Rolf Mohr (Author), 2004, Skript zum Thema: Rechnungswesen / Controlling, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32219