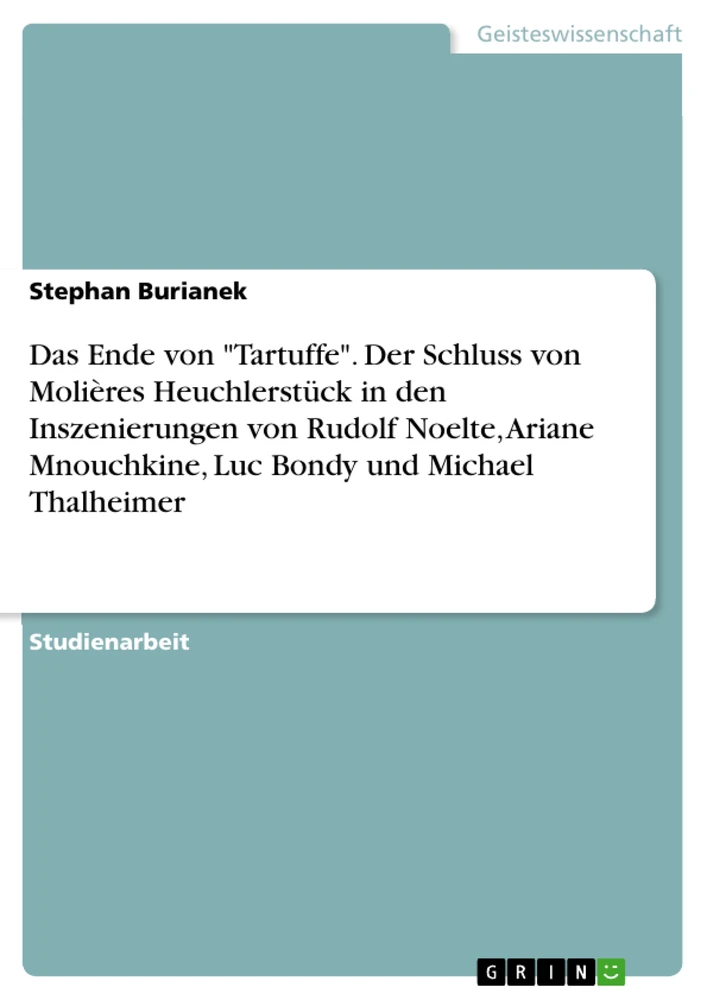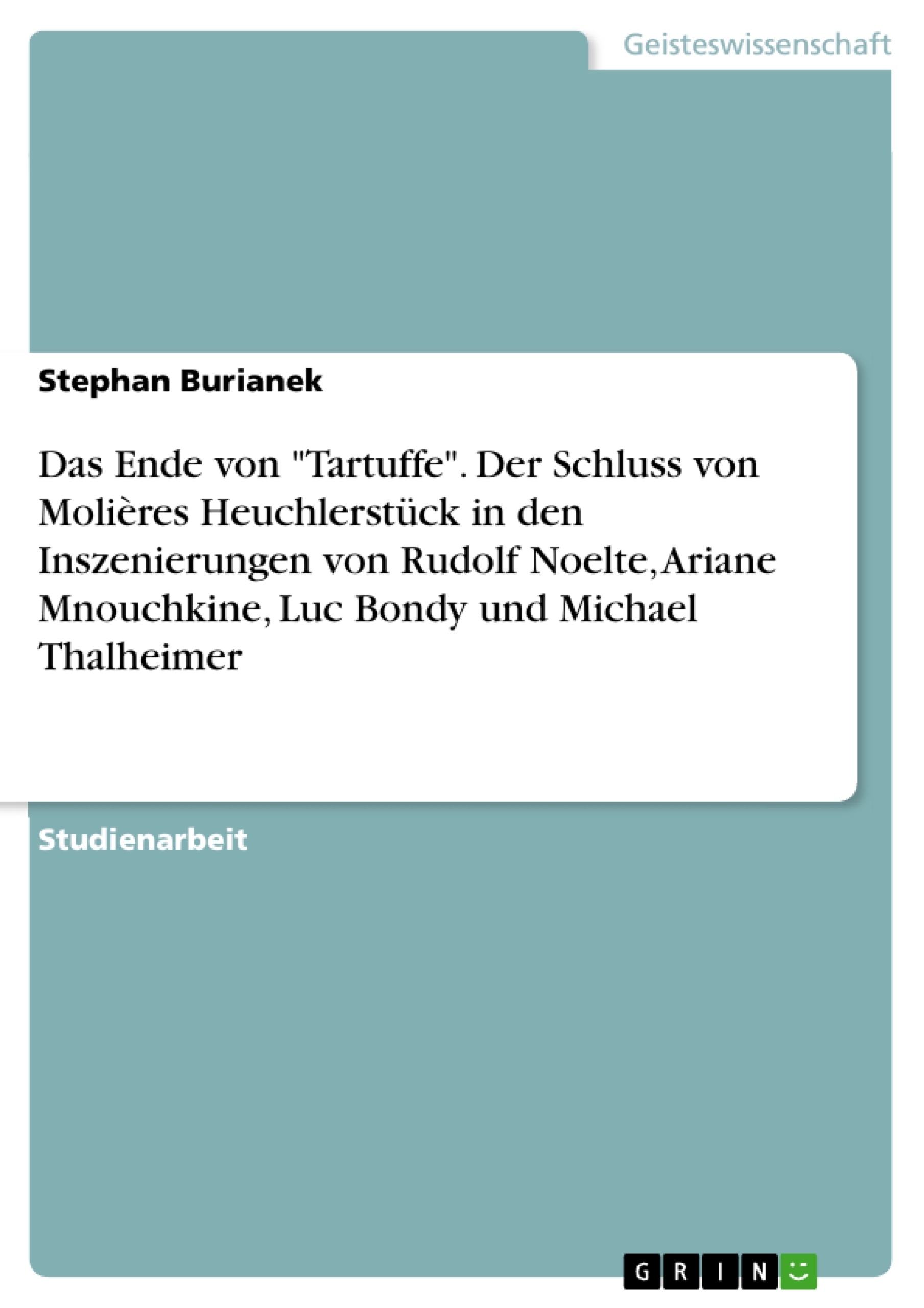Moliéres politische Komödie „Tartuffe“ zählt zu den weltweit am häufigsten gespielten Theaterstücken. Das ist wenig verwunderlich, ist doch der Typus des (religiösen) Heuchlers ein zeitloses Phänomen. Moliére schuf mit seiner Tartuffe-Figur zudem eine Vorlage für nachfolgende Generationen, man denke beispielsweise an Beaumarchais „L'Autre Tartuffe ou la Mère coupable“ („Ein zweiter Tartuffe oder Die Schuld der Mutter“).
Regisseure stehen bei der Inszenierung dieses Werks in der Regel vor einer ganz bestimmten Herausforderung: Der abrupte Schluss und seine „Deus ex machina“-Wendung wirken aus heutiger Sicht allzu konstruiert, vielleicht sogar unbeholfen. Molières Motivation, sich mit diesem Ende bei König Ludwig XIV. für dessen Schutz gegen heftige Angriffe zu bedanken und ihn zu einer allgemeinen Freigabe zu bewegen, erscheint uns freilich nachvollziehbar. Köhler verteidigt den Schluss in diesem Zusammenhang gar das „realste Element des ganzen Stückes.“ Trotzdem greift das banale Stückende für ein heutiges Publikum ins Leere und reizt zeitgenössische Theaterschaffende folglich zum Widerspruch.
Der Übersetzer Wolfgang Wiens thematisierte den Schluss – in Bezugnahme auf eine Inszenierung von Jürgen Flimm am Thalia Theater (1996) – in einem Gespräch für eine Diplomarbeit wie folgt:
"Mit dem Schluss hadern ja alle. Alle denken sich irgendwelche Schlüsse aus, der Sonnenkönig tritt auf, Tartuffe wird tot geprügelt, ich weiß nicht, was für Geschichten, auf jeden Fall macht keiner ein Happy End, den klassischen Molière Schluss."
In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen: Wie gehen moderne Regisseure mit dem Ende um? Lässt sich bei deren Interpretationen bzw. Bearbeitungen des Schlusses etwas Verbindendes, ein roter Faden, erkennen? Wie „werkgetreu“ sind diese Lösungen? Diese Fragen sollen in dieser Arbeit thematisiert und möglichst treffend beantwortet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Ziel dieser Arbeit
- Methodik
- Die Tartuffe-Fassungen
- Rudolf Noelte (1979)
- Ariane Mnouchkine (1995)
- Luc Bondy (2013)
- Michael Thalheimer (2013)
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert verschiedene Inszenierungen von Molières „Tartuffe“ und befasst sich mit der Frage, wie moderne Regisseure mit dem Schluss des Stücks umgehen. Die Arbeit untersucht, ob sich bei den Interpretationen des Schlusses ein verbindender roter Faden erkennen lässt und inwieweit die Lösungen werkgetreu sind.
- Rezeptionsgeschichte von Molières „Tartuffe“
- Analyse des Stückschlusses in Bezug auf seine historische und politische Bedeutung
- Vergleichende Betrachtung verschiedener Inszenierungen des Stücks
- Kritik an der „Deus ex machina“ -Wendung des ursprünglichen Endes
- Bewertung der werkgetreuen Umsetzung der Inszenierungen
Zusammenfassung der Kapitel
-
Ziel dieser Arbeit
Der Text stellt die Relevanz des Stücks „Tartuffe“ im Kontext der Theatergeschichte dar und thematisiert die Problematik des Stückschlusses, der in der Regel als konstruiert und unbeholfen empfunden wird. Die Arbeit untersucht, wie moderne Regisseure diesen Aspekt des Stücks in ihren Inszenierungen behandeln.
-
Methodik
Die Arbeit konzentriert sich auf Inszenierungen, die im deutschsprachigen Raum in den letzten vier Jahrzehnten einen Einfluss auf die Rezeptionsgeschichte des Werks hatten. Es werden vier Regisseure – Rudolf Noelte, Ariane Mnouchkine, Luc Bondy und Michael Thalheimer – und ihre Inszenierungen näher beleuchtet.
-
Die Fassungen von „Tartuffe“
Der Abschnitt stellt die verschiedenen Fassungen von Molières „Tartuffe“ vor und geht auf die Entstehung der verschiedenen Versionen ein, wobei die politischen und gesellschaftlichen Faktoren, die zur Entstehung dieser Fassungen führten, beleuchtet werden. Es werden die Unterschiede der verschiedenen Versionen anhand des Inhalts und der Charakterentwicklung der Titelfigur beleuchtet.
-
Rudolf Noelte (1979)
In diesem Abschnitt wird die Inszenierung von Rudolf Noelte aus dem Jahr 1979 am Wiener Burgtheater besprochen. Es werden die Rezensionen der Premierenaufführung sowie spätere Rückgriffe auf die Inszenierung in der Rezeption analysiert.
Schlüsselwörter
Molière, Tartuffe, Inszenierung, Schluss, Rezeptionsgeschichte, Heuchelei, Deus ex machina, Regie, Theater, Kritik, Interpretation, Werkgetreue, Rudolf Noelte, Ariane Mnouchkine, Luc Bondy, Michael Thalheimer.
- Quote paper
- Mag. Stephan Burianek (Author), 2015, Das Ende von "Tartuffe". Der Schluss von Molières Heuchlerstück in den Inszenierungen von Rudolf Noelte, Ariane Mnouchkine, Luc Bondy und Michael Thalheimer, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/322045