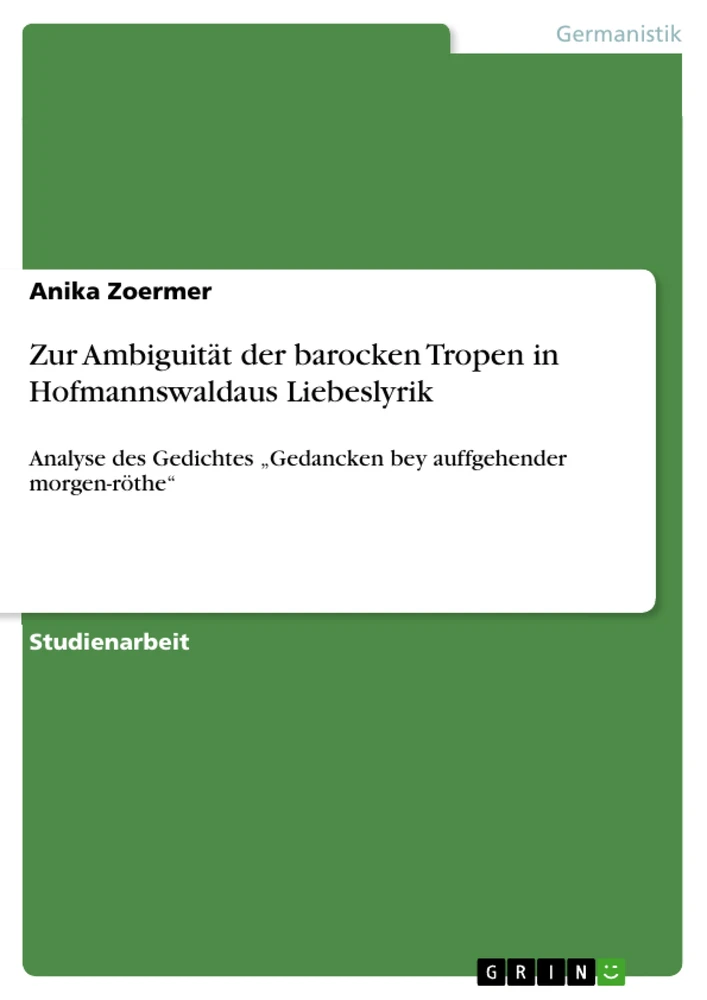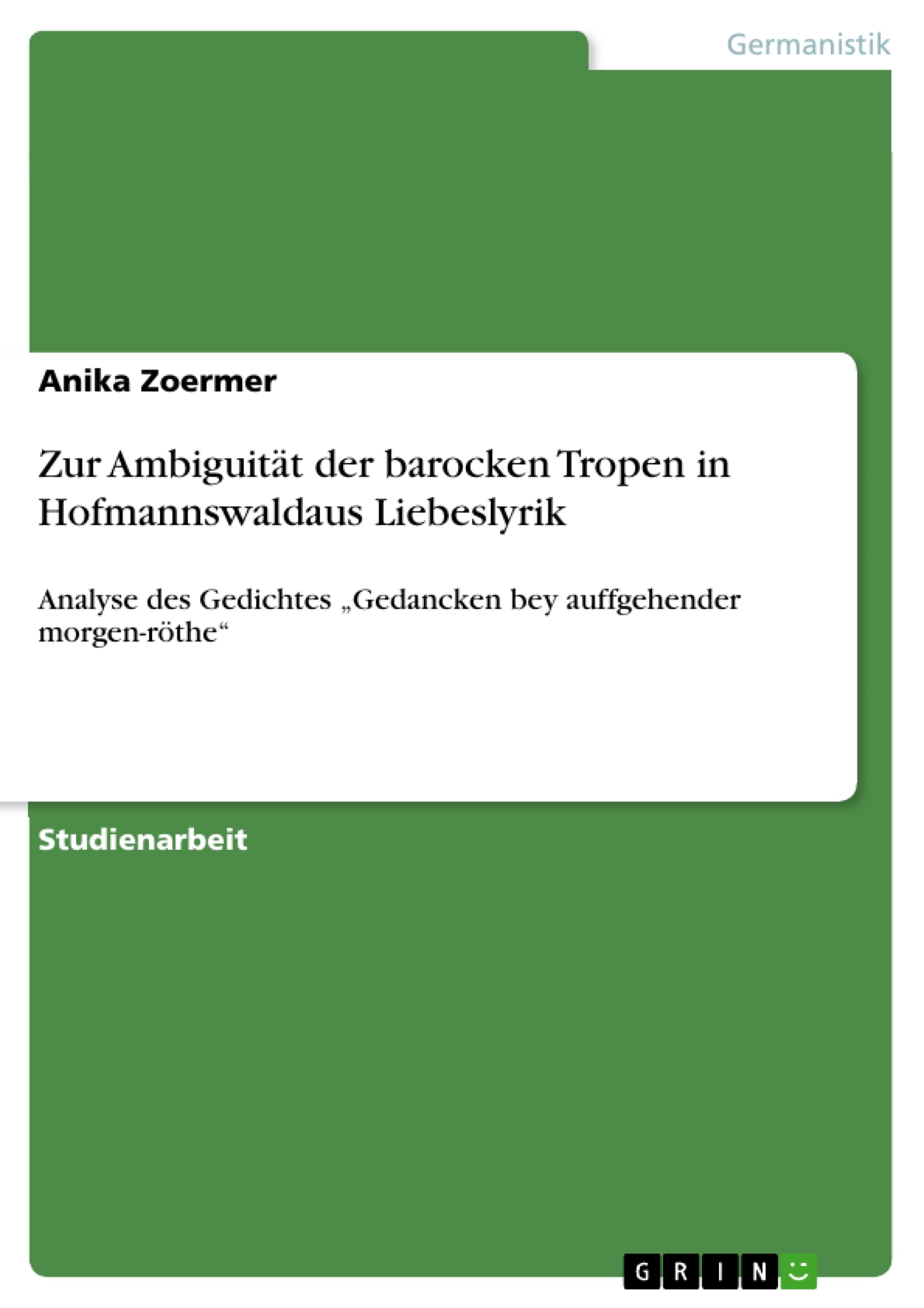Die Sprache der Barocklyrik als allegorisch-emblematische, welche auch in Deutschland von Petrarca und dem Manierismus geprägt war, birgt Anlass zur Untersuchung der daraus resultierenden Ambiguität. Diese ist Gegenstand der vorliegenden Arbeit und soll anhand des Gedichts „Gedancken bey auffgehender morgen-röthe“ von Christian Hofmann von Hofmannswaldau dargestellt und analysiert werden.
Hierzu wird zunächst in die Bildlichkeit der barocken Dichtung eingeführt, wobei die Metapher fokussiert wird. Ihre Erscheinung und Funktion wird vor dem Hintergrund der Epoche und in der Verwendung von Hofmannswaldau veranschaulicht. Über die aus der Verwendung der Tropen resultierende Ambiguität von Gedichtsanalysen wird übergeleitet zu Hofmannswaldau und seiner ausgewählten Ode.
An ihr soll der Pluralismus barocker Lyrik veranschaulicht werden, indem sie auf zwei verschiedene Interpretationsmöglichkeiten hin bearbeitet wird. Ziel dieser Arbeit ist es, exemplarisch zu zeigen, dass Metaphern in der barocken Lyrik auf vielfache Weise interpretiert werden können. Des Weiteren sollen Vermutungen darüber angestellt werden, weshalb sich besonders die Natur- und Jahreszeitenmetaphorik im bearbeiteten Gedicht für die Darstellung der Liebesbeziehung geeignet hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bildlichkeit in der Lyrik des Barock
- Metapher und Allegorie als stilistische Formen der Tropen in der barocken Lyrik
- Petrarkismus und Manierismus als Grundlage der Liebeslyrik von Hofmannswaldau
- Bildlichkeit in der Liebeslyrik Hofmannswaldaus
- Christian Hofmann von Hofmannswaldau
- Gedichtanalyse: „Gedancken bey auffgehender morgen-röthe“
- „Gedancken bey auffgehender morgen-röthe“ als Gedicht über die Natur
- „Gedancken bey auffgehender morgen-röthe“ als Gedicht über die Liebe
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ambiguität barocker Tropen in der Liebeslyrik Christian Hofmann von Hofmannswaldaus, anhand seines Gedichts „Gedancken bey auffgehender morgen-röthe“. Die Zielsetzung besteht darin, die doppelte Auslegung von Bildern in barocken Gedichten aufzuzeigen und die Bedeutung der Metaphorik im Kontext des Manierismus und Petrarkismus zu analysieren.
- Bildlichkeit in der barocken Lyrik und ihre stilistischen Formen (Metapher, Allegorie)
- Einfluss des Manierismus und Petrarkismus auf die Liebeslyrik Hofmannswaldaus
- Analyse der Natur- und Liebesmetaphorik in „Gedancken bey auffgehender morgen-röthe“
- Ambiguität und Doppeldeutigkeit barocker Metaphern
- Die Rolle der Naturmetaphorik im Verschleiern des eigentlichen Sinns des Gedichts
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Ambiguität barocker Metaphern ein und erläutert die Bedeutung von Metaphern in der Literatur und Alltagssprache. Sie beschreibt den Ansatz der Arbeit, die doppelte Auslegung von Bildern in Hofmannswaldaus Gedicht „Gedancken bey auffgehender morgen-röthe“ anhand einer detaillierten Analyse zu untersuchen, und skizziert den Aufbau der Arbeit: ein Theorieteil zur Bildlichkeit des Barock, gefolgt von einer Analyse des ausgewählten Gedichts.
Bildlichkeit in der Lyrik des Barock: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der deutschen Sprache und Literatur im Barock, den Einfluss von Sprachgesellschaften wie der „Fruchtbringenden Gesellschaft“, und die Rolle der Ornamentik und der „Demonstration der schöpferischen Möglichkeiten der deutschen Sprache“. Es wird die Bedeutung der Metapher im barocken Sprachideal hervorgehoben, der Einfluss des Manierismus und die Abgrenzung der Metapher von der Allegorie diskutiert. Der Fokus liegt auf der Funktion der Tropen als Redeschmuck und dem metaphorischen Sprechen als kennzeichnendes Merkmal barocker Lyrik. Die dekorative und scharfsinnige Metaphorik werden als Unterkategorien der barocken Metaphorik vorgestellt, wobei der Gebrauch von sinnlich-barocken Metaphern bei Hofmannswaldau besonders betont wird, insbesondere im Zusammenhang mit der Thematik der Liebe.
Christian Hofmann von Hofmannswaldau: (Kapitel fehlt im Ausgangstext, daher keine Zusammenfassung möglich)
Gedichtanalyse: „Gedancken bey auffgehender morgen-röthe“: (Kapitel fehlt im Ausgangstext, daher keine Zusammenfassung möglich)
Schlüsselwörter
Barocklyrik, Christian Hofmann von Hofmannswaldau, Metapher, Allegorie, Bildlichkeit, Manierismus, Petrarkismus, Liebeslyrik, Ambiguität, Doppeldeutigkeit, Naturmetaphorik, Gedichtanalyse, „Gedancken bey auffgehender morgen-röthe“.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Ambiguität barocker Tropen in der Liebeslyrik Christian Hofmann von Hofmannswaldaus
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Ambiguität barocker Tropen, insbesondere in der Liebeslyrik Christian Hofmann von Hofmannswaldaus. Der Fokus liegt auf der doppelten Auslegung von Bildern in barocken Gedichten und der Bedeutung der Metaphorik im Kontext von Manierismus und Petrarkismus. Das Gedicht „Gedancken bey auffgehender morgen-röthe“ dient als Fallbeispiel.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die doppelte Lesart von Bildern in barocken Gedichten aufzuzeigen und die Rolle der Metaphorik im Kontext des Manierismus und Petrarkismus zu analysieren. Es soll untersucht werden, wie Naturmetaphorik dazu beiträgt, den eigentlichen Sinn des Gedichts zu verschleiern.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Bildlichkeit in der barocken Lyrik und ihre stilistischen Formen (Metapher, Allegorie), den Einfluss von Manierismus und Petrarkismus auf Hofmannswaldaus Liebeslyrik, die Analyse der Natur- und Liebesmetaphorik in „Gedancken bey auffgehender morgen-röthe“, die Ambiguität und Doppeldeutigkeit barocker Metaphern und die Rolle der Naturmetaphorik im Verschleiern des eigentlichen Sinns des Gedichts.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zur Bildlichkeit in der Lyrik des Barock, ein Kapitel über Christian Hofmann von Hofmannswaldau (leider unvollständig im vorliegenden Auszug), eine Gedichtanalyse von „Gedancken bey auffgehender morgen-röthe“ (ebenfalls unvollständig) und einen Schluss. Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Ansatz der Arbeit. Das Kapitel zur Bildlichkeit im Barock beleuchtet die Entwicklung der deutschen Sprache und Literatur im Barock, den Einfluss von Sprachgesellschaften und die Bedeutung der Metapher im barocken Sprachideal. Die Kapitel zu Hofmannswaldau und der Gedichtanalyse fehlen leider im vorliegenden Auszug.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Barocklyrik, Christian Hofmann von Hofmannswaldau, Metapher, Allegorie, Bildlichkeit, Manierismus, Petrarkismus, Liebeslyrik, Ambiguität, Doppeldeutigkeit, Naturmetaphorik, Gedichtanalyse, „Gedancken bey auffgehender morgen-röthe“.
Wie ist der Aufbau der Arbeit?
Die Arbeit folgt einem Aufbau mit Theorieteil und anschliessender Gedichtanalyse. Zuerst wird die Bildlichkeit der Barocklyrik und der Kontext (Manierismus, Petrarkismus) erläutert, bevor das ausgewählte Gedicht von Hofmannswaldau detailliert analysiert wird.
- Quote paper
- Anika Zoermer (Author), 2014, Zur Ambiguität der barocken Tropen in Hofmannswaldaus Liebeslyrik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/321649