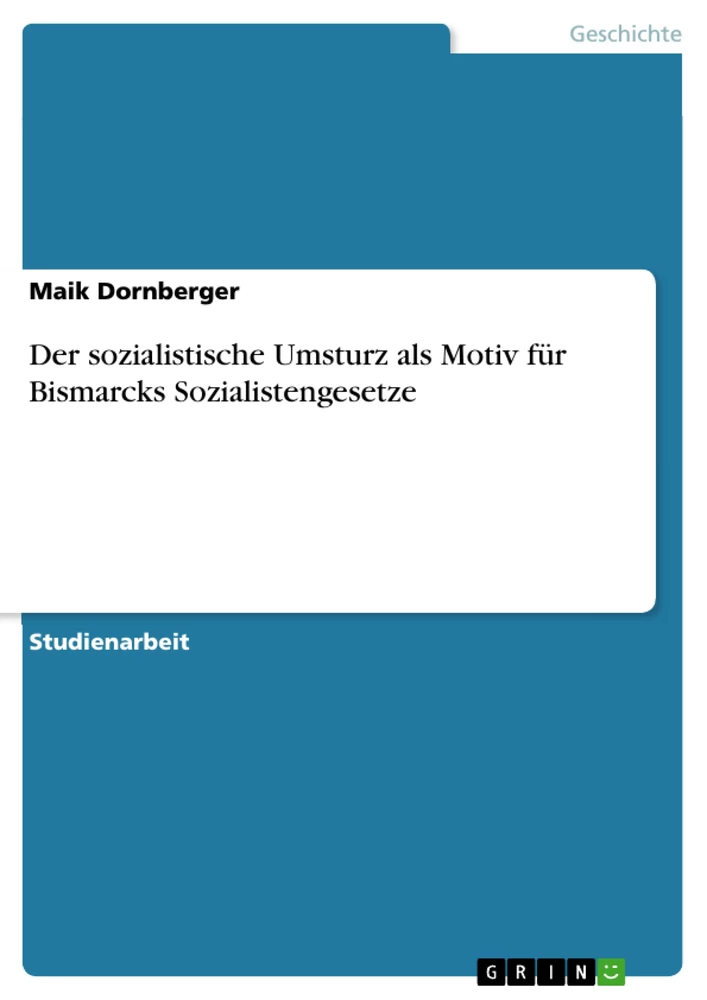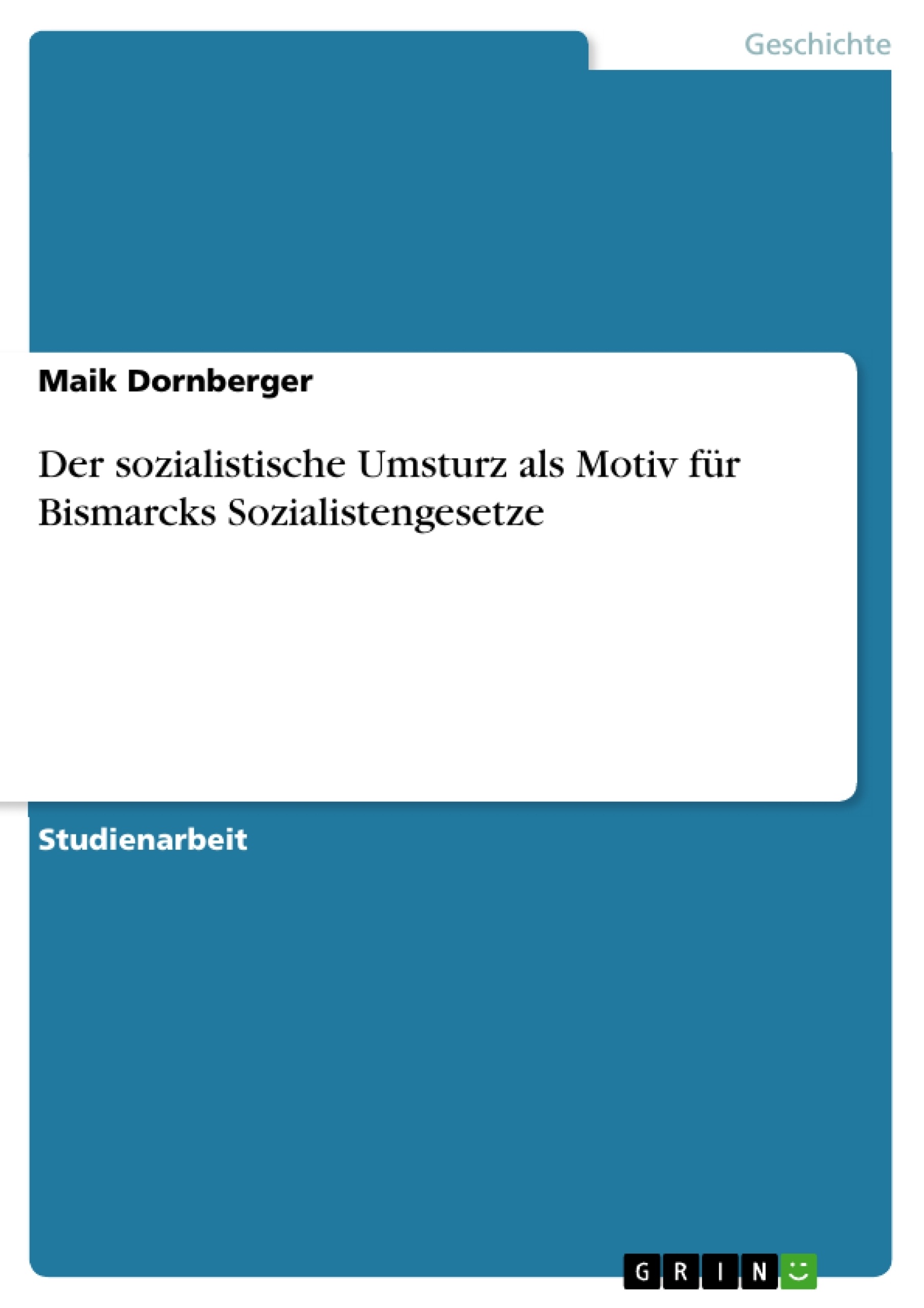In dieser Arbeit soll anhand der Forschung und mit Hilfe der Quellen aus dieser Zeit das den Gesetzen zugrundeliegende Umsturz-Motiv untersucht werden. Dies ist einerseits der Umsturzwillen der Sozialdemokratie und andererseits die Umsturz-Furcht Bismarcks.
Selten sind die von großen historischen Persönlichkeiten begangenen Taten, die dann zu historischen Tatsachen werden, monokausal zu deuten. Eine Vielzahl von Beweggründen bestimmt im Einzelfall das Vorgehen des Handelnden.
Schwierig gestaltet sich die Frage nach diesen persönlichen Motiven. Der Forschende muss sich auf interpretatorisches Glatteis begeben, da der ehemals Handelnde nicht mehr befragt werden kann. Er muss die Gründe für die Taten sozusagen „von hinten aufrollen“, heißt Rückschlüsse von diesen auf mögliche Motive ziehen. Dabei besteht die Gefahr, dass Handlungen, denen mehrere Motive vorausgegangen waren, monokausal gedeutet werden, weil sie einen historischen Prozess ausgelöst haben, der eine neue Richtung kennzeichnet, so als ob der „große Mann“ zu diesem Zeitpunkt schon gewusst hätte, was er mit seiner Tat verursacht bzw. verursachen kann. Die Gefahr ist die, dass der Forschende etwas hineinliest, was so nicht intendiert war bzw. nach damaligem Wissensstand nicht intendiert sein konnte, die Gefahr, dass er ein Motiv als das Tragende unterstellt.
So besteht auch bei Bismarcks 1878 erfolgter Durchsetzung der Sozialistengesetze gegen deren Umsturzbestrebungen die Gefahr, seine Motivation für die Verschärfung der Gesetzeslage gegenüber den Sozialdemokraten im Deutschen Reich als Mittel für Bismarcks neue politische Zwecke zu dieser Zeit zu sehen; eine Politik, die die Forschung als „konservative Wende“ bezeichnet. Eigentliches Ziel von Bismarcks Ausnahmegesetzen gegen die Sozialdemokratie wäre dann in erster Linie das der „negativen Integration“ gewesen. Die Gesetze hätten sich dann eingefügt in ein von langer Hand geplantes Vorgehen Bismarcks, um diese Wende zu ermöglichen, sozusagen als „Voraussetzung, Kernstück und Ausdruck einer reaktionären Kursänderung“ seiner damaligen Politik. Als wichtige mögliche Beweggründe für die „Tat des großen Mannes“ vergäße man dann aber solche wie sein persönliches Unverständnis bzw. seine Abneigung gegenüber der „rothen Race“ aus seiner monarchisch-aristokratischen Position heraus oder seine tatsächliche Angst vor einem bevorstehenden Umsturz der Massen.
Inhalt:
I. Einleitung: Bismarcks Motive
II. Hauptteil: Der sozialistische Umsturz als Motiv für die Sozialistengesetze
1. Die Sozialisten und der Umsturz
1.1. Das Umsturzpotential der Sozialisten
1.2. Die Umsturzabsicht der Sozialisten
1.2.1. Die Solidarität mit der Pariser Kommune
1.2.2. Revolutionärer Verbalismus
1.2.3. Reform oder Revolution?
1.2.4. Abgrenzung nach links
1.2.5. Kein Umsturz
2. Bismarck und der Umsturz
2.1. „das Frankfurter demokratische Treiben“
2.2. 80.000 Sozialdemokraten in Berlin
2.3. Furcht vor den Massen?
III. Fazit
IV. Quellen und Literatur
1. Einleitung: Bismarcks Motive
Selten sind die von großen historischen Persönlichkeiten begangenen Taten, die dann zu historischen Tatsachen werden, monokausal zu deuten. Eine Vielzahl von Beweggründen bestimmt im Einzelfall das Vorgehen des Handelnden. Schwierig gestaltet sich die Frage nach diesen persönlichen Motiven. Der Forschende muss sich auf interpretatorisches Glatteis begeben, da der ehemals Handelnde nicht mehr befragt werden kann. Er muss die Gründe für die Taten sozusagen „von hinten aufrollen“, heißt Rückschlüsse von diesen auf mögliche Motive ziehen. Dabei besteht die Gefahr, dass Handlungen, denen mehrere Motive vorausgegangen waren, monokausal gedeutet werden, weil sie einen historischen Prozess ausgelöst haben, der eine neue Richtung kennzeichnet, so als ob der „große Mann“ zu diesem Zeitpunkt schon gewusst hätte, was er mit seiner Tat verursacht bzw. verursachen kann. Die Gefahr ist die, dass der Forschende etwas hineinliest, was so nicht intendiert war bzw. nach damaligem Wissensstand nicht intendiert sein konnte, die Gefahr, dass er ein Motiv als das Tragende unterstellt.
So besteht auch bei Bismarcks 1878 erfolgter Durchsetzung der Sozialistengesetze gegen deren Umsturzbestrebungen die Gefahr, seine Motivation für die Verschärfung der Gesetzeslage gegenüber den Sozialdemokraten im Deutschen Reich als Mittel für Bismarcks neue politische Zwecke zu dieser Zeit zu sehen; eine Politik, die die Forschung als „konservative Wende“ bezeichnet. Eigentliches Ziel von Bismarcks Ausnahmegesetzen gegen die Sozialdemokratie wäre dann in erster Linie das der „negativen Integration“[1] gewesen. Die Gesetze hätten sich dann eingefügt in ein von langer Hand geplantes Vorgehen Bismarcks, um diese Wende zu ermöglichen, sozusagen als „Voraussetzung, Kernstück und Ausdruck einer reaktionären Kursänderung“[2] seiner damaligen Politik. Als wichtige mögliche Beweggründe für die „Tat des großen Mannes“ vergäße man dann aber solche wie sein persönliches Unverständnis bzw. seine Abneigung gegenüber der „rothen Race“ aus seiner monarchisch-aristokratischen Position heraus oder seine tatsächliche Angst vor einem bevorstehenden Umsturz der Massen. In dieser Arbeit soll, anhand der Forschung und mit Hilfe der Quellen aus dieser Zeit, das dem Gesetz zugrundeliegende Umsturz-Motiv untersucht werden; das ist einerseits der Umsturzwillen der Sozialdemokratie und andererseits die Umsturz-Furcht Bismarcks.
II. Hauptteil: Der sozialistische Umsturz als Motiv für die Sozialistengesetze
Wollte Bismarck mit dem Sozialistengesetz von 1878 einen tatsächlichen oder vermeintlichen Umsturz verhindern, herbeigeführt von linker Presse und sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten? Wollte er mit diesem scharfen Vorgehen (Verbot sozialdemokratischer, sozialistischer und kommunistischer Vereine, Versammlungen und Druckschriften/Ausweisungen von Aktiven dieser Couleur/Ausrufung eines kleinen Belagerungszustands für Bezirke und Ortschaften bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit) einer gewaltsamen Erhebung der Arbeiter entgegenwirken? Ebenso wichtig erscheint die Frage, ob die Sozialisten oder Sozialdemokraten in der Lage waren, einen Umsturz durchzuführen und ob sie ihn damals überhaupt beabsichtigten?
1. Die Sozialisten und der Umsturz
1.1. Das Umsturzpotential der Sozialisten
§ 1 des Gesetzes „gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie“ von 1878 besagt: „Vereine, welche durch sozialdemokratische, sozialistische oder kommunistische Bestrebungen den Umsturz der bestehenden Staats- oder Gesellschaftsordnung bezwecken, sind zu verbieten. Dasselbe gilt von Vereinen, in welchen sozialdemokratische, sozialistische oder kommunistische Bestrebungen in einer den öffentlichen Frieden, insbesondere die Eintracht der Bevölkerungsklassen gefährdenden Weise zu Tage treten.“[3]
Die Frage, die sich zunächst stellt, ist die, ob die Arbeiterbewegung in Deutschland zum damaligen Zeitpunkt tatsächlich einen Umsturz der bestehenden Ordnung herbeiführen konnte? Laut Lothar Gall wäre ein sozialistischer Umsturz in den 70er und 80er Jahren des 19. Jahrhunderts von den Rahmenbedingungen her durchaus denkbar gewesen. Das Deutsche Reich befand sich zu der Zeit an der Schwelle zur modernen Industriegesellschaft und unvereinbar wären sich die in den Städten zunehmende Industriearbeiterschaft und das liberale (Groß-)Bürgertum gegenübergestanden[4]. Aber konnte sich ein Umsturz durch die Industrie-Arbeiterschaft damals schon entwickeln, war sie überhaupt in genügend großer Zahl vorhanden bzw. deren Bewegung[5] damals mächtig genug? Die Zahlen sprechen gegen eine schon etablierte und kämpferisch bereitstehende Arbeiterschaft zu der Zeit. Laut der Zahlen von Giepenburg/Hemje-Oltmanns/Meyer-Renschhausen sollen noch im Jahre 1882 43% aller Arbeiter in der Landwirtschaft beschäftigt gewesen sein. Nach etwas mehr als 10 Jahren seien es dann nur noch 36,19% gewesen, wobei der Hinweis fällt, „daß lange nicht alle in den Städten arbeitende Fabrikarbeiter sind.“[6] Später als andernorts sei in Deutschland erst in der Reichsgründungs-Phase zu Beginn der 70er der Übergang von der vorherrschenden handwerklichen Produktionsweise zur kapitalistisch basierten industriellen Fertigung erfolgt: „Der späte Eintritt Deutschlands in die kapitalistische Industrialisierung und der durch den militärischen Sieg über Frankreich abgepreßte Werttransfer bedingten die dann einsetzende treibhausmäßige Entwicklung kapitalistischer Produktionsbedingungen.[7] “ Auch Kurt Brandis weist darauf hin, dass es in den 60er und 70er Jahren des 19. Jahrhunderts noch kein industrielles Proletariat gegeben habe, das als Fundament einer sozialistischen/sozialdemokratischen Arbeiterbewegung zum Umsturz gebracht werden hätte können. Die Großindustrie sei noch nicht vollständig entwickelt, Werktätige noch ein buntes Gemisch aus „Handwerkern, Hausindustriellen, industriellen Lohnarbeitern, landwirtschaftlichem Gesinde usw“ gewesen .[8]
1.2. Die Umsturz-Absicht der Sozialisten
1.2.1. Solidarität mit der Pariser Kommune
Auch wenn der Umsturz zur Zeit des Sozialistengesetzes technisch eher unwahrscheinlich war, kann es dann trotzdem sein, dass ihn die Sozialisten damals beabsichtigten? Wollten die Sozialisten einen gewaltsamen Umsturz der gesellschaftlichen Umstände? In Bismarcks Rede zur Sozialdemokratie vor dem deutschen Reichstag am 17. September 1878 kommt er darauf zu sprechen, dass er im Jahre 1871 wachgerüttelt wurde, durch die Solidaritätsbekundung des Abgeordneten Bebel der Pariser Kommune[9] gegenüber. Der damals einzige Sozialdemokrat im Parlament scheint diesem zu drohen: „Seien Sie fest überzeugt, das ganze europäische Proletariat und alles, was noch ein Gefühl für Freiheit und Unabhängigkeit in der Brust trägt, sieht auf Paris. Und wenn auch im Augenblick Paris unterdrückt ist, so erinnere ich Sie daran, daß der Kampf in Paris nur ein kleines Vorpostengefecht ist, daß die Hauptsache in Europa uns noch bevorsteht, und daß, ehe wenige Jahrzehnte vergehen, der Schlachtruf des Pariser Proletariats: Krieg den Palästen, Friede den Hütten, Tod der Not und dem Müßiggang der Schlachtruf des gesamten europäischen Proletariats sein wird.“[10] Im ganzen Reich gab es von Seiten der Sozialisten und deren Sympathisanten Versammlungen, als sich in der französischen Hauptstadt das „Pariser Proletariat“ erhob[11]. Kann man von dieser Solidarisierung der Arbeiter und deren Organisation mit dem revolutionären Akt in Paris direkt auf den Wunsch einer Erhebung im eigenen Land schließen? Kann man Bismarck verstehen, wenn er angesichts der Drohung Bebels Maßnahmen gegen die Umsturzbestrebungen ankurbelt und 1878 schließlich durchsetzt?
1.2.2. Revolutionärer Verbalismus
Ist es lediglich „revolutionärer Verbalismus“[12], der in dieser Drohung Bebels steckte? Ein „rein formaler Radikalismus“[13] der Sozialdemokratie, so wie er die Partei der Bewegung seit deren Entstehung eigentlich bestimmt? Für Theodor Schieder ist das so. Im Unterschied zum russischen Sozialismus, der sich theoretisch und praktisch eng an Karl Marx anlehnte[14] und 1917 dann auch den tatsächlichen Umsturz der Verhältnisse im Zarenreich herbeiführt, sieht er in der sozialistischen Bewegung in Deutschland eine Kraft, die mit dem Umsturz zwar liebäugelt, ihn auch predigt, aber klar auf die Arbeit als parlamentarische Opposition ausgerichtet ist. Die Umwälzung der Werte der Gesellschaft wäre, so Schieder, für die Sozialdemokratie als Organisation der Bewegung nicht auf dem Wege eines gewaltsam durchgeführten Umsturzes beabsichtigt gewesen, sondern hätte im unvermeidlichen ökonomischen „Kladderadatsch“[15] des kapitalistischen Systems ihren Anfang genommen. Die Sozialdemokratie hätte diesen Moment lediglich abwarten „und die Arbeit der Partei auf die Stärkung der Organisation zur Auswertung dieses Augenblicks“[16] einstellen wollen. Das revolutionäre Vokabular der Sozialdemokraten sei allerdings trotz des klaren Bekenntnisses der Partei zu einem „Sozialpazifismus“[17] nach 1871 beibehalten worden, weil die Partei scheinbar glaubte, „durch das formale Festhalten an dem traditionellen Kernbegriff ,Revolution‘ die Einheit der Partei aufrechterhalten zu können“[18]. Brandis sieht in diesem speziellen Sprachgebrauch der Sozialdemokratie nicht nur den Sinn in der Erhaltung, sondern in der Erweiterung der Anhängerschaft: „Der agitatorische Gebrauch einer revolutionären Terminologie, hinter der ein reformistischer Sinn stand, sicherte der Sozialdemokratie die Gefolgschaft radikaler Teile des Proletariats, ermöglichte Selbsttäuschungen der revolutionären, oppositionellen Gruppen innerhalb der Sozialdemokratie über den Charakter ihrer Partei und führte manchen Historiker in die Irre.“[19] Ein ganz einfacher Grund, der die Sozialdemokratie dazu veranlasst haben mag, sich eines stark beladenen revolutionären Wortschatzes bedient zu haben, mag noch ins Feld geführt werden: die Tatsache, das sich eine so verhältnismäßig kleine Fraktion nur mit starken Worten im Hexenkessel des Reichstags Gehör verschaffen konnte[20]. Dass Bebel sich in seiner Stellungnahme zur Pariser Kommune als einziger im Reichstag sitzender sozialdemokratischer Abgeordneter zum „Evangelium dieser Mörder und Mordbrenner“[21] bekannte, brannte sich sicher nicht nur inhaltlich, also durch das Bekenntnis selbst, sondern auch auf Grund der starken bzw. provozierenden Wortwahl in die Gehirne der anderen Abgeordneten[22]. In seiner Geschichte der Deutschen Sozialdemokratie von 1898 bemüht auch Franz Mehring diese starke Kriegsmetaphorik im scheinbar als Krieg empfundenen Kampf zwischen Regierung und (sozialistischen) Oppositionellen. Mehring spricht im Zusammenhang mit Trauermärschen der Arbeiterbewegung vom „Massenschritt der Arbeiterbataillone“:„Ein Heer, das seine gefallenen Kämpfer so zu ehren wußte, war nicht zu stoppen, wie etwa die biedere Bourgeoisie...“[23]
1.2.3. Reform oder Revolution?
Als für den damaligen Zeitgenossen irreführend bzw. „befremdlich“ und „erschreckend“ bezeichnet Wolfgang Pack auch das Gebaren der Sozialdemokratie, was wohl bei genauerer Kenntnis derselben zu einem gemäßigteren Urteil über deren Handlungsbereitschaft geführt hätte[24]. Er schickt sich sogleich an, diese dem Leser mitzugeben. Für ihn seien die Vorstellungen der Lassalleaner von denen der Eisenacher dem Staat gegenüber klar zu trennen: die 1863 gegründeten Lassalleaner, die im Zuge der ausgiebigeren Verfolgung der Sozialisten nach der Reichs-Gründerkrise 1873[25], 1875 mit den Eisenachern zur SAP zusammengingen, seien klar staatsbejahend[26] und national orientiert gewesen. Deren Gründer und Vertreter der Arbeiter-Interessen Ferdinand Lassalle sei, ganz Realpolitiker, zu Verhandlungen mit der Staatsführung bereit gewesen[27], um sein ultimatives Ziel, das allgemeine Wahlrecht[28] zu erlangen. Ab 1869 seien dieser pragmatischen und sozialreformerischen Arbeiterpartei die Eisenacher unter Bebel und Liebknecht gegenübergestanden und hätten sich (eben bis 1875) „befehdet“. Deren Ausrichtung sei „marxistisch-international“ und so nicht mit der aktuellen Regierungsform in Einklang zu bringen gewesen, den Kampf der Klassen habe man sich auf die Fahne geschrieben.[29] Dabei seien Bebel und Liebknecht in ganz unterschiedlicher Weise dem jungen Staatsgebilde gegenübergestanden. Auf der einen Seite der „Vertreter der absoluten Negation“[30], der „Anti- Parlamentarist“[31] Liebknecht, auf dessen Ausführungen[32] sich sogar Anarchisten beriefen, auf der anderen Seite, der von Lassalle beeinflusste Bebel, der der Sozialdemokratie, laut Pack, den legalen Weg in die Politik geebnet hätte. Die Ziele der Bewegung seien, so Bebel damals, „mit allen gesetzlichen Mitteln und ohne Revolutionen und Aufstände, Gewalt- und Druckmittel zu erreichen...“[33]. Die Bewegung arbeite, so Pack weiter, „auf eine Revolution im Sinne einer grundlegenden Umgestaltung der bestehenden Zustände durch den Gewinn der politischen Macht“[34] hin. Den prinzipiellen Unterschied zwischen beiden Richtungen versteht man besser, wenn man Brandis hinzuzieht, der Lassalleaner und Eisenacher in ihrer Revolutionsanschauung gegenüberstellt. Für Brandis ist Lassalle nichts anderes als ein radikaler Demokrat[35], ein bürgerliche Revolutionär. Dieser erkenne nach Lassalle die unterschwellig schon stattgefundenen Umwälzungen der Gesellschaft und bringe „bereits vorhandene ökonomische Existenzformen zur rechtlichen Anerkennung“.[36] Dabei sei das Moment der Gewalt zweitrangig, die ,Revolution‘ geschehe aus der geschichtlichen Situation heraus, hänge nicht vom Willen bzw. „der Entscheidung der Revolutionäre“ ab[37]. Dem stehe der „revolutionäre Demokratismus“[38] der SDAP bzw. Eisenacher gegenüber, der sich, so Brandis, zumindest noch bis zur Reichsgründung durch die Idee der aktiven revolutionären Umwälzung durch einen Umsturz im Staat ausdrückt[39]. Lassalle sieht seine Bewegung als „allgemeine demokratische Volksbewegung“[40], sie ist „keine Klassenbewegung“[41] [42] als die sie dagegen der Marxismus-Leninismus verstanden wissen will . Nicht der Klassenkampf, der im Umsturz der bestehenden Verhältnisse ende, sondern der Begriff der Aufklärung stehe bei Lassalle im Vordergrund seines Revolutionsbegriffs. So sei die soziale Revolution dargestellt „als Angelegenheit aller Aufgeklärten, die den ,leidenden Massen‘ helfen wollen“[43]. Die Einführung des allgemeinen Wahlrechts, nach dessen Anwendung sich die „soziale Republik“ gleichwohl von selbst einstelle, sehe Lassalle als revolutionären Akt an[44]. Zwischen den beiden Polen: Lassalle und Marxismus-Leninismus laviere laut Brandis die SDAP, die sich in Abgrenzung zur radikalen Bürgerpartei Lassalles zwar „Arbeiterpartei“ nenne, die aber ihre „Loslösung aus der bürgerlichen Ideenwelt nur teilweise vollzogen“[45] habe. Lediglich im revolutionären Wortschatz, dessen sie sich bediene, stehe man der Ideologie des reinen Sozialismus Marx’scher Couleur nahe[46].
1.2.4. Abgrenzung nach links
Mit der Abgrenzung nach links ging man den Weg der innerparteilichen Demokratisierung konsequent weiter. Neben der Hauptstoßrichtung der Sozialdemokratie, die sich in den 70er Jahren nach der Reichsgründung allmählich manifestierte, gab es am Rande der Partei, noch vor der Verabschiedung des Sozialistengesetzes, den Umsturz favorisierende und propagierende Radikale[47], die ähnlich wie die Reichstagsrede Bebels, der Öffentlichkeit ein völlig falsches Bild der Sozialdemokratie vermittelt hätten[48]. Bis 1878 darf man sich die Partei wohl als ein heterogenes Gemisch aus kleinbürgerlich-demokratischen Gruppierungen, die durch die Wirtschaftskrise in die Partei gespült wurden[49], national ausgerichteten, gemäßigteren Lassalleanern, eher (wohl zu Beginn noch) am internationalen Sozialismus orientierten Eisenachern, und aktionsbereiten Anarchisten vorstellen. Durch die Phase der Sozialistengesetze 1878-90[50] scheint eine Homogenisierung der Partei eingetreten zu sein[51]. Pack wertet dies als „das wertvollste Ergebnis“ der Gesetze, dass eine „Scheidung von allen sozialrevolutionären, anarchistischen und nihilistischen[52] Strömungen“ durchgeführt wurde. Durchgeführt werden musste, wenn man den legalen Weg der Sozialdemokratie auch unter dem restriktiven Gesetz weiterbeschreiten wollte[53]. Der drohenden Unterdrückung durch Staat und Polizei, möglichen Verhaftungen und Ausweisungen versuchte sich die Partei mit einer Taktik der Auflösung bzw. Anpassung und des Rückzugs zu entziehen, ausgesprochen in dem Motto: „An unserer Gesetzlichkeit müssen unsere Feinde zugrunde gehen“[54]. Das heißt aber auch, dass sie damit den revolutionäreren Elementen in ihren Reihen klar die Türe weisen, sich jetzt sozusagen mit dem Rücken zur Wand von den „Umstürzlern“ abgrenzen musste[55]. Die Distanzierung zum Vorgehen russischer Nihilisten oder dem der Anarchisten im Allgemeinen thematisiert Iring Fletscher im Zusammenhang mit den 1880 und 1887 in der Schweiz (Wyden/St. Gallen) geheim abgehaltenen sozialdemokratischen Kongressen. Dabei wird in Wyden das gewaltsame Vorgehen der russischen Revolutionäre gegen das herrschende System (Anschläge/Attentate) prinzipiell gebilligt, deren Arbeitsweise jedoch nicht als geeignet für die deutschen Verhältnisse erachtet. Sieben Jahre später zieht Liebknecht in St. Gallen dann den Trennstrich scharf zu individuellen gewaltsamen Aktionen gegen den Staat, den er im gleichen Zug anklagt mit seinen Methoden für eben jene Taten verantwortlich zu sein: „Die Taktik der individuellen Gewaltanwendung führt nicht zum Ziele und ist, insofern sie das Rechtsgefühl der Masse verletzt, positiv schädlich und darum verwerflich. Für die individuellen Gewaltakte bis aufs äußerste Verfolgter und Geächteter machen wir die Verfolger und Ächter verantwortlich…“[56] Brandis zitiert Liebknecht noch einmal in einem ähnlichen Zusammenhang unmissverständlich in Richtung der „anarchistischen Gewaltanbeter“ betonend: „Gerade weil wir Revolutionäre sind, d.h. die gründliche Ausrottung der vorhandenen Mißstände…wollen, sind wir prinzipielle Gegner von Putschen und sonstigen Gewalttätigkeiten, die in einem Kulturlande wie Deutschland keinen Zweck haben.“[57]
1.2.5. Kein Umsturz
Zu guter Letzt spricht gegen die Umsturzbereitschaft der Arbeiterbewegung die ganz banale Tatsache, dass es in Deutschland vor, während und nach den Sozialistengesetzen keine tatsächliche gewaltsame Umwälzung gegeben hat[58]. Und das trotz der Tatsache, dass viele Arbeiter „unter dem Druck des Sozialistengesetzes dem Anarchismus in die Arme getrieben wurden“[59]. Die Zeit der Ausnahmegesetze für die Sozialisten 1878-1890 schien die Arbeiterbewegung zusammengeschweißt zu haben, jedoch blieb als Reaktion auf die enorme Drangsalierung und tatsächliche Unterdrückung durch Polizei und Staat eine revolutionäre Aktion aus[60]. Ganz im Gegenteil: die Parteiführung entschließt, wie oben erwähnt, die Partei vor dem Wirksamwerden der Gesetze aufzulösen[61]. Leo Stern spricht der SAP deswegen auch den Status einer „marxistischen, proletarischen Kampfpartei“[62] ab und begründet diesen Gesinnungswandel mit dem Zustrom einer großen Zahl „Intellektueller, meistens „sozialreformistischer-pazifistischer Richtung““[63] seit 1876, verantwortlich für die völlige „Kapitulation vor dem Sozialistengesetz“[64].
Wenn also die Sozialisten nur dem Anschein nach einen Umsturz im Reich vorgehabt hätten, hatte sich Bismarck dann tatsächlich durch den revolutionären Habitus der Sozialdemokratie täuschen lassen? Bediente dieser vielleicht einfach die vorhandene Furcht des Kanzlers vor einem sozialistischen Umsturz, hervorgerufen durch die „Sekte“ die nicht einmal vor dem „Königsmord“ zurückschreckt?[65] Träumte Bismarck neben dem „cauchemar des coalitions“[66] auch einen „cauchemar des révolutions“[67] ?
2. Bismarck und der Umsturz
2.1. „das Frankfurter demokratische Treiben“
Offensichtlich hatte Bismarck schon einige Jahrzehnte vor den Sozialistengesetzen Alpträume bezüglich möglicher durch das Volk verursachter Unruhen. 1851 ist er als Gesandter Preußens[68] in Frankfurt am Main, dem Tagungsort des Deutschen Bundes. Dort befürchtet er erneute Unruhen nach der Revolution von 1848, die zwei Jahre zuvor ausgebrochen war. In seinen Briefen und Berichten aus Frankfurt an seinen Vorgesetzten, den preußischen Ministerpräsidenten Manteuffel[69] zeichnen sich Motivation und späteres Vorgehen im Zusammenhang mit seinen Ausnahmegesetzen von 1878 schon deutlich ab. Bismarck scheint vor Ort als einziger die Gefahr[70] zu erkennen, die „das Frankfurter demokratische Treiben“[71] in sich berge. Die vorgefundene Schwäche der Behörden, vielleicht sogar noch „Sympathie für die Demokraten“[72] veranlasst ihn eine Art verdeckten Belagerungszustand[73] unter preußisch-österreichischer Führung zu fordern, um Schlimmeres zu verhindern. Dabei bestimme „die Pflicht der Notwehr gegen die Revolution“[74] dieses Vorgehen, man stehe einer „offen und geheim durch tausende von Teilnehmern in Westdeutschland betriebenen Verschwörung“[75] gegenüber, die „rothe Presse“[76] heize das Ganze noch an, täglich träfen Bewaffnete ein, die „sich in der Stadt verlieren“[77].
2.1.2. 80.000 Sozialdemokraten in Berlin
Tenfelde sieht in Bismarcks Appellen an Manteuffel eine „übersteigerte Furcht vor den Massen“[78], eine „Umsturz-Phobie“[79], die in der Reaktionszeit nach der 48er Revolution[80] und in der „Phase der vorsichtig öffnenden Arbeiterpolitik der 1860 Jahre“[81] stark zurücktritt, bis sie mit der zunehmenden Entfremdung von der Sozialdemokratie, der Organisation hinter den
Massen wieder deutlicher zum Vorschein kommt[82]. Die Angst vor dem Umsturz der Massen lasse Bismarck eine duale Strategie aus Repression (Sozialistengesetze[83] ) und Integration (Sozialpolitik[84] ) vornehmen. Dabei habe der Umsturz in den 70er Jahren des Reichs, so Tenfelde, vielmehr „in den Köpfen der regierenden Eliten“ als realiter bevorgestanden[85]. Als Katalysator von Bismarcks Befürchtungen hätte die Rede Bebels zur Pariser Kommune im Reichstag gedient, der aber eben als einziger sozialdemokratischer Abgeordneter im Reichstag auch noch einer „lächerlich kraftlosen“ gewerkschaftlichen und politischen Arbeiterbewegung bevorstand[86]. Tenfelde sieht den überwiegend repressiven Maßnahmenkatalog Bismarcks gegen Arbeiter und Arbeiterbewegung, der sich bis zu dessen Abdankung 1890 hindurch zieht, als basierend auf dieser emotionalen Fehleinschätzung der historischen Situation durch den Kanzler[87]. Neben den Sozialistengesetzen 1878 gehören zu diesen Maßnahmen auch Bismarcks Bestrebungen einer internationalen Allianz gegen den Sozialismus[88], die preußisch-österreichischen Unterredungen 1872[89], das Reichspressegesetz 1874, die verstärkte gerichtliche Verfolgung der Sozialisten während der Ära Tessendorf und das Verbot der Partei in Preußen 1876. Während der Verhandlungen um das Sozialistengesetz 1878 seien die Befürchtungen des Kanzlers vor einem etwaigen Umsturz durch „80.000 Sozialdemokraten in Berlin“[90] stark präsent gewesen. Bismarck habe „in mehreren einschlägigen Schreiben…eine Verstärkung der Berliner Militärstandorte“[91] gefordert, die ihm aber verweigert wurde[92]. Ebenso sei, Tenfelde gemäß, die Abwehr einer Revolution eine der Grundlagen seiner Argumentation für die integrative Sozialpolitik gewesen. Man solle, so Bismarck, die geplante staatliche Bezuschussung der Versicherungen nicht bemängeln[93], denn: „Wir beugen damit einer Revolution vor, die in fünfzig Jahren ausbrechen kann, aber auch schon in zehn Jahren, und die, selbst wenn sie nur ein paar Monate Erfolg hätte, ganz andere Summen verschlingen würde.“[94]
2.1.3. Furcht vor den Massen?
Bismarcks hartnäckiges und lang andauerndes Vorgehen gegen die Bewegung der Arbeiter scheint wohl daher zu einem großen Teil durch seine Furcht vor einem Umsturz begründet gewesen zu sein, ebenso wohl auch seine Sozialpolitik, die Bismarck, laut Tenfelde, nicht erst in den 80ern des 19. Jahrhunderts angegangen sei[95]. Bismarck unterscheidet dabei aber schon früh und im folgenden dann konsequent zwischen der Masse der (unpolitischen) Arbeiter, dessen Los er zu verbessern gedenke und den sozialistischen Demagogen und „Berufsagitatoren“[96], einem seiner Meinung nach kleinen Häufchen, das aber im richtigen Moment eine Explosion herbeiführen könne. Bereits 1872, in den Vorgesprächen zur oben erwähnten Konferenz fordert Bismarck einerseits ein „Entgegenkommen für die Wünsche der arbeitenden Klasse“[97] und andererseits „Verbots- und Strafgesetze gegen die so genannten ‚staatsgefährlichen Agitationen‘“[98]. In seiner Reichstagsrede 1878 hebt Bismarck den empfundenen Unterschied immer wieder sprachgewaltig hervor. Auf der einen Seite skizziert er den kultivierten Lassalle, einen „Mann von Geist“[99], den er sich auch als „Gutsnachbarn“[100] vorstellen könne und die „arbeitenden Klassen“, die unverschuldet in die Erwerbsunfähigkeit gelangt seien[101] und denen er bzw. der Staat zu helfen gedenke[102]. Auf die andere Seite stellt er die Eisenacher Bebel und Liebknecht, die „kümmerlichen Epigonen“[103] Lassalles und deren „Genossen“, von ihm als „Sekte“ und „Banditen“ bezeichnet und mit den gewaltbereiten Nihilisten auf eine Stufe gestellt, mit ihrer „hetzerischen“ Presse. Wortwörtlich unterstellt er ihnen den Umsturz[104], den sie durchführen wollen, ohne zu wissen, was danach käme[105]. Neben Bismarcks persönlicher Abneigung gegen die Umstürzler, die in dieser Rede durchklingt und die ihm Pack bescheinigt[106], kommt wohl bei der Einschätzung dieser aufrührerischen Absichten der Sozialdemokratie dessen „Wissensdefizit“ bezüglich der tatsächlichen „sozialdemokratischen Zukunftsvorstellungen“ zum Tragen[107]. Auch was die Anzahl der vermeintlichen Aufrührer angeht, scheint sich Bismarck laut Pack getäuscht zu haben[108]. Die Macht dieser wenigen, aber lauten Revolutionäre schätzte Bismarck aber scheinbar schon früh hoch ein. So zielten laut Wittwer alle gesetzlichen Bemühungen des Reichskanzlers schon zu Beginn der 70er[109] auf die „Spaltung der Arbeiterbewegung“[110] ab. Um die Verführung der Massen durch sie zu verhindern[111] bzw. den „Einfluß der revolutionären Kräfte zurück(zu)drängen“[112] sei die Verschärfung der bestehenden Gesetze versucht worden, dann ein Auffüllen der Verfassung mit repressiven und gegen die Bewegung gerichteten Gesetze. Bismarck scheitert mit seinen Plänen bis zu den zwei Attentaten auf Kaiser Wilhelm I. und der daran anschließenden emotionsgeladenen Volksstimmung[113] jeweils an der nationalliberalen Mehrheit im Bundestag. Nach den zwei Anschlägen kippt die vorher so widerspenstige Fraktion um und bewilligt 1878 das gegen die Umsturzbestrebungen der Sozialdemokratie gerichtete Ausnahmegesetz.
III. Fazit
Bis es zu den Sozialistengesetzen von 1878 kommt, träumt Bismarck tatsächlich einen „Alptraum der Revolutionen“. Hauptdarsteller darin nicht die Arbeitermassen, sondern die umsturzbereiten Sozialdemokraten, die Bismarck nicht als ernstzunehmende politische Gegner, sondern „als Agitatoren, als politische Terroristen und als Staatsfeinde“ sieht. Deren politische Ideen seien, so der Kanzler, nicht ernstzunehmend und daher auch nicht fähig gewesen, langfristig von Erfolg gekrönt zu sein. Allerdings hätte Bismarck seinen sozialistischen Gegnern zugetraut, einen „einmaligen politischen Umsturz“ bewirken zu können[114]. So sei Bismarcks Vorgehen gegen die „Reichsfeinde“ den Umständen entsprechend nötig, die Ausnahmegesetze gegen die Sozialdemokratie reine „Notwehr“ und der Versuch gewesen, die gewaltbereiten Umstürzler unschädlich zu machen. Der Reichskanzler scheint aber Kampfbereitschaft und –fähigkeit der Massen und derer Organisation falsch eingeschätzt zu haben. Die kampfbereite Anhängerschaft der SAP ist faktisch erst zum Ende des 19 Jahrhunderts vorhanden, die Organisation der deutschen Arbeiterbewegung, als die sich die SAP sieht ist im Kern nicht Umsturz-orientiert und distanziert sich zum Ende der Sozialistengesetze immer eindeutiger von Gewaltanwendungen gegenüber dem Staat. Die revolutionäre Wortwahl und das ebenso aggressive öffentliche Gebaren bzw. der gewaltbereite Rand der Partei erzeugen allerdings ein dazu gegenteiliges Bild in der Öffentlichkeit und auch bei Bismarck[115].
IV. Quellen und Literatur
1. Quellen
- Reichsgesetzblatt No. 34, Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie in: Döring, Diether/Kempen, Otto Ernst (Hg.) Sozialistengesetz, Arbeiterbewegung und Demokratie. Köln/Frankfurt am Main, S. 119-126.
- Bismarck, Otto von, Reichstagsrede vom 17. September 1878 in: Gall, Lothar (Hg.) Bismarck. Die großen Reden. Berlin 1981, S. 168-188.
- Privatschreiben, Berichte und Telegramme von Otto von Bismarck an Minister v. Manteuffel in: von Petersdorff, Hermann (Hg.). Bismarck. Die gesammelten Werke. Politische Schriften, Band 1. Berlin 1924, S. 11-78.
- Mehring, Franz. Geschichte der Deutschen Sozialdemokratie, Zweiter Teil. Stuttgart 1898.
2. Literatur
- Brandis, Kurt. (i.e. Karl Brockschmidt) Der Anfang vom Ende der Sozialdemokratie. Die SPD bis zum Fall des Sozialistengesetzes. 1927. Neuerschienen: Berlin 1975.
- Fetscher, Iring. Attentate und Arbeiterbewegung in Deutschland, in: Döring, Diether/Kempen, Otto Ernst. Sozialistengesetz, Arbeiterbewegung und Demokratie. Köln/Frankfurt/M. 1979.
- Gall, Lothar. Bismarck. Der weisse Revolutionär. Berlin, 2008.
- Griepenburg, Rüdiger, Hemje-Oltmanns, Dirk, Meyer-Renschhausen, Elisabeth. Arbeiterbewegung und Sozialistengesetz in: Brandis, Kurt. Der Anfang vom Ende der Sozialdemokratie. Berlin 1975.
- Mehring, Franz. Geschichte der Deutschen Sozialdemokratie 2. Teil, Stuttgart 1898.
- Pack, Wolfgang. Das parlamentarische Ringen um das Sozialistengesetz Bismarcks 1878- 1890. Düsseldorf 1961.
- Plumpe, Werner. Otto von Bismarck und die soziale Frage, in: Mayer, Tilman (Hg.) Bismarck: Der Monolith, Hamburg 2015.
- Schieder, Theodor. Staatensystem als Vormacht der Welt, in: Propyläen Geschichte Europas Band 5. Frankfurt/M./Berlin/Wien 1975.
- Schieder, Wolfgang. Bismarck und der Sozialismus, in: Kunisch, Johannes (Hg.) Bismarck und seine Zeit. Berlin 1992.
- Schröder, Wolfgang. Gewerkschaften im Kampf gegen das Sozialistengesetz, in: Beutin, Heidi/Beutin, Wolfgang/Malterer, Holger u.a. (Hg.) 125 Jahre Sozialistengesetz. Frankfurt/Main 2004.
- Stern, Leo (Hg.) Der Kampf der deutschen Sozialdemokratie in der Zeit des Sozialistengesetzes 1878-1890. Die Tätigkeit der Reichs-Comission. Berlin 1956.
- Tenfelde Klaus. Bismarck und die Sozialdemokratie, in: Gall, Lothar (Hg.) Otto von Bismarck und die Parteien. München 2001.
- Ullrich, Volker. Die nervöse Grossmacht. Frankfurt/Main, 1997.
- Vretska, Karl. Platon, Der Staat, Stuttgart 2000.
- Wittwer, Walter. Zur Politik des preußisch-deutschen Staates gegen die revolutionäre Arbeiterbewegung nach der Reichsgründung (1871-1878), in: Bartel, Horst/Engelberg, Ernst (Hg.) Die großpreußisch-militaristische Reichsgründung 1871, Band 11. Berlin 1971.
[...]
[1] Zu Bismarcks vermeintlicher Vorgehensweise hier gehört es, „innenpolitische Konflikte anzuheizen, Minderheiten als Reichsfeinde zu stigmatisieren, um auf diese Weise die Mehrheit zu sammeln und auf sein Ziel der konservativen Stabilisierung zu verpflichten." Ullrich, Volker. Die nervöse Grossmacht. Frankfurt/Main, 1997, S. 64.
[2] Schröder, Wolfgang. Gewerkschaften im Kampf gegen das Sozialistengesetz, in: Beutin, Heidi/Beutin, Wolfgang/Malterer, Holger u.a. (Hg.) 125 Jahre Sozialistengesetz. Frankfurt/Main 2004.
[3] Kursivierung durch den Autor; zitiert aus Döring, Dieter/Kempen, Otto Ernst. Sozialistengesetz, Arbeiterbewegung und Demokratie. Köln/Frankfurt am Main, S. 119. Die ersten Arbeitervereine, damals Arbeiterbildungsvereine entstanden in Deutschland schon vor der Revolution von 1848. Aus diesen gingen später die Parteien hervor bzw. bildeten diese im Weiteren deren Basis.
[4] „Die sozialen Probleme der heraufziehenden Industriegesellschaft bildeten zweifellos in dieser Phase des Übergangs ein Pulverfaß." Gall, Lothar. Bismarck. Der weisse Revolutionär. Berlin, 2008, S. 576
[5] Die Bewegung der Arbeiter entstand aus dem 1863 von Ferdinand Lassalle (1825-1864) in Leipzig gegründeten Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein (ADAV) und der 1869 in Eisenach von August Bebel (1840-1913) und Wilhelm Liebknecht (1826-1900) gegründeten Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Deutschlands (SDAP); Zusammenschluss in Gotha 1875 zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands (SAP)
[6] Griepenburg, Rüdiger, Hemje-Oltmanns, Dirk, Meyer-Renschhausen, Elisabeth. Arbeiterbewegung und Sozialistengesetz in: Brandis, Kurt. Der Anfang vom Ende der Sozialdemokratie. Berlin 1975, S. 110.
[7] Ebd., S. 102.
[8] Brandis, Kurt. Der Anfang vom Ende der Sozialdemokratie. Berlin 1975, S. 16. „...die geringe Entwicklung der Arbeiterklasse in Deutschland von 1871." an anderer Stelle Ebd. S. 29.
[9] 1871 putschen revolutionäre Kräfte in Paris und errichteten für über zwei Monate gegen den Willen der frz. Exil-Regierung in Bordeaux einen revolutionären Stadtrat.
[10] Mehring, Franz. Geschichte der Deutschen Sozialdemokratie 2. Teil, Stuttgart 1898, S. 306-307.
[11] „Ueberall, wo es in deutschen Landen ein klassenbewußtes Proletariat gab, antwortete ein heller Jubelruf der revolutionären Erhebung der Pariser Arbeiter. Weder die Lassalleaner noch die Eisenacher schwankten auch nur einen Augenblick; Massenversammlungen in Berlin, Hamburg, Bremen, Hannover, Elberfeld, wie in Dresden, Leipzig und Chemnitz erklärten der sozialenRevolution in Paris ihre huldigende Sympathie, entboten ihren Kämpfern die brüderlichen Grüße der deutschen Arbeiter." Mehring, S.305.
[12] Schieder, Theodor. Staatensystem als Vormacht der Welt, in: Propyläen Geschichte Europas Band 5. Frankfurt/M./Berlin/Wien 1975, S. 215.
[13] Ebd.
[14] Schieder weist auf die Unklarheit bezüglich des Begriffs „Revolution" bei Marx selbst hin. Er spricht von einer „doppelsinnigen Bedeutung" im Kommunistischen Manifest:„Marx verwandte ihn einerseits als Bezeichnung für einen allgemeinen Bewegungsvorgang des Geschichtsprozesses, gewissermaßen für ein geschichtsimmanentes Phänomen wie die „Empörung der modernen Produktionskräfte gegen die modernen Produktionsverhältnisse", andererseits für eine gewaltsame Aktion." T. Schieder S. 215
[5] 5 Vor allem von Bebel verwendetes Schlagwort für den beschworenen Zusammenbruch der bürgerlichkapitalistischen Gesellschaft; bzw. Name einer bedeutenden politisch-satirischen Zeitschrift im Deutschen Reich von 1848-1944.
[16] Brandis S. 11. Schieder spricht in Anlehnung an Dieter Groh (dt. Historiker 1932-2012) von „revolutionärem Attentismus" der Sozialdemokratie. T. Schieder S. 217.
[17] Brandis, eine ähnliche Ansicht vertretend, nimmt bei seiner Beurteilung Bezug auf die Aussagen von Bebel und Liebknecht im Leipziger Hochverratsprozess 1872, in dem beide Abstand nehmen von einer möglichen „gewaltsamen Demokratisierung". Brandis, S. 28. Trotz der Tatsache, dass ihnen nicht nachgewiesen werden konnte, daß sie den Entschluß gefaßt hätten, Gewalt zum Sturz der Verfassung anzuwenden, wurden sie durch das Schwurgericht zu zwei Jahren Festungshaft verurteilt (wegen Gründung der sozialdemokratischen Arbeiterpartei , wegen der aktiven Mitarbeiterschaft am ,Volksstaat' und wegen ihrer Agitationsreden in Volksversammlungen). Stern, Leo (Hg.) Der Kampf der deutschen Sozialdemokratie in der Zeit des Sozialistengesetzes 1878-1890. Die Tätigkeit der Reichs-Comission. Berlin 1956, S. XIX.
[18] Schieder S. 217. Der Blick auf andere Länder (Frankreich, Italien) mit sozialistischen Bewegungen hätte die Sozialdemokraten in Deutschland zu dieser Strategie bewegt. Schieder spricht von einer „Sprengkraft" des Gegensatzes von Reform und Revolution.
[19] Brandis S. 29. Für Brandis ist die SAP auch nach dem Gothaer Zusammenschluss von Eisenachern und Lassalleanern an Lassalle orientiert gebliebe. Dabei hätte die marxistische Terminologie das „Fortwuchern des Lassalleanismus" verdeckt. Brandis S. 14.
[20] Dazu Klaus Tenfelde: „Es ist vielfach dokumentiert, zu welchem Hexenkessel der Reichstag werden konnte, wenn auch später in den 1870er Jahren sozialdemokratische Abgeordnete die Stirn hatten, zum Hause zu reden." Tenfelde Klaus. Bismarck und die Sozialdemokratie, in: Gall, Lothar (Hg.) Otto von Bismarck und die Parteien. München 2001, S. 11.
[21] Aus Bismarcks Reichstagsrede vom 17.September in: Gall, Lothar (Hg.) Bismarck. Die großen Reden. Berlin 1981, S. 186.
[22] Siehe Bebel-Zitat S. 6: „Vorpostengefecht", „Krieg den Palästen", „Schlachtruf des gesamten europäischen Proletariats"
[23] Mehring, S. 378.
[24] Pack, Wolfgang. Das parlamentarische Ringen um das Sozialistengesetz Bismarcks 1878-1890. Düsseldorf 1961, S. 8-9: „Zweifellos mußte die im Ton maßlose, in revolutionären Redensarten schwelgende Propagandatätigkeit der Sozialdemokraten alle die befremden und erschrecken, die keine genaue Kenntnis der Bewegung besaßen und sich in ihrem Urteil nur von deren Lebensäußerungen in der Öffentlichkeit leiten ließen."
[25] Reichsgründerkrise: Nach dem Boom der Gründerjahre des Deutschen Reichs erfolgte ab 1873 (bis in die 90er Jahre) eine folgenreiche Phase des verlangsamten Wachstums und der Deflation. Die Phase der vermehrt gerichtlich betriebenen Verfolgung der Sozialisten ab 1874 wird als ,Ära Tessendorf' bezeichnet. Namensgeber: Hermann Tessendorf (dt Staatsanwalt, 1831-1895)
[26] Schieder spricht davon, dass Lassalle zwar staatsbejahend gewesen sei, doch, von Bismarck in diesem Punkt verkannt, nicht im Sinne eines monarchischen Staats, eher im Sinne einer „sozialen Diktatur", angelehnt an den revolutionären Konvent der Jakobiner während der Französischen Revolution, Schieder, S. 183 u. 184.
[27] Ab 1863 traf er sich heimlich deswegen mit Reichskanzler Bismarck.
[28] Tatsächlich 1871 das erste Mal im Reich angewandt, galt für alle Männer über 25 (außer die von der Armenunterstützung lebenden)
[29] Siehe Anm. 22. Für Brandis ist die Partei allerdings entgegen ihres Gebarens bis 1891 „nach der Übernahme des Marxismus als der für die Partei offiziell gültigen Doktrin" „lassallisch". Brandis spricht dieser neuen Doktrin der SAP aber nach den Sozialistengesetzen nach 1890 deren Verinnerlichung dennoch ab, die neue offizielle Richtung sei lediglich eine ideologische Verzerrung der Marx'schen Ideen gewesen. Brandis, S. 13.
[30] Pack, S. 14.
[31] Brandis widerspricht der „Legende über den ,Antiparlamentarismus' Liebknechts" und behauptet, dass Liebknecht lediglich „Pro-Echter-Parlamentarismus" gewesen sei: „Die Polemik Liebknechts richtete sich nicht gegen das allgemeine Wahlrecht als Mittel der sozialistischen Emanzipation überhaupt, sondern nur gegen ein Wahlrecht, das in bonapartistischem Sinne mißbraucht würde und in seiner Durchführung nicht genügend durch bürgerliche Freiheiten gesichert sei." So, laut Liebknecht geschehen, im Norddeutschen Bund (von Preußen ausgehendes und dominiertes Staatsgebilde, zeitlich zwischen Deutschem Bund und Deutschem Reich, 1866-1871) der, so zitiert Brandis ihn, ein „Werk der Gewalt und des Unrechts" sei. Brandis, S. 27.
[32] Anhänger des Anarchismus, der im hierarchischen Staat die Staatenlosigkeit mittels eines Umsturzes herbeiführen möchte, aber im Unterschied zum Kommunismus eine „Diktatur des Proletariats", gestützt auf eine Kaderpartei, als eine neue Herrschaftsform ebenso ablehnt. Bis zum Bruch beider Richtungen 1872 Zusammenarbeit in der I. Internationale.
[33] Pack, S. 15. Kurioserweise ist es Bebel, der dem Staat nur fünf Jahre nach dem Fall der Sozialistengesetze im Jahre 1895 anlässlich der sogenannten „Umsturzvorlage" Gewalt androht. Mit ähnlicher Argumentation wie siebzehn Jahre zuvor wollte der neue Reichskanzler zu Hohenlohe-Schillingsfürst ein spezielles Gesetz durch den Reichstag bringen, weil die bestehenden Gesetze gegen die umstürzlerischen Bestrebungen der Sozialdemokratie nicht ausreichten. So seien, laut Bebel, die Sozialdemokraten zum gewaltsamen Widerstand aufgerufen, wenn die Regierung ihrerseits mit Gewaltmaßnahmen gegen das Volk einen Verfassungsbruch begehe. Siehe dazu auch Fetscher, Iring. Attentate und Arbeiterbewegung in Deutschland, in: Döring, Diether/Kempen, Otto Ernst. Sozialistengesetz, Arbeiterbewegung und Demokratie. Köln/Frankfurt/M. 1979, S. 73.
[34] Pack, S. 15.
[35] Im Gegensatz zum bürgerlichen Demokraten. Siehe dazu die 10. Feuerbach-These von Marx: „Der Standpunkt des alten Materialismus ist die bürgerliche Gesellschaft; der Standpunkt des neuen die menschliche Gesellschaft, oder die gesellschaftliche Menschheit."
[36] Brandis, S. 17. Brandis zitiert hier Lassalle: „Die Staatsidee des Arbeiterstandes" setzt sich von selbst durch, ihre Verwirklichung vollbringt sich „auf objektivem Wege durch die geschichtliche Entwicklung von selbst".
[37] Das klingt nicht nach Klassenkampf und Historischem Materialismus (Stark vereinfacht: nicht der Geist und die Ideen wie z.B. die philosophische Idee der Gerechtigkeit bestimmen das Handeln der Menschen bzw. die Erscheinungsform der Gesellschaft und deren Geschichte, sondern die materiellen bzw. ökonomischen Gesichtspunkte, wie die Art der Produktion oder die Einteilung in Klassen formen den Mensch und dessen geschichtliche Abläufe). Lassalle war wohl schon früh von den Ideen Hegels (Georg Friedrich Wilhelm Hegel, dt. Philosoph: 1770-1831) beeinflusst gewesen, die in diesem Punkt stark anklingen.
[38] Brandis, S. 25.
[39] „Mit der Konsolidierung des Deutschen Reiches nach 1871 mußten die Illusionen über seine gewaltsame Demokratisierung endgültig begraben werden. Für eine demokratisch-sozialistische Auffassung blieb als einziger der Weg ,innerer organischer Entwicklung'. Die Anerkennung dieser neugeschaffenen historischen Situation durch Absage an die Gewalt als politisches Mittel kennzeichnet den Sozialpazifismus der Sozialdemokratie nach 1871." Brandis bezieht sich hier auf einen Vortrag Liebknechts in der am 1. Mai 1869 abgehaltenen Versammlung des Berliner demokratischen Arbeitervereins.
[40] Brandis, S. 15.
[41] Ebd.
[42] Im Gegensatz zu Lassalle Lenin, wie ihn Schieder aufführt: „Für Lenin bestand in keinem Augenblick ein Zweifel daran, daß die Revolution Aktion sein müsse und nicht im Abwarten der geschichtlichen Entwicklung bestehen könne, wie die ,Ökonomisten' meinten" Schieder, S. 218. Bei Brandis ist Marx auch klar „ProUmsturz": „...daß nach Marx die proletarische Revolution nicht in der Legalisierung des Gewordenen besteht. Als Transformationsphase, deren wichtigste Phase der ,gewaltsame Umsturz aller bestehenden Gesellschaftsordnung' ist, in der die ökonomischen Kräfte und die realen Machtmittel entscheidend sind, erschöpf sie sich nicht in der Begründung eines neuen Rechtssystems." Brandis, S. 18. (Das darin enthaltene Zitat von Marx stammt aus dem Kommunistischen Manifest, Marx-Engels-Werke 4, S. 493)
[43] Brandis. S. 18-19.
[44] „So oft ich „allgemeines Wahlrecht" sage, muß es von Euch „Revolution" und wieder „Revolution" verstanden werden." Lassalle zitiert bei Brandis, S. 19.
[45] Brandis, S. 29
[46] Ebd. Siehe 1.2.2., diese Arbeit.
[47] Pack, S. 240: „Sozialrevolutionäre, anarchistische und nihilistische Strömungen".
[48] Pack, S. 16.
[49] Brandis spricht von einer durch die Krise verursachte „Pauperisierung des Kleinbürgertums", das dadurch in die Partei strömt und „nichtproletarische Momente in ihre Politik" bringt. Brandis, S. 9. Später: das „Einströmen deklassierter Mittelschichten im Gefolge der Krise 1873-75" Brandis, S. 34. Für ihn wird die SAP dadurch neben der Interessenvertretung des Proletariats „allgemeine Oppositionspartei im Hohenzollernreich" Brandis Anm.3, S. 79. Von einer Umsturz-Partei also weit entfernt. Einer der Motive für die Sozialistengesetze ist laut Brandis dann auch eine Reaktion der Regierung auf diese Tatsache und der Versuch gegenzusteuern, um „das weitere Übergreifen der sozialdemokratischen Ideen auf außerproletarische Schichten zu verhindern" Brandis, S. 9-10.
[50] Viermalige Verlängerung der Sozialistengesetze im Reichstag: 1880, 1884, 1886 und 1888.
[51] Tenfelde: „Nicht nur das der Kanzler maßgeblich half, innere Gegensätze der keineswegs ausschließlich staatskritischen und einhelligen Reichstagsfraktion der Sozialdemokraten...auszugleichen." Tenfelde, S. 19.
[52] Pack, S. 240. Nihilismus: Gewaltbereite, anarchistische und atheistische Bewegung Russlands; Wirkungszeit ca. 1855-1881
[53] Dazu hatte sich die Partei wohl schon während der Beratungsphase zu den Sozialistengesetzen entschlossen. Laut Stern löste sich der Parteivorstand der SAP zuerst selbst und dann die Parteiorganisation schon „zwei Tage vor dem Erlaß des Ausnahmegesetzes" auf. Stern, S. XXII.
[54] Stern, S. XXIII.
[55] Ebenso fand eine Radikalisierung einzelner Partei-Mitglieder durch die Gesetzgebung statt. Der Konflikt der Partei mit ihrem Abgeordneten Johann Most ist ein Beispiel dafür. Dieser wurde 1878 wegen des durch die Sozialistengesetze bedingten Ausnahmezustands über Berlin von dort ausgewiesen und emigrierte dann zuerst nach England und dann von dort 1882 nach Amerika. Seine Hinwendung zum Anarchismus und Konflikte mit der bzw. Abkehr von der Partei seien wohl bedingt gewesen durch die Passivität der Parteiführung in der ersten Phase nach den Sozialistengesetzen. Siehe dazu Stern, S. XXI f.
[56] „...und welche gegenwärtig durch bezahlte agents provocateurs für die Zwecke der Reaktion gegen die arbeitende Klasse ausgenützt wird." Fetscher, S. 68-69.
[57] Brandis, S. 56. Aus einem Wahlaufruf von Liebknecht, zitiert aus: Die Sozialdemokratie im deutschen Reichstage, Tätigkeitsberichte und Wahlaufrufe aus den Jahren 1871-1893. Berlin 1909, S. 247.
[58] „den relativ friedlichen, „organischen" Charaktere der Periode, in der sich die deutsche Arbeiterbewegung verselbständigte" hebt Brandis hervor und meint damit wohl die Zeit von 71-78, S. 29/30.
[59] Brandis, S. 92: Brandis zitiert hier Blos, Wilhelm. Denkwürdigkeiten eines Sozialdemokraten, München 1914,
S. 96.
[60] Vielleicht auf Grund der immer besseren Wahlergebnisse im Reichstag? (Trotz der Ausnahmegesetze blieb den Sozialdemokraten das parlamentarische Wahlrecht. Die Organisation hatte sich zwar 1878 aufgelöst, im Deutschen Reich wurden jedoch keine Parteien in den Reichstag gewählt, sondern Einzelkandidaten.) Kurz vor der Verabschiedung der Sozialistengesetze Ende Juli 1878 hatte die SAP im Reichstag 7,6% der Wählerstimmen, drei Reichstagswahlen später waren sie auf 10,1% angewachsen. Nach der Ablehnung der Verlängerung des Gesetzes im Januar 1890 erreicht die Sozialdemokratie bei den Wahlen im Februar mit 19,7% den höchsten prozentualen Stimmenanteil aller Parteien im Reichstag. Schieder dazu: „Die bereits unter dem Sozialistengesetz anhebenden Erfolge in den Reichstagswahlen sprachen eher dafür, die auf Gewinnung der parlamentarischen Mehrheit zielende Politik fortzusetzen." Schieder, S. 217.
[61] Siehe Anm. 56, S. 12.
[62] Stern, S. XXIII.
[63] Ebd, S. XXV. Brandis spricht von „der Aufnahme zahlreicher Akademiker in die Organisation" Brandis, S. 34.
[64] Ebd, S. XXIII. Brandis sieht nicht politisches Kalkül oder den Zustrom von kompromissbereiteren Kräften in die Partei als Gründe für die Partei-Auflösung, sondern in erster Linie wirtschaftliche Umstände: „Die schlechte Lage auf dem Arbeitsmarkt, niedrige Löhne und Arbeitslosigkeit lähmten die Widerstandskraft der breiten Massen. Nur so wurde die völlige Kapitulation der Sozialdemokratie vor dem Ausnahmegesetz und die Selbstauflösung der Partei im ersten Jahre des Sozialistengesetzes möglich." Brandis, S. 10.
[65] Ebenfalls zitiert aus der Reichstagsrede Bismarcks 1878 (s.o.): Bismarck hatte die zwei missglückten Attentate auf Kaiser Wilhelm I. im Mai und Juni 1878 der Sozialdemokratie untergeschoben. Die Forschung ist sich in beiden Fällen einig, dass die Täter nicht der Sozialdemokratie zuzuweisen waren; der eine, der zwanzigjährige Klempnergeselle Max Hödel war erst wenige Tage zuvor aus der Partei ausgeschlossen worden, eine scheinbar verwirrte Seele und, laut Pack an Syphilis erkrankt; der andere, der zehn Jahre ältere Dr. Karl Nobiling, war nie Mitglied der Partei gewesen, stand wohl eher den Nationalliberalen nahe. Für Mehring ist er gar ein „nationalliberaler Sozialistentödter", Mehring, S. 397.
[66] „Alptraum der Koalitionen": Bismarcks außenpolitische Schreckensvision; eine gegen das junge Deutsche Reich gerichtete Koalition europäischer Großmächte.
[67] Schieder, Wolfgang. Bismarck und der Sozialismus, in: Kunisch, Johannes (Hg.) Bismarck und seine Zeit. Berlin 1992, S. 184.
[68] Seit dem 8.Mai 1851 ist Bismarck Geheimer Legationsrat und Rat bei der preußischen Gesandtschaft am Bundestag in Frankfurt am Main.
[69] Otto Theodor von Manteuffel (1805-1882), preußischer Ministerpräsident 1815-1858.
[70] In seiner Reichstagsrede vom 17.9.1878 scheint eine ähnliche Argumentation durch, wenn er behauptet, die sozialistische Gefahr mittels der Bebel-Rede 1871 erkannt zu haben und von da versucht habe mit „verschiedenen Akten der Gesetzgebung" gegenzusteuern und am Reichstag damit gescheitert sei. Gall/Reden, S. 186-187.
[71] Petersdorff, Herman von. Bismarck. Die gesammelten Werke. Berlin, 1924, S.78.
[72] Ebd. S. 20.
[73] Bismarck schlägt hier unter Umgehung des Bundestages als Entscheidungsinstanz ein überraschendes und dadurch womöglich erfolgreicheres Vorgehen vor,: „Man müßte die Maßregel vor Tagesanbruch nehmen, gleichzeitig die Häuser, in denen man Personen und Gegenstände vermuthe, militärisch besetzen und durchsuchen, damit der Schlag vollkommen unerwartet käme." Ebd. S. 29.
[74] Ebd. S. 30. Dieselbe Argumentation in seiner Reichstagsrede am 17.9.1878: „...und von diesem Augenblick an habe ich in den sozialdemokratischen Elementen einen Feind erkannt, gegen den der Staat, die Gesellschaft sich im Stande der Notwehr befindet." Gall/Reden, S. 186.
[75] Petersdorf, S. 29
[76] Ebd. S. 30. §11 des Sozialistengesetzes zielt direkt gegen die „rothe Presse": „Druckschriften, in welchen sozialdemokratische, sozialistische oder kommunistische auf den Umsturz der bestehenden Staats- oder Gesellschaftsordnung gerichtete Bestrebungen in einer den öffentlichen Frieden, insbesondere die Eintracht der Bevölkerungsklassen gefährdenden Weise zu Tage treten, sind zu verbieten." Döring/Kempen, S. 121.
[77] Ebd. § 28 des Sozialistengesetzes betrifft den sog. „kleinen Belagerungszustand", der bis zu einem Jahr über bestimmte Bezirke und Ortschaften verhängt werden kann. In diesen Zonen ist, laut dem Gesetz „.der Besitz, das Tragen, die Einführung und der Verkauf von Waffen verboten".
[78] Tenfelde, S. 6.
[79] Ebd. S. 23.
[80] Zeit nach der Revolution von 1848 bis zum Beginn der „Neuen Ära", eingeläutet durch den Regierungsantritt Wilhelm I. im Jahre 1858.
[81] Tenfelde, S. 5. Das Recht, sich gewerkschaftlich organisieren zu dürfen (Koalitionsfreiheit) und das allgemeine Wahlrecht, beides ab 1869 in Preußen gewährt, seien zwei genannte Beispiele dafür von Tenfelde.
[82] U.a. bedingt durch den wachsenden Einfluss der Eisenacher in der Bewegung und deren klare Positionierung gegen Vorgehen und Politik Bismarcks und die des Reichs, wie die Ablehnung der Kriegskredite für den dt.-frz. Krieg 1870/1, die Ablehnung der Annexion Elsaß-Lothringens und die Haltung zur Pariser Kommune.
[83] Als Höhepunkt einer langen Periode versuchter Gesetzesverschärfungen: u.a. scheiterten am Parlament,
1873 die Kontraktbruchvorlage (Versuch der strafrechtlichen, nicht zivilrechtlichen Ahndung bei Arbeitsniederlegung wegen Streik = Bruch des Arbeitsvertrages) und 1875/76 der Sozialistenparagraph (auf die Sozialisten ausgerichteter Hochverratsparagraph).
[84] Verschiedene von Bismarck ausgehende und durchgesetzte Versicherungen zur Verbesserung des „Loses der Arbeiter": 1883 Krankenversicherung; 1884 Unfallversicherung; 1889 Alters- und Invalidenversicherung. Diese Strategie Bismarcks wird im Allgemeinen als „Zuckerbrot und Peitsche" bezeichnet. W. Schieder sieht auch im vermeintlichen Zuckerbrot Bismarcks „eine direkte bürokratische Kontrolle der Arbeiter": „Auch die Sozialpolitik sollte nach seiner Vorstellung in verdeckter Form Elemente der politischen Repression enthalten, wie sie in dem „Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie offen zutage traten." W. Schieder, S. 180-181.
[85] Siehe Anm. 4, diese Arbeit. „Es lässt sich hingegen darüber streiten, ob nicht jenes „Pulverfass" seit vormärzlichen Zeiten stets aufs Neue vor allem in den Köpfen der regierenden Eliten geboren worden, in den nachweislichen Entwicklungen dagegen sehr randständig geblieben ist." Tenfelde, S. 8. Gall spricht dagegen davon, dass Bismarck eine Art Riecher für die damalige Situation gehabt hätte: „Daß die sozialen Probleme einer Gesellschaft im Übergang von den traditionellen, wesentlich agrarischen Verhältnissen zu einer modernen kapitalistischen Industrie- und Verkehrswirtschaft eine Art Pulverfaß darstellten, hat Bismarck sehr viel früher erkannt als die große Mehrzahl seiner liberalen Zeitgenossen..." Gall/Reden, S. 168.
[86] Tenfelde, S. 8. Denen wohl auch noch keine Arbeitermassen in diesem Sinne „zur Verfügung standen": siehe Pkt. 1.1., diese Arbeit.
[87] Bei Pack der Kanzler hingegen ganz nüchtern: „Er wußte, daß die Sozialdemokratie, allein und auf sich gestellt, vorläufig keine genügend große Macht besitzen würde, um die Staats- und Gesellschaftsformen mit Gewalt stürzen zu können." Pack, S. 9.
[88] Eine angestrebte internationale Allianz gegen die von der I. Internationale in London (1864 dort von Karl Marx u.a. gegründet) ausgehenden sozialistischen Internationalisierungsbestrebungen. Laut Pack sah Bismarck diese als „Befehlszentrale" einer möglichen internationalen Allianz von „Republikanern anderer Länder und den außenpolitischen Gegnern Deutschlands", deren Ziel es war, „im Zusammenwirken von äußerem und innerem Ansturm das Reich zu vernichten." Pack, S. 9-10. Bei Pack wird so aus der Furcht vor den Sozialisten im eigenen Land, eine Furcht vor dem Bündnis dieser mit Sozialisten anderer Länder.
[89] Die scheinbar faktisch ergebnislose, aber wirkmächtige preußisch-österreichische Konferenz zur sozialen Frage im November 1872: „Die Tagung blieb ohne konkretes Ergebnis, aber die Grundlinie, Unterdrückung der sozialistischen Arbeiterbewegungen und sozialpolitische Maßnahmen, war festgezimmert." Tenfelde, S. 13.
[90] Tenfelde, S. 17.
[91] Ebd.
[92] In diesem Zusammenhang sei wohl das bekannte Zitat gefallen: „Wenn ich nicht staatsstreichere, setze ich nichts durch." Siehe Tenfelde, S. 17 Anm. 42.
[93] Die Bismarck'schen Versicherungen sollten durch Staatszuschüsse finanziert bzw. kofinanziert werden.
[94] Tenfelde, S. 21.
[95] Für Tenfelde beginnt die „intensivere Beschäftigung mit der sozialen Frage" nach Bismarcks Antritt als preußischer Ministerpräsident 1862, verschiedene Unterredungen bzw. Schreiben an den preußischen Innenminister Eulenburg, Handelsminister Itzenplitz und Finanzminister von Bodelschwingh in den 60ern lassen ihn das behaupten. Siehe KT 6-7. Für Plumpe ist es nicht in erster Linie eine „Revolutions-prophylaktische" Motivation hinter Bismarks Sozialpolitik, sondern ganz einfach ein „ökonomisch-technischer" bzw. pragmatischer Grund, nämlich das Stützen der kapitalistischen Wirtschaft im Reich durch die Sicherung der Erwerbsfähigkeit der Arbeiter. In diesem Sinne sieht Plumpe Bismarck dann auch als einen „modernen" Politiker. Siehe Plumpe, Werner. Otto von Bismarck und die soziale Frage, in: Mayer, Tilman (Hg.) Bismarck: Der Monolith, Hamburg 2015, S. 197.
[96] Pack, S. 10.
[97] Tenfelde, S. 12.
[98] Ebd.
[99] Gall/Reden, S. 178.
[100] Ebd.
[101] Ebd., S. 182. „...durch den Meinungszwang und die Tendenzpolitik ihrer Arbeitgeber außer Brot gekommen..."
[102] Die Verbesserung des Schicksals der Arbeiter „von oben" ist ein durchgängiges Motiv Bismarcks in der Rede: „.„.das Los des Arbeiters, seinen Anteil an dem Lohn, den die Gesamtheit, seine und seiner Arbeitgeber Tätigkeit hat, zu verbessern." Ebd. S. 171; „.mir schien es, daß in der Herstellung von Produktivassoziationen, wie sie in England im blühenden Verhältnisse existieren, die Möglichkeit lag, das Schicksal des Arbeiters zu verbessern." Ebd. S. 182; „.auch in der Beschäftigung der Menschen und in dem Bestreben, die sogenannte sozialdemokratische, ich will lieber sagen: soziale Frage durch Verbesserung des Loses der Arbeiter zu lösen." Ebd. S. 183; dem Arbeiter zu einer besseren Existenz zu verhelfen,.", „Staatshilfe" Ebd. S. 184;
[103] Ebd. S. 177
[104] „Niederreißen alles dessen, was besteht, was uns teuer ist und schützt..." Ebd. S. 178
[105] Bismarck ist sich sicher, dass auf den Umsturz die Tyrannei folgt. Er spricht von einem „sozialistischen Zuchthaus", „wo keiner seinen selbständigen Beruf und seine Unabhängigkeit hat". Ebd. S. 179. Tenfelde zitiert dazu Bismarcks Gedanken und Erinnerungen: „Jedes große staatliche Gemeinwesen, in welchem der vorsichtige und hemmende Einfluss der Besitzenden materiellen und intelligenten Ursprunges, verloren geht, wird immer in eine der Entwicklung der ersten französischen Revolution ähnliche, den Staatswagen zerbrechende Geschwindigkeit geraten." Komme es laut Tenfelde zu „dieser Zertrümmerung, vulgo Revolution" so werde nach Bismarck, „der geschichtliche Kreislauf immer in verhältnismäßig kurzer Zeit zur Diktatur, zur Gewaltherrschaft, zum Absolutismus zurückführen.". Tenfelde, S. 22. Bismarck scheint hier den unvermeidlichen Rückfall in die Tyrannei verhindern zu wollen, der sich kurze Zeit nach einem Umsturz einstellen würde. Basiert sein Denken in diesem Fall auf der platonischen Staatsidee? Im achten Buch der Politela von Platon unterhalten sich Sokrates und Adeimantos über die unterschiedlichen Staatsformen, die auseinander hervorgehen sollen: „(S) Es schlägt ja tatsächlich in der Regel jede Übertreibung in das Gegenteil um, in den Jahreszeiten, bei den Pflanzen und Körpern und nicht zum wenigsten bei den Verfassungen." - „(A) Es scheint so!" - „(S) Denn ein Übermaß von Freiheit schlägt beim einzelnen wie beim Staat in ein Übermaß von Knechtschaft um." - „(A) Mit Recht!" - „(S) Und mit Recht entsteht somit, denke ich, die Tyrannis aus keiner anderen Verfassung als aus der Demokratie, aus der höchsten Freiheit die tiefste und härteste Knechtschaft." Vretska, Karl. Platon, Der Staat, Stuttgart 2000, Abschnitt 564a. Tenfelde bezeichnet diese Motivation für Bismarcks Sozialistengesetze als „geschichtsverzögernd", er bewahre die Massen durch seinen gewissermaßen kurzen Eingriff in die Geschichte vor sich selbst! Tenfelde, S. 22.
[106] „Ein positives Verhältnis zu ihnen hat er nie finden können und die berechtigten Seiten der Bewegung stets verkannt, weil er keinerlei geistige Gemeinschaft mit der Industriearbeiterschaft besaß. Er betrachtete die Sozialisten als persönliche Feinde, die er verachtete und die er offen und ohne falsches Mitleid bekämpfte." Pack sieht die verfassungspolitische, außen- und innenpolitische und religiös-sittliche Unvereinbarkeit der beiden Parteien als Gründe dafür an. Pack, S. 8.
[107] So W. Schieder: „Tatsächlich finden sich in seinen Reden und Schriften so gut wie keine Spuren, die auf eine Lektüre sozialistischer Autoren hinweisen. Während er sich auf Schriften von Victor Aimée Huber und von Karl Rodbertus explizit bezog, hat er wohl nicht einmal die theoretischen Schriften von Lassalle gelesen, geschweige denn die von Marx. Was die letzteren betrifft, so hat er sich im Reichstag sogar einmal gerühmt, sie nicht zu kennen." W. Schieder, S. 178.
[108] „So liefen all seine Überlegungen darauf hinaus, daß es das Beste sei, wenn diese Sozialisten möglichst rasch vom Erdboden verschwänden. In dem verhängnisvollen Irrtum befangen, die Sozialdemokratie bestehe nur aus einigen Berufsagitatoren und Unzufriedenen und besitze keinerlei nennenswerten Anhang im Volke, hielt er diese Aufgabe durchaus für lösbar." Pack, S. 10.
[109] Mit Wittwer beginnen die Strafverfolgungen nicht erst mit der Ära Tessendorf 1874, sondern beginnen bereits Ende 1871. Wittwer, Walter. Zur Politik des preußisch-deutschen Staates gegen die revolutionäre Arbeiterbewegung nach der Reichsgründung (1871-1878), in: Bartel, Horst/Engelberg, Ernst (Hg.) Die großpreußisch-militaristische Reichsgründung 1871, Band 11. Berlin 1971, S. 333-342.
[110] Ebd. S. 355.
[111] Für Wittwer geht es bei Bismarcks anti-sozialdemokratischen Maßnahmen weniger um die Vermeidung eines plötzlichen Umsturzes, als eher um das Unterbinden der einzig verbliebenen oppositionellen Kraft im Reich: „Im chauvinistischen Siegestaumel über die militärischen Erfolge und die Beendigung der Kleinstaaterei ging der letzte Rest ernsthafter bürgerlicher Opposition fast gänzlich verloren. Einziger gefährlicher und prinzipieller Gegner des junkerlich-bourgeoisen Bismarckstaates blieb die revolutionäre Arbeiterbewegung." Wittwer, S. 306.
[112] Wittwer, S. 312. Auch die Sozialpolitik Bismarcks diene lediglich „der Beseitigung des sozialistischen Einflusses in der Arbeiterbewegung." Ebd., S. 317.
[113] Mehring zitiert dazu ein Gedicht aus dem Vorwärts (gegr. 1876), der Zeitung der Bewegung: „Ein ganzes Volk in Haß und Wahn, Von tollem Grimm entstellt die Züge" Treffend wohl auch Mehrings Hinweis auf das „Epigramm" eines gewissen Guido Weiß in der Wage (gegr. 1848): „Der Kaiser hat die Wunden und die Nation das Wundfieber". Mehring, S. 397.
[114] Schieder sieht Bismarck hier in einer längeren Kette von Staatsmännern und Staatstheoretikern: „Bismarck stand hier durchaus in einer sehr konservativen, auf Metternich oder, wenn man will, auf Edmund Burke zurückgehenden Tradition gegenrevolutionärer Verschwörungstheorien." Ebd. Der Historiker sieht allerdings auch eine Entwicklung Bismarcks bezüglich dessen Umsturz-Phobie. So sei er wohl „jedoch allmählich selbst ein Opfer seiner Verfolgungsängste geworden, nachdem er von diesen anfangs nur aus propagandistischen Gründen gesprochen hatte." Zum Ende hin scheinen sich bei Bismarck die Angst vor und der persönliche Hass gegen die Sozialdemokratie derartig verbunden zu haben, dass er diese in verschiedenen Äußerungen mit Schädlingen gleichsetzte, die man „unschädlich" machen müsse. W. Schieder, S. 187.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema von "Der sozialistische Umsturz als Motiv für die Sozialistengesetze"?
Das Hauptthema ist die Untersuchung, inwieweit Bismarcks Motivation für die Sozialistengesetze von 1878 durch die Furcht vor einem sozialistischen Umsturz und dem vermeintlichen Umsturzwillen der Sozialdemokratie beeinflusst wurde.
Welche Rolle spielte die Solidarität mit der Pariser Kommune?
Die Solidaritätsbekundung des Abgeordneten Bebel mit der Pariser Kommune im Jahr 1871 wird als ein Auslöser für Bismarcks Besorgnis über mögliche Umsturzbestrebungen im Deutschen Reich genannt.
War die sozialistische Bewegung in Deutschland zu der Zeit umsturzbereit?
Die Arbeit untersucht, ob die Sozialisten einen gewaltsamen Umsturz beabsichtigten oder ob es sich lediglich um "revolutionären Verbalismus" handelte. Es wird argumentiert, dass die Bewegung zwar reformorientiert war, aber eine revolutionäre Rhetorik nutzte, um ihre Anhängerschaft zu erweitern.
Welche unterschiedlichen Strömungen gab es innerhalb der sozialistischen Bewegung?
Es gab verschiedene Strömungen, darunter die staatsbejahenden Lassalleaner und die marxistisch-international orientierten Eisenacher. Die Arbeit untersucht die unterschiedlichen Revolutionsansichten dieser Gruppen.
Wie grenzten sich die Sozialdemokraten von radikalen Strömungen ab?
Die Sozialdemokraten grenzten sich zunehmend von sozialrevolutionären, anarchistischen und nihilistischen Strömungen ab, um den legalen Weg der Politik zu beschreiten.
Hat Bismarck die Umsturzgefahr durch die Sozialisten überschätzt?
Die Arbeit deutet an, dass Bismarck die tatsächliche Umsturzbereitschaft und -fähigkeit der sozialistischen Bewegung möglicherweise überschätzt hat. Seine Furcht vor einem Umsturz könnte auf einem "Wissensdefizit" über die tatsächlichen sozialdemokratischen Zukunftsvorstellungen beruhen.
Welche Rolle spielten Bismarcks frühere Erfahrungen in Frankfurt?
Bismarcks Erfahrungen in Frankfurt am Main im Jahr 1851, wo er "das Frankfurter demokratische Treiben" als Bedrohung wahrnahm, werden als Hinweis auf seine frühe Furcht vor vom Volk ausgehenden Unruhen interpretiert.
Welche duale Strategie verfolgte Bismarck gegenüber der Sozialdemokratie?
Bismarck verfolgte eine duale Strategie aus Repression (Sozialistengesetze) und Integration (Sozialpolitik), um die Sozialdemokratie zu bekämpfen und gleichzeitig die Lage der Arbeiter zu verbessern.
Welche Rolle spielten die Attentate auf Kaiser Wilhelm I. bei der Verabschiedung der Sozialistengesetze?
Die Attentate auf Kaiser Wilhelm I. im Jahr 1878, die Bismarck der Sozialdemokratie unterstellte, führten zu einer emotionsgeladenen Volksstimmung, die die Verabschiedung der Sozialistengesetze ermöglichte.
Was war das Fazit der Arbeit?
Das Fazit ist, dass Bismarck tatsächlich einen "Alptraum der Revolutionen" träumte und die Sozialdemokraten als umsturzbereite Agitatoren wahrnahm. Allerdings habe er Kampfbereitschaft und -fähigkeit der Massen und ihrer Organisation falsch eingeschätzt.
- Quote paper
- Maik Dornberger (Author), 2016, Der sozialistische Umsturz als Motiv für Bismarcks Sozialistengesetze, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/321603