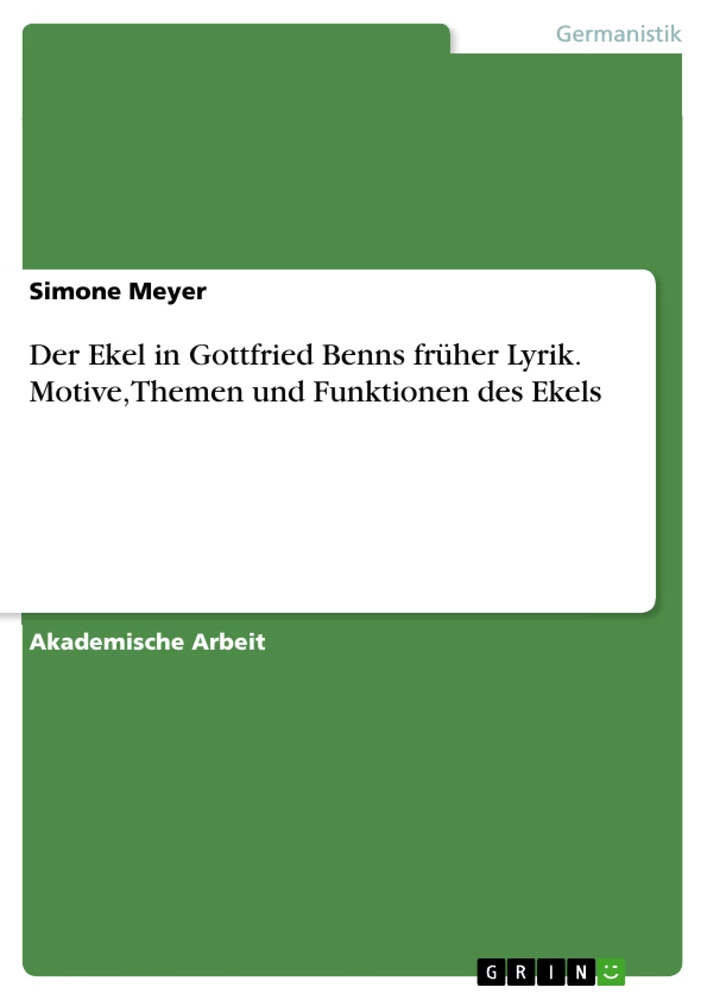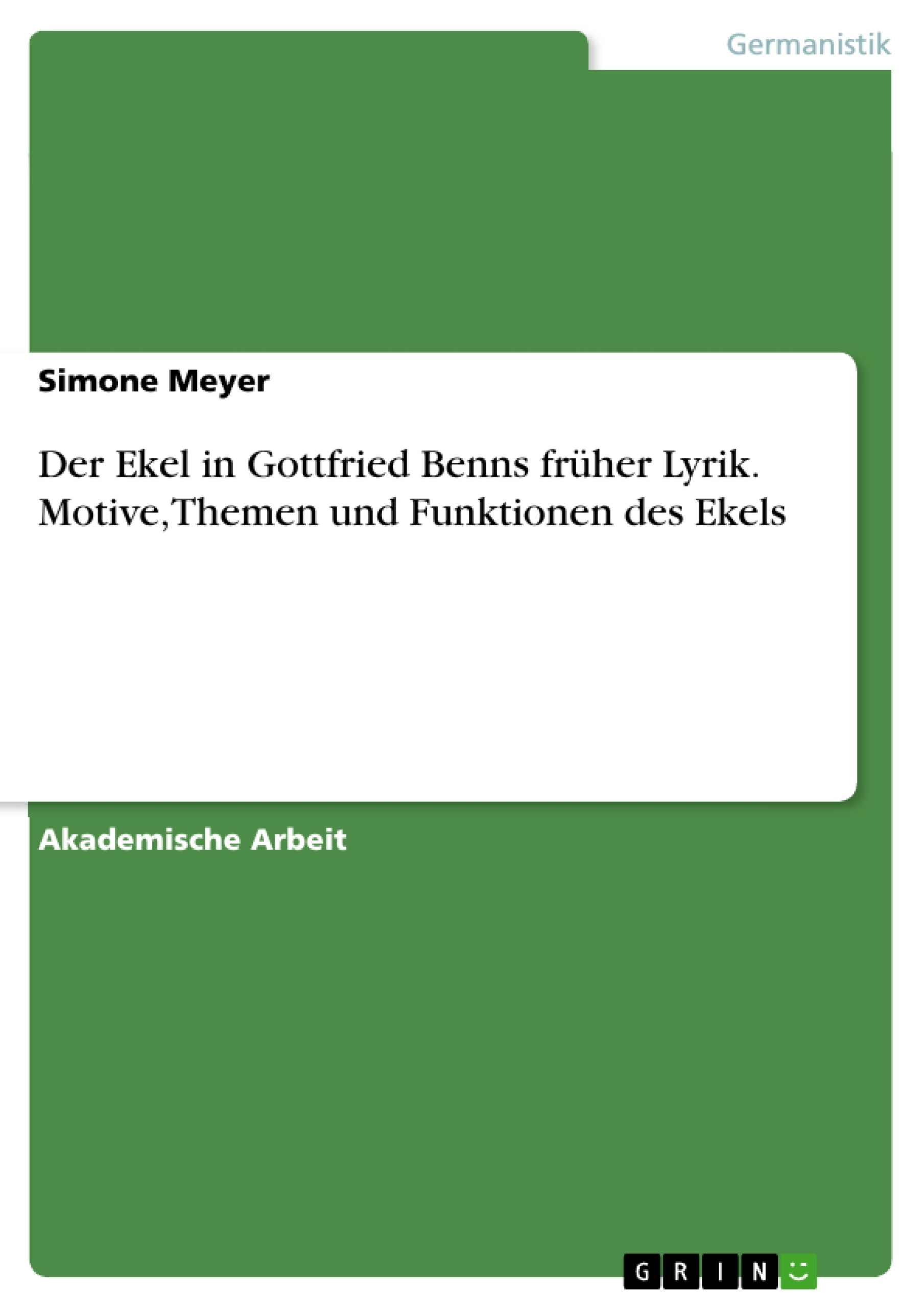Ziel dieser Arbeit ist es, darzustellen, wie Ekel sich in den frühen Gedichten Gottfried Benns manifestiert. Der Autor analysiert und erläutert am Beispiel des Morgue-Zyklus und anderer früher Gedichte die Motive, Themen und die Funktionen des Ekels in Benns Dichtungen. Dabei werden die dominanten Faktoren herausgearbeitet, die die Hinwendung des Autors zum Ekel und dessen Darstellung in den frühen Gedichten bedingten und beeinflussten. Das Augenmerk liegt dabei auf der Frage, ob Benn einer bestimmten theoretischen Strömung folgt und, ob er von einer der dargestellten Geistesströmungen, einem literarischen Werk oder einem der Autoren nachhaltig beeinflusst wurde.
Die unzähligen Fernsehsendungen über Morde, Autopsien und gewalttätige Psychopathen zeugen davon, dass das Interesse am Ekel gegenüber Tod, Gewalt und Leichen vorhanden ist. Millionen von Menschen schauen täglich an den Bildschirmen zu, wie andere ermordet und seziert, wie sie aufgeschnitten und analysiert werden. Im Gegensatz zur Realität schauen sie aber nicht weg, sondern bleiben gebannt vor dem Geschehen sitzen.
Die Lust an der Abscheulichkeit des Ekels ist demnach nicht zu leugnen und sie ist schon so alt wie die Menschheit selbst. Als es weder Film noch Foto gab, begnügten sich die Menschen mit der Literatur und ebenso, wie wir heute Sendungen verfolgen, die in uns das abscheuliche Gefühl hervorrufen, lasen die Menschen damals Texte, Dramen und Gedichte.
In jeder Epoche sind Darstellungen des Hässlichen, des Verfalls, des Todes und des Ekels in der Literatur und der bildenden Kunst zu finden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aas, Blut und Sektion – die Morgue.
- Worte des Ekels - Wortwahl und Symbolik in Benns frühen Gedichten.
- Menschliches Sein und Verderben.
- Geschlechtlichkeit und Geburt
- Nahrung, Ernährung ..
- Personen, Dinge und Tiere.
- Soziale Aspekte ......
- Religiöse Elemente
- Schönes..\li>
- Medizinisches.
- Sonstige Aspekte.
- Einfluss der Historie...
- Der Gegensatz zur ästhetischen Theorie
- Benn als Gegner der klassischen Anti-Ekelideale
- Schöne – hässliche Körper - tote Statuen..
- Romantik und die Ästhetik des Hässlichen..
- Nachwirkungen des Naturalismus.........
- Typische Erscheinung des Expressionismus oder Leidender des Fin de Siècle ? ...
- Benn und die dekadente Gefühlslage.
- Benn in der Tradition Baudelaires?.
- Wahrnehmungsproblematik und Weltbild im Frühexpressionismus
- Nihilistische Einflüsse im Expressionismus
- Entpersonifizierung und Verdinglichung des Menschen
- Ergebnis und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Manifestation von Ekel in Gottfried Benns früher Lyrik, insbesondere im Morgue-Zyklus und anderen frühen Gedichten. Sie analysiert die Motive, Themen und Funktionen des Ekels in Benns Dichtungen und untersucht die Faktoren, die Benns Hinwendung zum Ekel und dessen Darstellung beeinflusst haben. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Benn einer bestimmten theoretischen Strömung folgt und von einer der dargestellten Geistesströmungen, einem literarischen Werk oder einem Autor nachhaltig beeinflusst wurde.
- Analyse der Motiv- und Themenlandschaft des Ekels in Benns frühen Gedichten
- Untersuchung der Funktionen des Ekels in Benns Lyrik
- Bedeutung des Morgue-Zyklus für die Darstellung des Ekels
- Einordnung von Benns Ekel-Dichtung in literarische und theoretische Strömungen
- Analyse des Einflusses von historischen, ästhetischen und philosophischen Strömungen auf Benns Lyrik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Ekel als menschliche Emotion und ästhetisches Phänomen ein und zeigt auf, wie das Interesse am Ekel in verschiedenen Epochen und Kulturen zum Ausdruck kommt. Die Arbeit stellt die Zielsetzung und Themenschwerpunkte dar.
Das erste Kapitel analysiert die Wortwahl und Symbolik in Benns frühen Gedichten, die den Ekel ausdrücken. Es untersucht die Verwendung von Begriffen wie Aas, Blut und Sektion im Kontext von menschlichem Sein und Verderben, Geschlechtlichkeit und Geburt, Nahrung, Ernährung, Personen, Dingen und Tieren, sozialen Aspekten, religiösen Elementen, Schönheit, Medizin und weiteren Aspekten.
Das zweite Kapitel beleuchtet den Einfluss der Historie auf Benns Ekel-Dichtung. Es analysiert den Gegensatz zur ästhetischen Theorie, Benns Position als Gegner der klassischen Anti-Ekelideale, die Rolle der Romantik und der Ästhetik des Hässlichen sowie die Nachwirkungen des Naturalismus.
Das dritte Kapitel diskutiert, ob Benns Lyrik als typische Erscheinung des Expressionismus oder als Ausdruck der dekadenten Gefühlslage des Fin de Siècle anzusehen ist. Es untersucht Benns Verbindung zur Tradition Baudelaires, die Wahrnehmungsproblematik und das Weltbild im Frühexpressionismus sowie die Rolle nihilistischer Einflüsse und die Entpersonifizierung und Verdinglichung des Menschen.
Schlüsselwörter
Ekel, Gottfried Benn, Frühe Lyrik, Morgue-Zyklus, Motive, Themen, Funktionen, Wortwahl, Symbolik, Menschliches Sein, Verderben, Geschlechtlichkeit, Geburt, Nahrung, Ernährung, Soziale Aspekte, Religiöse Elemente, Schönheit, Medizin, Historie, Ästhetik, Anti-Ekelideale, Romantik, Naturalismus, Expressionismus, Dekadenz, Wahrnehmungsproblematik, Weltbild, Nihilismus, Entpersonifizierung, Verdinglichung.
- Quote paper
- Simone Meyer (Author), 2003, Der Ekel in Gottfried Benns früher Lyrik. Motive, Themen und Funktionen des Ekels, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/321572