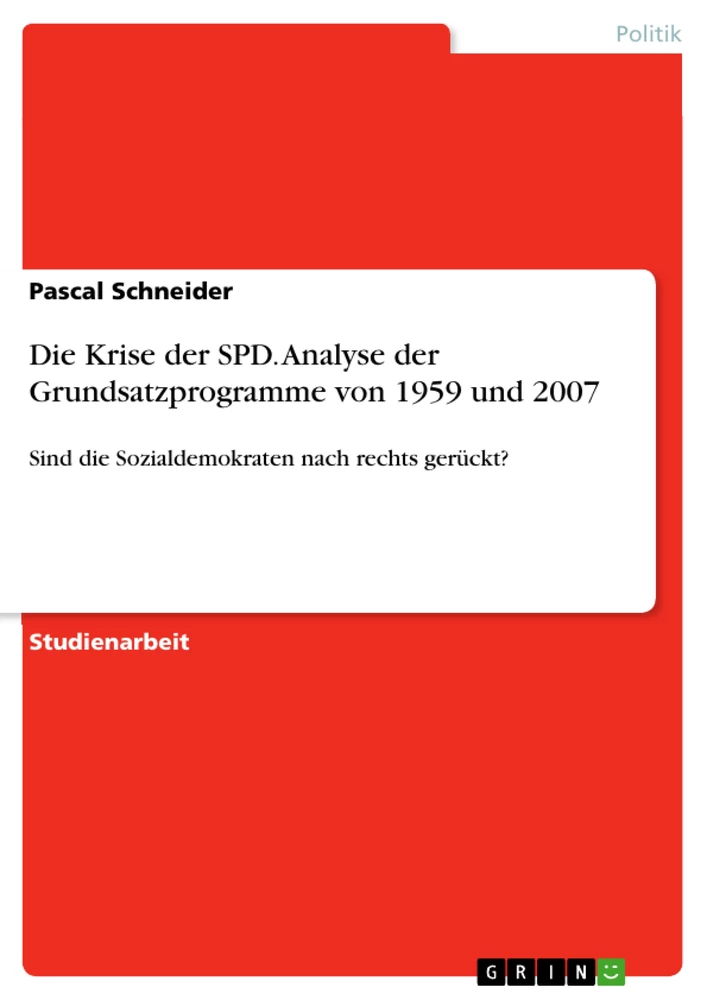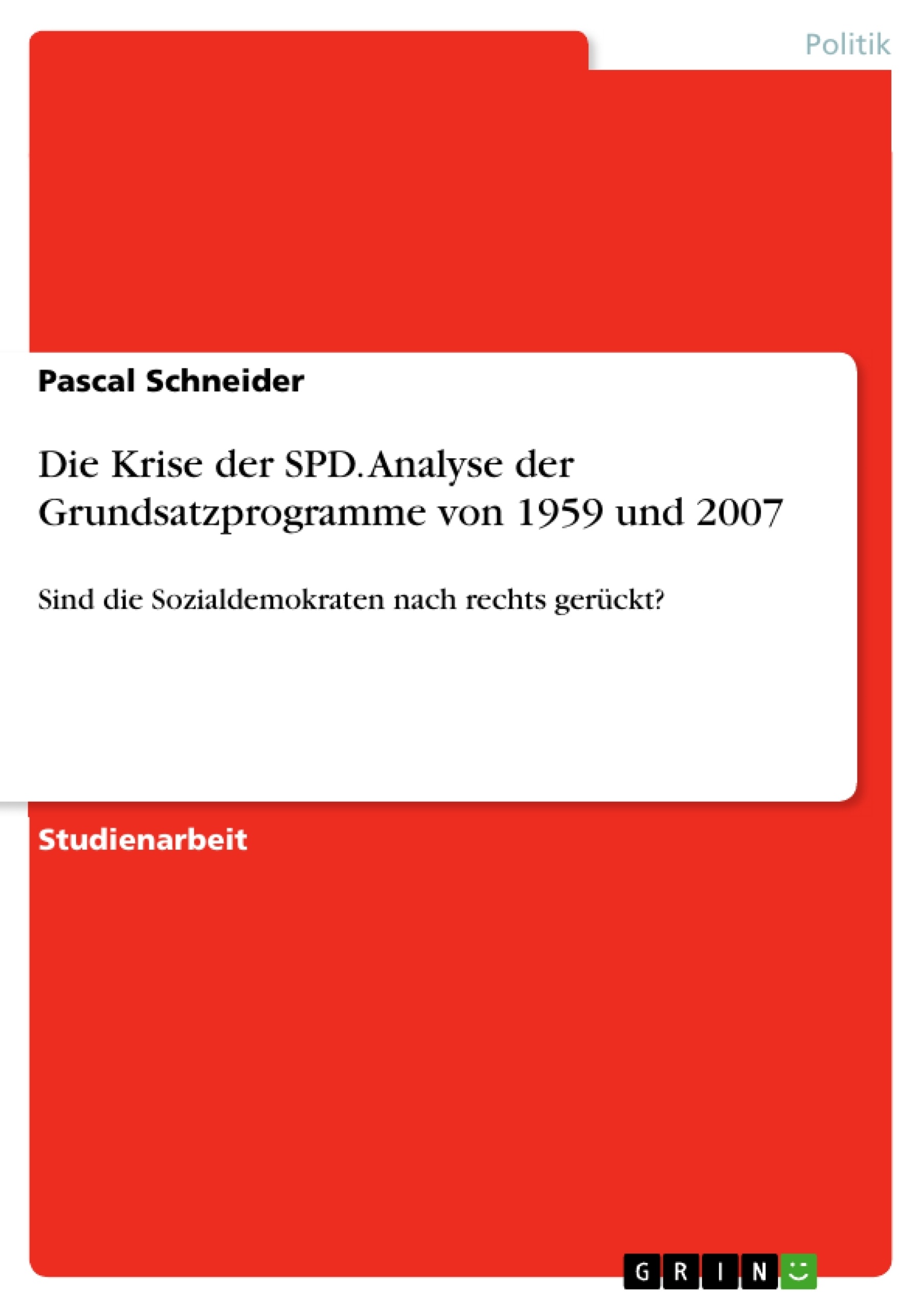Diese Arbeit soll die Frage beantworten, worin die Gründe für die Krise der SPD bestehen und ob die Partei nach rechts gerückt ist.
Bei den Landtagswahlen am 13. März 2016 in den Bindestrich-Ländern wurde es kürzlich deutlich: Die SPD verliert an Zustimmung. Der Trend des Rückgangs an Wählerstimmen ist nicht neu: Spätestens seit der Bundestagswahl 2009 müssen sich die Sozialdemokraten Sorgen um ihre Zustimmungswerte in der Wählerschaft machen. Lange Zeit war die SPD fast gleichauf mit der CDU bei knapp 40 Prozent der Zweitstimmen bundesweit (Bundestag). Nach dem vorzeitigen Ende von Rot-Grün unter Gerhard Schröder und mit Angela Merkel als neuer Kanzlerin fällt die SPD auf nun unter 25 Prozent in den Sonntagsfragen (Wahlrecht.de).
Auf Landesebene ist das Bild noch brisanter: In Sachsen-Anhalt konnte die SPD gerade einmal 10,6 Prozent der Wähler überzeugen, mit einem Rückgang von 10,9 Prozent im Vergleich zur vorhergehenden Landtagswahl in 2011 (Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt). Die baden-württembergische SPD schaffte es auf nur 12,7 Prozent - 2011 waren es mit 23,1 Prozent 10,4 Prozent mehr (Statistisches Landesamt Baden-Württemberg). Nur in Rheinland-Pfalz konnte die SPD mit 36,2 Prozent um ein halbes Prozent zulegen (Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz: 11).
Das Halten ihres Wahlergebnisses lässt sich hier mit dem stark auf die Spitzenkandidaten Malu Dreyer (SPD) und Julia Klöckner (CDU) fixierten Wahlkampf begründen. Sicher, der Erfolg der Alternative für Deutschland (AfD) beim Werben um Wählerstimmen in der aktuell aufgeheizten Stimmung rund um die Flüchtlingsdebatte spielte eine Rolle in der Stimmenverteilung. Doch die Forderungen der AfD sind wohl kaum eine wirkliche Alternative für die eigentlich soziale, anti-nationalistische Politik der SPD.
Inhaltsverzeichnis
- I. Forschungsproblem
- 1. Wählerschwund der SPD
- 2. Die Agenda 2010 – neoliberale Politik unter Rot-Grün
- II. Forschungsfrage
- 3. Wie ist die Krise der SPD zu erklären?
- III. Theorie, Eingrenzung und These
- 4. Wirtschaftspolitik – historisch und aktuell
- 5. Identitätsverlust der SPD? Cleavages und Linkages
- 6. Ein Rechtsruck der Sozialdemokraten? Arbeitsthese
- IV. Analytischer Teil
- 7. Methode
- 8. Das Godesberger Programm von 1959
- 9. Das Hamburger Programm von 2007
- 10. Differenzen in der Wirtschaftspolitik
- V. Fazit und Ausblick
- 11. Die SPD - eine sozialdemokratische Partei?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Krise der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD). Sie analysiert die Ursachen des Wählerschwunds der SPD und untersucht, ob die Partei nach rechts gerückt ist. Dabei wird die Wirtschaftspolitik der SPD im Fokus stehen, insbesondere im Vergleich des Godesberger Programms von 1959 mit dem Hamburger Programm von 2007.
- Wählerschwund der SPD
- Die Agenda 2010 und ihre Auswirkungen auf die SPD
- Veränderungen in der Wirtschaftspolitik der SPD
- Identitätsverlust der SPD
- Die Rolle der SPD in der sozialen Spaltung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel I beleuchtet den Wählerschwund der SPD, der sich insbesondere seit der Bundestagswahl 2009 verstärkt hat. Die Agenda 2010, eine neoliberale Reform des Sozialsystems, wird als eine mögliche Ursache für den Vertrauensverlust der Wähler diskutiert. Kapitel II stellt die Forschungsfrage nach den Ursachen der Krise der SPD. Kapitel III präsentiert die theoretischen Grundlagen und eine These zur weiteren Bearbeitung der Forschungsfrage. Kapitel IV analysiert die Wirtschaftspolitik der SPD anhand des Godesberger Programms von 1959 und des Hamburger Programms von 2007. Kapitel V fasst die Ergebnisse zusammen und bietet einen Ausblick auf weitere Forschungsfelder.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen SPD, Wählerschwund, Agenda 2010, Wirtschaftspolitik, Godesberger Programm, Hamburger Programm, soziale Spaltung, Identitätsverlust, Links-Rechts-Spektrum.
- Quote paper
- Pascal Schneider (Author), 2016, Die Krise der SPD. Analyse der Grundsatzprogramme von 1959 und 2007, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/321518