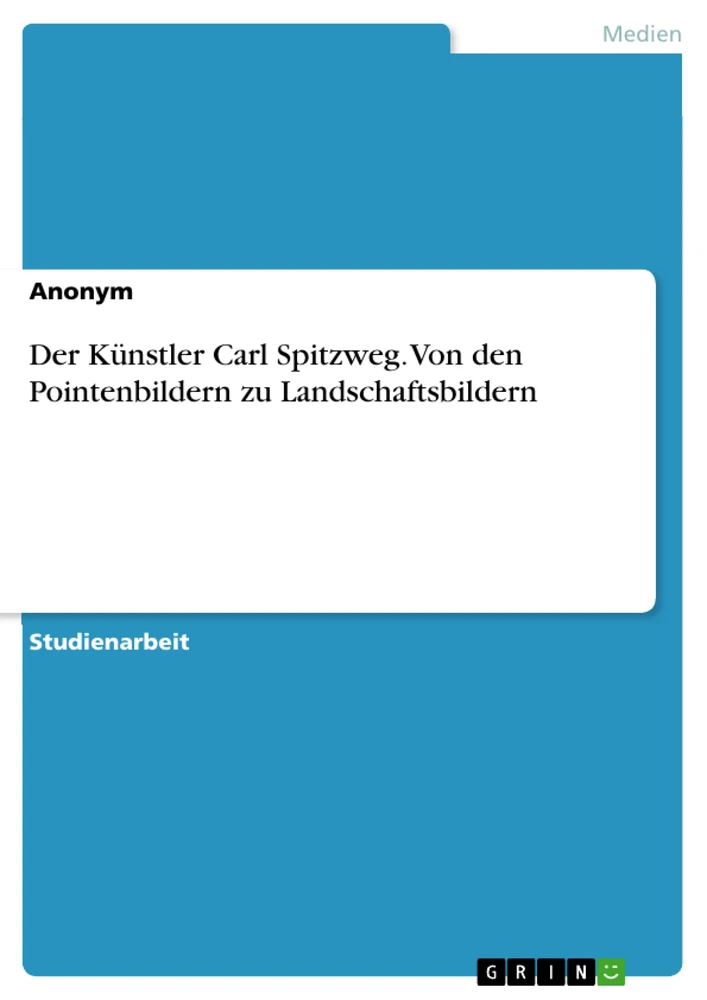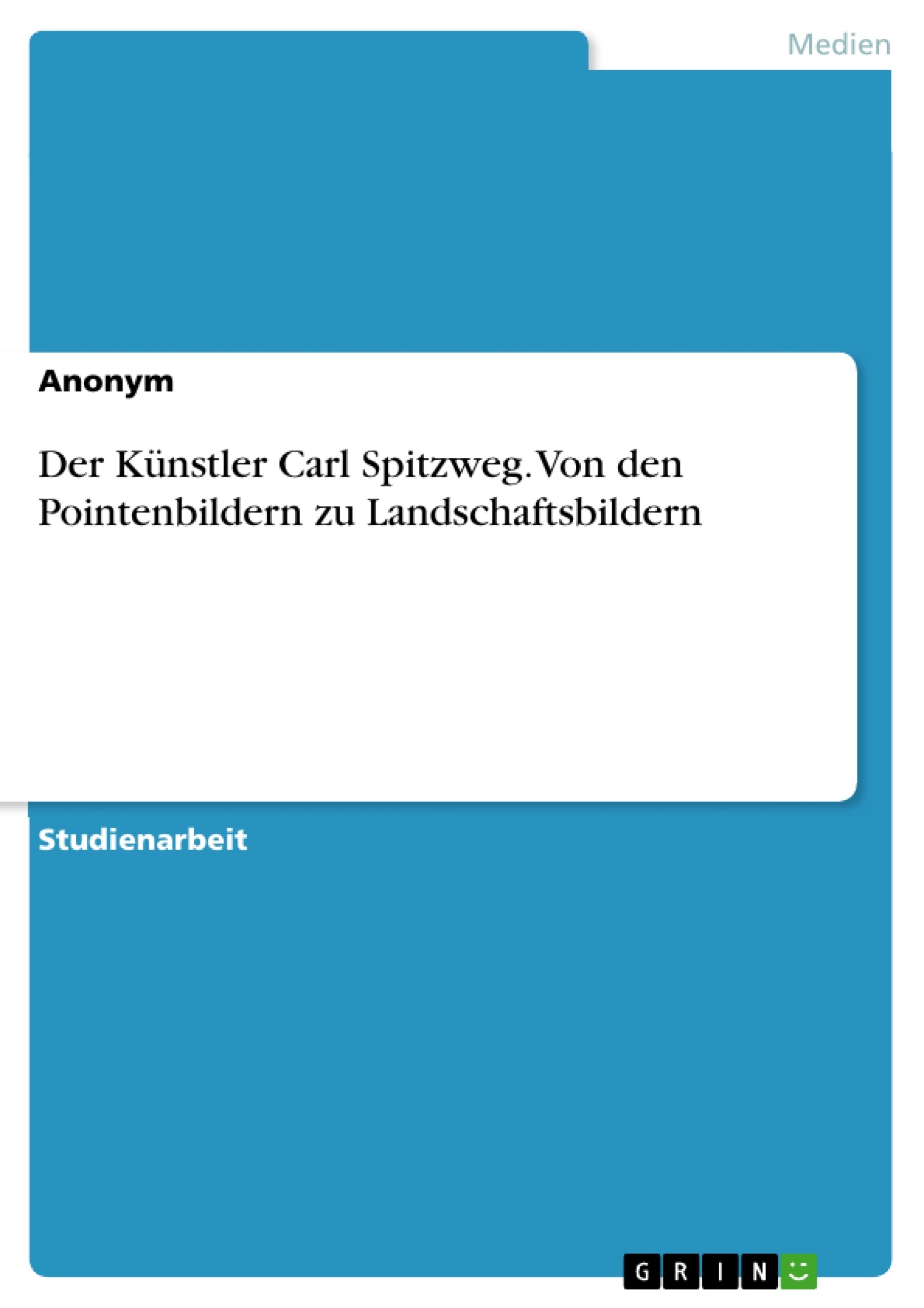Die Arbeit beschäftigt sich mit Spitzwegs Entwicklung von Pointenbildern zur landschaftlichen Idylle und die damit einhergehende Veränderung in seiner Malweise. Um den Verlauf deutlicher zu machen, wird als erstes Beispiel ein Bild gewählt, das noch wenige landschaftliche Elemente in sich trägt und zu den Pointenbildern gezählt werden kann: "Der Kaktusfreund". Es wird als Vergleich herangezogen, da bereits hier erste Anflüge einer Abwendung von den Pointenbildern zu erkennen ist. Somit kann eine Verbindung hergestellt werden zwischen Gemälden, in denen die Figuren als Hauptmotiv das Bild bestimmen und Gemälden, in denen die Figuren immer weiter in den Hintergrund rücken (z.B. Drachensteigen).
Carl Spitzwegs Bilder tragen etwas Bühnenhaftes in sich, denn er komponiert seine Bilder aus vielen einzelnen Objekten wie ein „Bühnenbildner“. Dabei legt er bei den meist kleinformatigen Werken besonderen Wert auf die Figuren. Er gestaltet die Bilder zu „Szenarien“, in denen er als „Regisseur“ tätig ist und das Bildpersonal agieren lässt, um so „kleine, witzige Stücke“ zu schaffen. Dabei ziehen sich bestimmte Motive durch all seine Bilder, so zum Beispiel auch der Alte im Schlafrock die Morgenzeitung lesend.
In der künstlerischen Entwicklung des Malers fällt jedoch auch auf, dass ca. ab den 1850er Jahren eine Veränderung in der Malweise einsetzt, die sich besonders auf die Landschaften niederschlägt. Spitzweg verändert den Schwerpunkt seiner Malerei dahingehend, dass er sich mehr und mehr von den Pointenbildern abwendet und Idyllen darstellt. Zudem nimmt die Landschaftsmalerei eine immer wichtiger werdende Rolle ein und die Figuren werden zunehmend zur Staffage, auch wenn er sich nie völlig von ihnen lösen kann. Seine Figuren sind um 1860 noch zeichnerisch in den Bildraum integriert, später werden sie malerisch eingebracht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Worte mit knappem Hintergrund zur künstlerischen Entwicklung Spitzwegs..
- Von den Pointenbildern über die Idyllen zu Landschaftsbildern..
- ,,Arkadien im Kleinformat\" in Der Kaktusfreund
- Spitzwegs Naturauffassung
- Drei Bildbeispiele auf dem Weg zur Landschaft.
- Badende Nymphe ........
- Das Liebespaar im Wald
- Auf der Alm.....
- Der Weg zur Staffage - Die Landschaft als tragendes Element..
- Abschliessende Betrachtung.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Ausarbeitung befasst sich mit Carl Spitzwegs Entwicklung von Pointenbildern zur landschaftlichen Idylle und der damit einhergehenden Veränderung in seiner Malweise. Der Fokus liegt auf der Analyse von Spitzwegs Bildern im Kontext der Landschaftsmalerei und der Darstellung von Idyllen in seinen Werken. Insbesondere wird untersucht, wie Spitzweg die Figuren in seinen Bildern immer mehr zur Staffage werden lässt und die Landschaft als tragendes Element in den Vordergrund rückt.
- Spitzwegs künstlerische Entwicklung und die Abwendung von Pointenbildern
- Die Rolle der Idylle in Spitzwegs Werken und ihre Verbindung zur realistischen Darstellung
- Der Einfluss der Landschaftsmalerei auf Spitzwegs Malweise
- Die Entwicklung der Figuren in Spitzwegs Bildern von Hauptmotiven zu Staffage
- Die Bedeutung von Spitzwegs Bildern als "kleine, witzige Stücke"
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt Spitzwegs künstlerische Entwicklung und seinen Wandel von Pointenbildern zu Idyllen dar. Sie beleuchtet seine einzigartige Art der Bildkomposition, bei der er seine Bilder wie ein „Bühnenbildner“ gestaltet und Figuren als „Bildpersonal“ agieren lässt. Es wird auch der Einfluss der Landschaftsmalerei auf Spitzwegs spätere Werke erwähnt.
- Der zweite Teil konzentriert sich auf die Entwicklung der Idylle in Spitzwegs Bildern. Es wird die „realistische Idylle“ als ein Spannungsfeld zwischen Realität und Utopie vorgestellt und Spitzwegs Bilder als „Paradiese im Kleinformat“ beschrieben.
- Im dritten Teil werden drei Bildbeispiele auf dem Weg zur Landschaft analysiert: „Badende Nymphe“, „Das Liebespaar im Wald“ und „Auf der Alm“. Diese Beispiele verdeutlichen Spitzwegs Entwicklung, wie er die Landschaft immer mehr in den Vordergrund stellt und die Figuren in den Hintergrund treten lässt.
- Der vierte Teil erläutert den Weg zur Staffage, bei der die Landschaft als tragendes Element in den Vordergrund tritt. Es wird gezeigt, wie Spitzweg die Figuren in seinen späteren Werken immer mehr als Beiwerk integriert und die Landschaft als Hauptthema seiner Malerei setzt.
Schlüsselwörter
Carl Spitzweg, Pointenbilder, Idylle, Landschaftsmalerei, Staffage, Realismus, Biedermeier, Locus amoenus, Natur, Figuren, Bildkomposition, künstlerische Entwicklung, Malweise.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2013, Der Künstler Carl Spitzweg. Von den Pointenbildern zu Landschaftsbildern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/321465