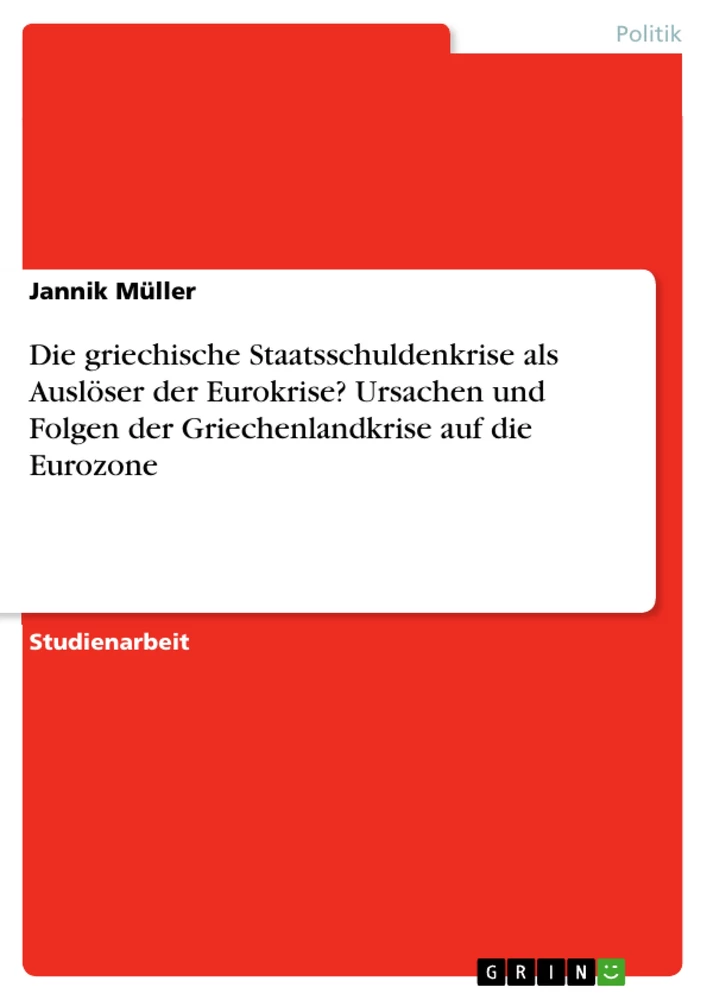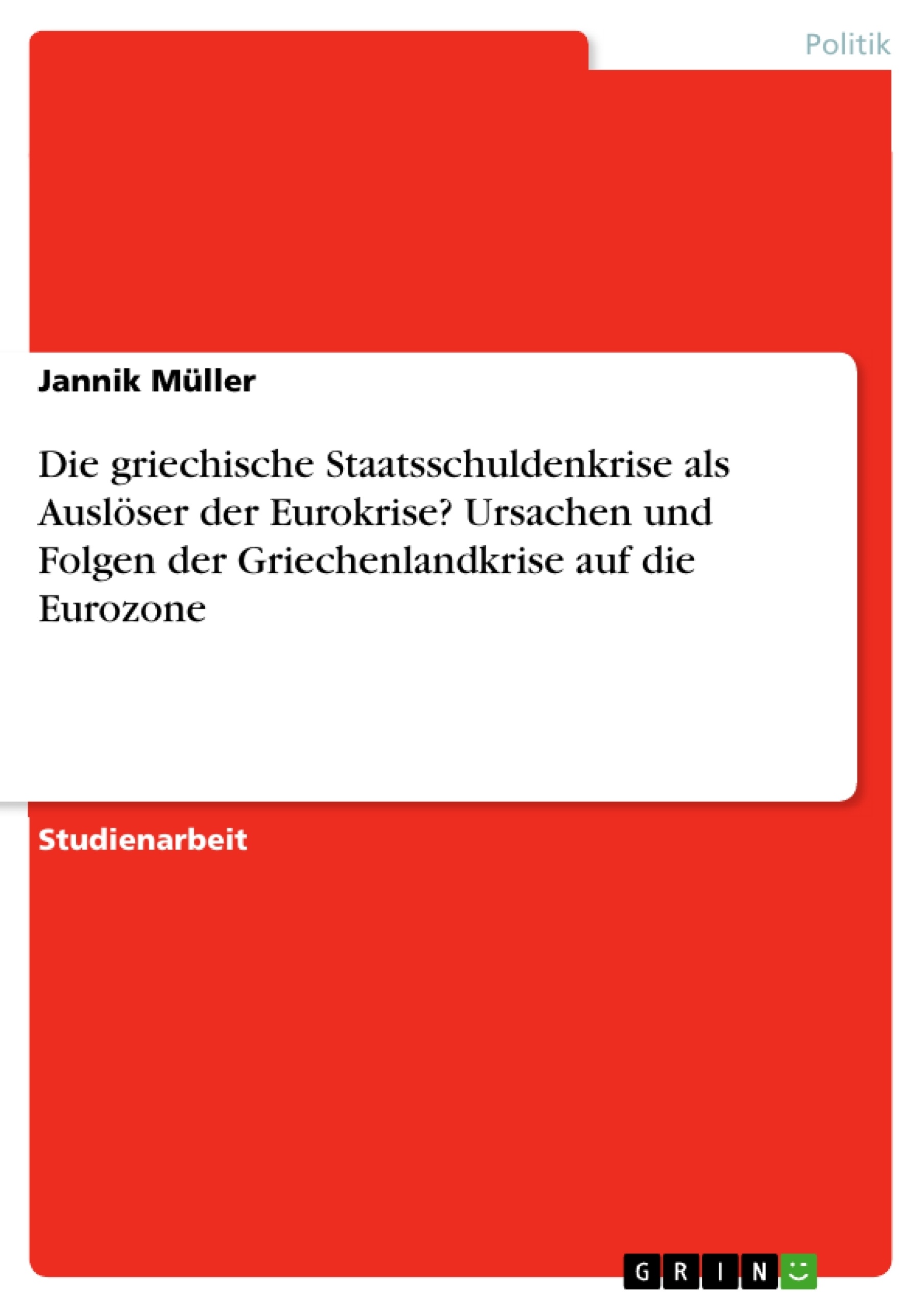Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Fragestellung, welchen Anteil der griechische Staatsbankrott am Ausbruch der Eurokrise hat. Hierbei werde ich beide Seiten der Medaille beleuchten, sprich sowohl den griechischen, als auch den europäischen Schuldanteil. Inwiefern können also endogene (zum Beispiel unsolide griechische Haushaltspolitik) beziehungsweise exogene Faktoren (zum Beispiel europäische Gewährungs- und Krisenpolitik) für die Eurokrise verantwortlich gemacht werden?
Um diese Frage zu beantworten, muss man sich zunächst die Ursachen der Griechenlandkrise (2) vergegenwärtigen. Hierbei kann man ebenfalls in exogene und endogene Faktoren des griechischen Bankrotts unterscheiden. Im Anschluss geht es darum, die Griechenlandkrise in den Kontext der Eurokrise zu stellen. Wie ist aus einer Staatsschuldenkrise eine Eurokrise geworden? (3) Das vierte Kapitel bewertet die griechischen Optionen sowie die europäische Krisenpolitik kritisch. Kann sich Griechenland selbst aus der Krise befreien oder ist es auf die Hilfe der Währungsunion angewiesen? Ferner geht es auch um die Frage, ob die Griechenland-Hilfe als erfolgreich bewertet werden kann. (4) Die Arbeit schließt mit Empfehlungen für eine nachhaltige Krisenbewältigung (5) und einer Schlussbetrachtung (6) ab. Inwiefern kann es gelingen, zukünftige Staatsschuldenkrisen zu verhindern bzw. nachhaltig zu bekämpfen?
Die vorliegende Arbeit wird sich fast ausschließlich auf die jüngste Zeit nach der Krise beziehen und aktuelle politische Maßnahmen, wie beispielsweise die Ablösung des ESFS durch den ESM nicht thematisieren. Im Folgenden ist also unter Rettungsschirm die Europäische Finanzstabilisierungsfazilität und nicht der europäische Stabilitätsmechanismus gemeint.
Die Griechenlandkrise und ihre Auswirkungen auf den Euroraum sollen hingegen weitgehend isoliert von der globalen Finanzkrise behandelt werden. Hohe Haushaltsdefizite und steigender Schuldstand sind zwar im gesamten Euroraum als Folge der Finanzkrise zu beobachten, in Griechenland hingegen sorgte eine unsolide Haushaltspolitik und ein jahrelanges Leben über den Verhältnissen zu den gegenwärtigen Haushaltsproblemen. Im direkten Vergleich mit den anderen „Krisenländern“ der Währungsunion schneidet Griechenland am schlechtesten ab.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ursachen der griechischen Staatsschuldenkrise
- Ausweitung auf die Eurozone: Die Eurokrise
- Maßnahmen Griechenlands und der EU
- Griechenlands Optionen
- Rettungspaket für Griechenland: Stabilisierungs- und Anpassungsprogramm
- Nachhaltige Eurokrisenbewältigung
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Beitrag des griechischen Staatsbankrotts zum Ausbruch der Eurokrise. Sie beleuchtet sowohl die griechischen als auch die europäischen Verantwortlichkeiten, indem sie endogene (z.B. unsolide griechische Haushaltspolitik) und exogene Faktoren (z.B. europäische Währungs- und Krisenpolitik) analysiert. Die Arbeit fragt nach den Ursachen der Krise, der Entwicklung von einer Staatsschulden- zu einer Eurokrise und bewertet kritisch die Maßnahmen Griechenlands und der EU.
- Ursachen der griechischen Staatsschuldenkrise (endogene und exogene Faktoren)
- Entwicklung der griechischen Staatsschuldenkrise zur Eurokrise
- Bewertung der griechischen und europäischen Krisenpolitik
- Analyse der Wettbewerbsfähigkeit der griechischen Wirtschaft
- Möglichkeiten einer nachhaltigen Krisenbewältigung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht die griechische Staatsschuldenkrise und deren Auswirkung auf die Eurozone. Sie beleuchtet die Kontroverse um die Berichterstattung und fragt nach dem Anteil des griechischen Staatsbankrotts am Ausbruch der Eurokrise, wobei sowohl griechische als auch europäische Verantwortlichkeiten betrachtet werden. Die Arbeit analysiert die Ursachen der griechischen Krise, deren Ausweitung auf die Eurozone und bewertet die darauf folgenden Maßnahmen.
Ursachen der griechischen Staatsschuldenkrise: Dieses Kapitel analysiert die Ursachen der griechischen Staatsschuldenkrise. Es hebt die verschlechterte Wettbewerbsfähigkeit Griechenlands hervor, die sich in steigenden Arbeitskosten und sinkender Produktivität manifestierte. Überhöhte Rentenleistungen und eine ineffiziente öffentliche Verwaltung werden als weitere Faktoren genannt. Die günstigen Kreditbedingungen durch die Eurozone ermöglichten übermäßige Staatsausgaben und verschleierten die strukturellen Defizite. Steuerhinterziehung und eine blühende Schattenwirtschaft reduzierten die Steuereinnahmen erheblich. Die Kombination aus überhöhten Ausgaben, niedrigen Einnahmen und der Verschleierung des wahren Ausmaßes der Verschuldung führte letztendlich zur Krise.
Ausweitung auf die Eurozone: Die Eurokrise: Dieses Kapitel beschreibt den Übergang von einer griechischen Staatsschuldenkrise zu einer umfassenden Eurokrise. Es wird deutlich, dass die anfänglich auf Griechenland beschränkte Krise durch Spekulationen auf den Finanzmärkten und das Bekanntwerden der gezielten Verschleierung des griechischen Schuldenstandes auf andere Länder der Eurozone übergriff. Die Offenlegung der unsoliden Haushaltspolitik Griechenlands löste ein Misstrauen in die Stabilität der gesamten Währungsunion aus, welches die Krise massiv verschärfte.
Maßnahmen Griechenlands und der EU: Dieses Kapitel befasst sich mit den Reaktionen Griechenlands und der EU auf die Krise. Es analysiert die Optionen Griechenlands und die Maßnahmen der Europäischen Union, wie das Rettungspaket. Die Erfolgsaussichten der Maßnahmen und die Frage, ob Griechenland sich selbst aus der Krise befreien konnte oder auf die Hilfe der Währungsunion angewiesen war, werden kritisch diskutiert.
Nachhaltige Eurokrisenbewältigung: Dieses Kapitel wird sich mit Strategien zur Vermeidung zukünftiger Staatsschuldenkrisen befassen und Empfehlungen für eine nachhaltige Krisenbewältigung geben. Es werden Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, zur Verbesserung der Haushaltsdisziplin und zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung diskutiert.
Schlüsselwörter
Griechenlandkrise, Eurokrise, Staatsschuldenkrise, Haushaltsdefizit, Wettbewerbsfähigkeit, Leistungsbilanzdefizit, EU, Währungsunion, Rettungspaket, Krisenbewältigung, Finanzpolitik, strukturelle Defizite, Steuerhinterziehung, Schattenwirtschaft.
Häufig gestellte Fragen zur griechischen Staatsschuldenkrise und der Eurokrise
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die griechische Staatsschuldenkrise und ihren Beitrag zum Ausbruch der Eurokrise. Sie untersucht sowohl die griechischen als auch die europäischen Verantwortlichkeiten, indem sie interne (z.B. unsolide Haushaltspolitik Griechenlands) und externe Faktoren (z.B. europäische Währungs- und Krisenpolitik) berücksichtigt. Die Arbeit befasst sich mit den Ursachen der Krise, ihrer Ausweitung auf die Eurozone und bewertet kritisch die Maßnahmen Griechenlands und der EU zur Krisenbewältigung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Ursachen der griechischen Staatsschuldenkrise (inklusive endogener und exogener Faktoren), die Entwicklung der Krise von einer nationalen zu einer europäischen Krise, die Bewertung der griechischen und europäischen Krisenpolitik, die Analyse der Wettbewerbsfähigkeit der griechischen Wirtschaft und Möglichkeiten einer nachhaltigen Krisenbewältigung.
Welche Ursachen für die griechische Staatsschuldenkrise werden genannt?
Die Arbeit identifiziert verschiedene Faktoren: Verschlechterte Wettbewerbsfähigkeit Griechenlands (steigende Arbeitskosten, sinkende Produktivität), überhöhte Rentenleistungen, ineffiziente öffentliche Verwaltung, günstige Kreditbedingungen durch die Eurozone (die übermäßige Staatsausgaben ermöglichten und strukturelle Defizite verschleierten), Steuerhinterziehung und eine blühende Schattenwirtschaft. Die Kombination dieser Faktoren führte zu überhöhten Ausgaben, niedrigen Einnahmen und der Verschleierung des wahren Ausmaßes der Verschuldung.
Wie entwickelte sich die griechische Staatsschuldenkrise zur Eurokrise?
Die anfänglich auf Griechenland beschränkte Krise weitete sich durch Spekulationen auf den Finanzmärkten und die Offenlegung der gezielten Verschleierung des griechischen Schuldenstandes auf andere Länder der Eurozone aus. Das Bekanntwerden der unsoliden Haushaltspolitik Griechenlands löste Misstrauen in die Stabilität der gesamten Währungsunion aus und verschärfte die Krise massiv.
Welche Maßnahmen wurden von Griechenland und der EU ergriffen?
Die Arbeit analysiert die Optionen Griechenlands und die Maßnahmen der EU, insbesondere das Rettungspaket. Es wird kritisch diskutiert, wie erfolgreich diese Maßnahmen waren und ob Griechenland sich selbst aus der Krise befreien konnte oder auf die Hilfe der Währungsunion angewiesen war.
Wie kann eine nachhaltige Eurokrisenbewältigung erreicht werden?
Die Arbeit widmet sich Strategien zur Vermeidung zukünftiger Staatsschuldenkrisen und gibt Empfehlungen für eine nachhaltige Krisenbewältigung. Dies beinhaltet Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, zur Verbesserung der Haushaltsdisziplin und zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Griechenlandkrise, Eurokrise, Staatsschuldenkrise, Haushaltsdefizit, Wettbewerbsfähigkeit, Leistungsbilanzdefizit, EU, Währungsunion, Rettungspaket, Krisenbewältigung, Finanzpolitik, strukturelle Defizite, Steuerhinterziehung, Schattenwirtschaft.
- Arbeit zitieren
- Jannik Müller (Autor:in), 2015, Die griechische Staatsschuldenkrise als Auslöser der Eurokrise? Ursachen und Folgen der Griechenlandkrise auf die Eurozone, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/321312